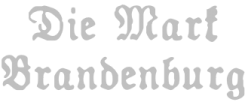Die Geschichte Brandenburgs ist unzertrennlich mit dem ostsächsischen Geschlecht der Askanier verknüpft.
Laut Sachsenspiegel reichen deren Wurzeln bis auf die altgermanischen Sueben zurück, was sich freilich nicht nachprüfen lässt.
Ihren Stammbau kann man verbindlich bis ins frühe elfte Jahrhundert zurückverfolgen. Graf Esico ist der erste namentlich erwähnte Vertreter dieses Geschlechts, was die Askanier zu einem der ältesten deutschen Hochadelshäuser macht. Albrecht, genannt der Bär, Ur-urenkel des Esico, setzte der Dynastie und dem südöstlichen Harzgebiet seinen Stempel auf. Mit seinem Tod teilten die Söhne gemäß dem seinem Vermächtnis den Familienbesitz, woraus zunächst drei askanische Hauptzweige entstanden:
- Die Linie Brandenburg (ausgestorben 1320)
- Die Linie Weimar-Orlamünde (ausgestorben 1486)
- Die Linie Anhalt-Aschersleben-Sachsen
Letztere unterteilte sich im Verlauf in weitere Linien:
- Sachsen-Wittenberg (ausgestorben 1422)
- Sachsen-Lauenburg (ausgestorben 1689)
- Anhalt, die sich wiederum unterteilte und wovon heute noch ein Zweig existiert.
Die Markgrafen Brandenburgs

(um 1100 bis 1170)
Durch die 1134 unter Kaiser Lothar III. erfolgte Erhebung zum Markgrafen der Nordmark, begann unter Albrecht I. die Frühgeschichte der späteren Mark Brandenburg. Als 1150 die Havelfestung Brandenburg und das umliegende Havelland als Erbe an die Askanier fiel, waren die territorialen Rahmenbedingungen für den Anfang der späteren Mark Brandenburg gegeben. Im Juni 1157 eroberte er die kurz zuvor verlorene Burg von Jaxa von Köpenick zurück, einem christianisierten Wendenfürsten. Es setzte ein zaghafter Zuzug von Siedlern aus dem Westen des Reichs ein, wodurch der Landesausbau erste Impulse erhielt.
Im Oktober 1157 bezeichnete sich Albrecht I. erstmals in einer Urkunde: „Ich Albrecht, von Gottes Gnaden Markgraf in Brandenburg“; „Ego Adelbertus Dei gratia marchio in Brandenborch“.
Albrecht legte den zweifelsfrei den Grundstein zur Entstehung der Mark, ob er gleichzeitig demgemäß auch der erste brandenburgische Markgraf war, ist eine Frage der Betrachtung und vielleicht auch der persönlichen Präferenz.

(1125 bis 1184)
Nach der askanischen Erbteilung im Jahre 1170 folgte nur Otto I. dem Vater als Markgraf, während die jpngeren Brüder als Grafen ihr jeweiliges Territorium erbeten. Ottos Regierung konzentrierte sich auf die Landeskonsolidierung und betrieb eine intensive Besiedlungspolitik. Aus vielen Gebieten des deutschen Reichsteils wanderten hierzu Kolonisten in die Mark ein. Die meisten dieser Siedler stammten aus Regionen Frieslands, Seelands, Hollands sowie aus Flandern, vom Niederrhein sowie Ost- und Westfalen. Sie gaben dem Land sein typisches Erscheinungsbild, das sich in den roten Backsteinbauten der brandenburgischen Altstädte bis heute sichtbar bemerkbar macht.
Mit dem Siedlerzuzug ging die Christianisierung der slawischen Bestandsbevölkerung einher. Bedeutende Klosterstiftungen, wie Lehnin in der Zauche, waren wichtige Eckpfeiler der Landeserschließung und Kristallisationspunkt einer rasch fortschreitenden Missionierung der Elbslawen.
Die Askanier waren in der Zeit der staufischen Kaiser zweckgebundene Anhänger des schwäbischen Geschlechts und profitierten wiederholt davon. Im Streit gegen die Welfen hielt sich Otto lange zurück und war erst in der entscheidenden Schlussphase aktiv beteiligt. Er erlebte 1180 die Demütigung und Entmachtung von Herzog Heinrich dem Löwen, konnte daraus aber keine Vorteile erzielen, im Gegensatz zu seinem jüngsten Bruder Bernhard, der zum Herzog von Sachsen aufstieg.
Otto kann als der erste wirkliche Markgraf von Brandenburg gesehen werden, da die Mark als eigenständiges Fürstentum erst unter seiner Regentschaft tatsächliche Form annahm. In seiner Regierungszeit ist der rote märkische Adler erstmals dokumentiert.

(1148 bis 1205)

(1177 bis 1220)
Otto II. ab 1184 und sein Halbbruder Albrecht II. ab 1205, konnten nacheinander regierend das Erbe des Großvaters und Vaters bewahren und sowohl Ausbau wie Expansion Brandenburgs weiter vorantreiben. In ihre Zeit fiel der große dritte Kreuzzug ins Heilige Land und der Tod Friedrichs I. Barbarossas, sowie der sich daran anschließende Thronstreit des Welfen Otto IV. mit dem Staufer Philipp von Schwaben. War Otto II. noch ein Anhänger der Staufer, musste Albrecht II. lavieren und bezog aus pragamatischen Gründen zeitweise Position für den welfischen Kaiser Otto IV., um rechtzeitig wieder ins siegreiche staufische Lager des jungen Friedrich II. zurückzuwechseln.

(um 1213 bis 1266) (1215 bis 1267)
Unter den bedeutenden markgräflichen Brüdern Johann I. und Otto III., Söhne Albrechts II., wuchs die Mark Brandenburg zu einem der größten Fürstentümer des Heiligen Römischen Reichs. Zunächst noch unmündig, sorgte die energische Mutter dafür, dass ihre Söhne zu ihrem Recht kamen. Als erfolgreiche Heerführer und Verwalter schufen sie ein Brandenburg, das die gesamte Region rechts der Elbe dominierte. 1257 wurde erstmals das Kurrecht, das Privileg zur Königswahl ausgeübt, womit man in den höchsten Kreis der Reichsfürsten aufstieg. Bis zum Ende ihrer über 40 Jahre dauernden Regentschaft hatten sie stufenweise eine Regelung erarbeitet und umgesetzt, die die territorialen Teilung Brandenburgs unter ihren insgesamt zwölf Söhnen regelte, bei gleichzeitig politischem Zusammenhalt. Sie gründeten während ihrer Regierung zahlreiche Städte, woraus sich ihr Beiname die Städtegründer ableitete. Vielleicht waren sie die größten askanischen Markgrafen überhaupt.

(1238 bis 1308)
Markgraf Otto IV. tat sich unter seinen elf Brüdern, Halbbrüdern und Vettern als der hartnäckigste, langatmigste und mit einer Ausnahme, langlebigste Charakter hervor und gab der brandenburgischen Politik durch sein energisches Wesen nachhaltig die Richtung vor. Die zeitgleich von mehreren Markgrafen verwalteten brandenburgischen Teilgebiete konnten gegen alle Erwartung größtenteils ohne schwere Auseinandersetzungen nebeneinander und miteinander koexistieren, obwohl es mit Otto V. dem ältesten Vetter der Ottonischen Linie, kurzzeitig zum ernsten Konflikt kam. Neben Otto IV., war es Bruder Konrad und Vetter Otto V., die weitere Akzente setzten. Brandenburg wuchs in dieser Zeit durch Eroberungen, Heirat besonders aber durch Kauf weiter und festigte seine Position im Konzert der einflußreichen Fürstentümer des Reichs. Otto IV. führte zahlreiche Kriege und war in der Verfolgung seiner Ziele ungewöhnlich ausdauernd. Rückschläge selbst größerer Natur entmutigten ihn nicht. Niederlagen konnten hierdurch langfristig in Erfolge umgemünzt werden. Da er kinderlos blieb, regierte gegen Ende sein späterer Nachfolger Waldemar als Mitregent an seiner Seite.

(um 1280 bis 1319)
Mit dem Tod Ottos IV. folgte Neffe Waldemar als regierender Markgraf. Zu Beginn seiner Regentschaft führte er die territoriale Expansion Brandenburgs fort und erweiterte im Vertrag von Soldin das Gebiet um die hinterpommerschen Burgbezirke Bütow, Rügenwalde, Stolpe und Schlawe. Später verkaufte er diese Landstriche an den Herzog von Pommern-Wolgast. Er lebte eine prächtige Hofhaltung und einen hochherrschaftlichen Habitus. Der Fürstentag zu Rostock, anlässlich dessen er von König Erik VI. von Dänemark, mit dem er verwandt war, zum Ritter geschlagen wurde, galt als die wahrscheinlich größte Veranstaltung der Zeit. Durch das Aussterben der Ottonischen Linie Brandenburgs vereinte Waldemar kurzzeitig alle brandenburgischen Gebiete unter seinem Regiment, was ihm den Beinamen der Große einbrachte. Er starb frühzeitig im mittleren Alter ohne eigene Nachkommen zu hinterlassen. Sein unmündiger Neffe Heinrich II. wurde designierter Nachfolger und brandenburgischer Universalerbe.

(1308 bis 1320)
Heinrich II., genannt das Kind, war beim Ableben Waldemars erst elf Jahre und damit unmündig. Er und die Mark wurden augenblicklich zum Spielball nahezu aller angrenzenden Fürsten. Ein rascher Abfall ganzer märkischer Regionen war schon nach wenigen Wochen erfolgt. Neben dem Streit um etwaige Ansprüche an der Mark, markierte der Streit um die Vormundschaft über Heinrich eine Facette der Gesamttragödie. Mit 12 Jahren wurde Heinrich von König Ludwig IV., seinem Onkel, für mündig erklärt. Tragischerweise verstarb er schon wenige Tage nach seinen ersten Regierungshandlungen, vermutlich in Prenzlau, in der Uckermark.
Mit dem Tode Heinrichs II. gingen 166 Jahre askanische Geschichte in Brandenburg zu Ende. Das Geschlecht der Askanier gab der Mark ihre Anfangsprägung. Sie erschlossen die Landschaften östlich von Elbe und Oder dem deutschen Kulturkreis, ohne das dort koexistierend slawische Erbe auszumerzen, wenngleich es über die Zeit mehr und mehr verdrängt wurde. Mit dem Erlöschen des ältesten askanischen Zweigs brach über die Mark Brandenburg ein mehrjähriges Interregnum herein. Acht Generationen askanischer Markgrafen hinterließen ein neues, gleichzeitig prominentes Fürstentum das die Reichsgrenze im Osten bildete. Ihr Stamm erlosch, die Gräber in den von ihnen gestifteten Klöstern Lehnin und Chorin gingen in den Jahrhunderten verloren, doch blieben ihre Namen und Taten durch die Zeit bis heute erhalten.
Vielleicht konnte dieses Buch dazu beitragen, die mitunter verwirrenden Zusammenhänge rund um die Entstehung und Ausbreitung der Mark Brandenburg zur Zeit der Askanier in gebührend ausführlicher Weise zu dokumentieren.