Verlobung und Huldigung der Stände
Waldemar hatte als neuer Alleinregent, denn quasi war er das, trotz seines noch lebenden Halbonkels Heinrich, zwei geerbte Hausforderungen zu lösen. Die eine umfasste den noch immer nicht entschiedenen, mittlerweile seit über einem Jahrzehnt laufenden Erbfolgekrieg um das Herzogtum Pommerellen, die andere betraf die Vormundschaft des unmündigen Markgrafen Johann, dem Universalerben in spe der Ottonischen Linie Brandenburgs. In Bezug auf das verwaiste Herzogtum, ergaben sich im Herbst 1308 entscheidende Ereignisse, auf die wir noch eingehen. Jetzt gilt unsere weitere Aufmerksamkeit zunächst den Bemühungen Waldemars um Anerkennung und Huldigung der Städte und des Adels in den Ottonischen Gebieten seines Mündels. Johanns Mutter, die nach dem Tod Markgraf Hermanns vorerst noch in der Mark blieb, war zwischenzeitlich in ihren fränkischen Witwensitz gezogen, wo sie wiederholt urkundete. Die Tochter des im Vorjahr ermordeten römisch-deutschen Königs Albrecht hatte nicht die Nerven und Durchhaltewillen, im ausgebrochenen Streit um das Vormundschaftsrecht über ihren Sohn, eine bestimmende, wenigstens teilhabende Rolle zu spielen. Wenngleich die gängige Sitte der Mutter eines vaterlosen Knaben scheinbar wenig bis keine Verfügungsrechte über dessen zukünftiges väterliches Erbe einräumte, blieb sie doch Mutter und ihre Einwände in Bezug auf dessen Wohl konnten nicht in den Wind geschlagen werden, wollte ein Vormund vermeiden die allgemeine Meinung gegen sich aufzubringen. Die Geschichte kennt zahlreiche Beispiele verwitweter Fürstinnen, die das weitere Schicksal des oder der Söhne aktiv mitgestalteten. Bei den Kaiserwitwen Adelheid und Theophanu angefangen, bis zur Wettinerin Mathilde von Groitzsch, der Urgroßmutter Waldemars, die nach dem Tod Albrechts II., trotz der von Kaiser Friedrich II. getroffenen Regelung, die weiteren Angelegenheiten ihre Söhne betreffend, tatkräftig in die Hand nahm. Judith von Henneberg, die hinterlassene Gattin Markgraf Hermanns, war augenscheinlich nicht aus gleichem Holz geschnitzt und so stritten sich die Parteien um den Sohn und das ihn betreffende Erbe ungehemmt. Ein früher Höhepunkt bildete die Entführung Johanns nach Spandau. Der Knabe war gerade erst von der Mutter an Waldemar übergeben worden und schon war er ihm wieder aus den Händen gerissen. Aufgebracht und den eigenen Onkel im Nacken, zog Waldemar vor die Festung und bemächtigte sich abermals des Jungen. Dieses Mal unter Anwendung von Waffengewalt. Eine Auseinandersetzung dieser Art entspannte sich nach derart heftigen Aktionen und Gegenaktionen naturgemäß nicht einfach wieder. Ein innenbrandenburgischer Militärkonflikt drohte. Städte und Adel waren von der Dramatik um ihren unmündigen Landesfürsten, alles spielte sich in den wenigen Wochen nach dem Tod ihres vormaligen Herrn ab, zutiefst erschüttert und verweigerten den Markgrafen der Johanneischen Linie jeden Akt der Unterwerfung und Huldigung. Die Geschehnisse, die sich im Spätsommer und Herbst 1308 im Herzogtum Pommerellen ereigneten, fesselten die Aufmerksamkeit Markgraf Ottos IV. und Waldemars ebenso, wie die Ermordung des Königs und die sich hierauf entspannenden Verhandlungen um ein neues Reichsoberhaupt. Vielleicht war es diesen Umständen zu verdanken, dass ein striktes Vorgehen ihrerseits verhütete und sich so die Gelegenheit ergab, die Gemüter etwas abzukühlen. Jetzt mit dem Tod Markgraf Ottos IV. war eine günstige Gelegenheit zum Neuanfang gekommen. Der alte Rivale der Ottonischen Linie hatte nach einem langen und ereignisreichen Leben die Augen für immer geschlossen und Neffe Waldemar war sein alleiniger Erbe. Die Zeit spielte ihm in die Karten, denn seine ihm versprochene Braut, die junge Markgräfin Agnes, die ältere Schwester seines Mündels Johann, war zwischenzeitlich ins heiratsfähige Alter gekommen. Markgräfinwitwe Anna, sie nannte sich nun eine Gräfin Henneberg, kehrte wieder in die Mark zurück, wo sie in der Grafschaft Arneburg, neben Schmalkalden in Thüringen und Coburg in Oberfranken, einen brandenburgischen Witwensitz in der Altmark besaß. In dieser Zeit, es war wohl schon Frühling 1309, wurden zwischen Waldemar und Markgräfin Anna wahrscheinlich die letzten Formalitäten zur öffentlichen Verlobung besprochen. Am 8. Mai, zu Christi Himmelfahrt, sehen wir Waldemar und Anna in Tangermünde eine Schenkung des ehemaligen Mundschenken Markgraf Hermanns zugunsten des Heilig-Geist-Hospital in Stendal bestätigen. Gleichzeitig befreien sie das Spital von allen landesherrlichen Abgaben zum Seelenheil des verstorbenen Markgrafen Hermann, seines Mündels verstorbenem Vater. Zwei wichtige Bemerkungen an dieser Stelle. Waldemar befreite das Hospital nicht in den ihm zugehörigen Besitzungen, sondern in jenen, die seit vorherigem Verkauf, in den Ottonischen Herrschaftsbereich fielen. Er nahm damit eine Regierungshandlung als Vormund an Johanns statt vor. Nun hatte er schon zu Anfang seiner Vormundschaft in dessen Namen Veräußerungen vorgenommen, die ihm seinerzeit Vorhaltungen der von Markgraf Hermann bestellten altmärkischen Vormünder einbrachte. Einer dieser, Ritter Droisecke von Kröcher, war jetzt im Mai in Tangermünde mit anwesend und erscheint unter den Zeugen, wodurch dessen Zustimmung ersichtlich wird. Es musste sich zwischenzeitlich etwas Entscheidendes am Verhältnis verändert haben. Eine Urkunde vom 14. Mai 1309 gibt den entscheidenden Hinweis. Darin bezeichnet Waldemar den jungen Markgrafen Johann als seinen Schwager, was er in keiner vorherigen Urkunde bislang tat. Die letzte Urkunde vor jener von Tangermünde vom 8. Mai, wurde am 4. Mai ausgestellt, worin im Zusammenhang mit Johann noch nicht von einem Schwagerverhältnis die Rede war. Die offizielle Verlobung muss daher ohne Zweifel in der Zeit zwischen dem 4. Mai und dem 14. Mai stattgefunden haben. Das Treffen mit Markgräfin Anna, seiner zukünftigen Schwiegermutter, sowie die an Christi Himmelfahrt gemeinsam vorgenommene Abgabenbefreiung zum Wohle des Stendaler Hospitals und zum Seelenheil des verstorbenen Markgrafen Hermann, entsprachen ganz den damaligen Gepflogenheiten, anlässlich freudiger Anlässe großzügig gegenüber Armen und Bedürftigen zu sein. Tatsächlich erfolgten nun in rascher Folge die Huldigungen der Ottonischen Städte, denn wir sehen Waldemar in jener schon erwähnten Urkunde vom 14. Mai der Doppelstadt Berlin-Cölln die Privilegien bestätigen. Ein Akt, der stets in direktem Zusammenhang mit der Leistung des Huldigungseids stand. Eine gleichlautende Urkunde wurde am selben Tag für Salzwedel ausgestellt und wahrscheinlich für weitere Städte der Ottonischen Städte. Mit den Kommunen im Rücken, war die Unterwerfung und Huldigung des Adels eine reine Formsache geworden. Den Mai 1309 dürfen wie mit Recht als Beginn der tatsächlichen Regentschaft Waldemars über beiden brandenburgischen Linien betrachten.
Der Eheschließung stand derweil die nahe gegenseitige Verwandtschaft im Wege. Waldemars Großvater und Agnes Urgroßvater waren Brüder, nämlich die als Städtegründer bekannt gewordenen Markgrafen Johann I. und Otto III. Um die Ehe zu legitimieren, erbat Waldemar bei Papst Clemens V. Dispens, die dieser am 9. November 1309 erteilte. Es ist jene päpstliche Dispensurkunde, aus der wir wichtige Hintergründe im Zusammenhang dieser Verbindung an früherer Stelle vorweggenommen haben, so den geheimen Charakter des Eheplans, initiiert von den Markgrafen Konrad und Hermann aber auch die unbedingte Ernsthaftigkeit des Vorhabens, durch Stellung von Bürgen etc.
Danzig fällt
Jener wechselvolle Erbfolgekrieg um das verwaiste Herzogtum Pommerellen, das seit dem Tod Herzog Mestwins II. Dezember 1294 die Begehrlichkeiten vieler Fürsten weckte, dauerte mittlerweile schon 14 Jahre. In dieser Zeit stritten Brandenburg, Polen, Pommern-Wolgast, Rügen und Böhmen in unterschiedlichen Konstellationen und Geschick um Teile der Landmasse oder sogar um die volle Sukzession. Weiter glaubte auch das schlesische Herzogtum Glogau, nachdem in Böhmen die Přemysliden im Mannesstamme ausgestorben waren, Ansprüche zu besitzen. Am Ende, von Polen hinzugerufen, mischte auch der Deutsche Orden mit, wodurch in Verkettung einiger Ereignisse, letztendlich die Vorentscheidung fiel. Brandenburg gelang es während der ersten kriegerischen Hochphase 1295/96, einige Gebietsgewinne entlang der Warthe und Netze gegen Großpolen durchzusetzen, ohne eine eigentliche Entscheidung Pommerellen betreffend erstreiten zu können. Der Tod Przemysł II., das hieraus entstehende Vakuum und die ausbrechenden Wirren, spielten bei den damaligen brandenburgischen Eroberungen eine entscheidende Rolle. Zu weiteren Erfolgen kam es derweil nicht. Im weiteren Verlauf übten abwechselnd entweder Böhmen oder Polen die Herrschaft in Pommerellen aus. Wer, das hing vom jeweiligen Stand des parallel laufenden böhmisch-polnischen Konflikts um die polnische Krone und das Herzogtum Kleinpolen ab, so dass entweder der kujawische Herzog Władysław I. Ellenlang, erwählter Nachfolger Przemysłs im Herzogtum Großpolen, oder Wenzel II. von Böhmen mehr oder minder die Herzog in Pommerellem war. Umstrittene Situationen, in denen die Besitzverhältnisse unklar, das führungsloses Land durch allerlei Kriegshandlungen ausgelaugt, waren bestens geeignet, lokale Kräfte und Machtstrukturen erstarken zu lassen. Die üblicherweise nur aus der Ferne und von fremden Verwaltern vertretenen Landesherren taten gut daran, auf derartige Strukturen und Personenkreise zurückzugreifen, liefen jedoch gleichzeitig Gefahr, das Szepter aus der Hand zu geben. Es war ein Balanceakt, der Fingerspitzengefühl und Einsicht in die regionalen Verhältnisse voraussetzte, woran es oftmals naturgemäß mangelte. Eine wichtige Rolle spielten im Großraum Danzig das Geschlecht der Schwenzonen, besonders Peter von Neuenburg, auch Peter Swenza genannt, ältester Sohn Graf Swenzas. Diese pommerellsche Ministerialenfamile war durch ihre Dienste für die Herzöge zu Titel und Besitz gekommen und hauptsächlich in den Distrikten Schlawe und Stolp begütert. Peter von Neuenburg verstand es in den Wirren, die dem Aussterben der Samboriden mit dem Tod Herzog Mestwin II. folgten, als regionale Größe den eigenen Einfluss weiter zu vergrößern. Neben ihm agierte Vater Swenza als Woiwode (Statthalter) von Danzig sowie Peters jüngere Brüder Lorenz und Johann. Ihre Rolle war zweifelsohne in der Region eine wichtige und als solche schienen sie sich durch persönlichen Einsatz für den Landfrieden im Sinne Herzog Władysławs eingesetzt zu haben, wozu es nach eigenen Angaben wiederholt notwendig wurde Güter zu versetzen, in aller Regel an den Deutschen Orden. Im Frühjahr 1308 wurde Peter bei Władysław Ellenlang wegen der von ihm und der Familie im Dienste des Landfriedens ausgelegten Summen vorstellig, konnte aber keinen befriedigenden Nachweis erbringen. Dass Władysławs notorisch leere Kassen, er musste fortlaufende Kriege gegen Böhmen, Glogau, Brandenburg und Litauen etc. finanzieren, bei der Ablehnung der eigentlich ausschlaggebende Punkt war, sollte erwähnt werden. Der verprellte Peter von Neuenburg sann auf Rache und nahm Kontakt zu den brandenburgischen Markgrafen Otto IV. und Waldemar auf. Er sagte ihnen Beistand bei der Eroberung einer Anzahl wichtiger Burgen als Ausgangsbasis eines großangelegten Eroberungsfeldzugs Pommerellens zu. Dieser Plan kam Władysław zu Ohren, der nicht zögerte und Vater Swenza sowie Sohn Peter sofort gefangen nehmen und in Krakau inhaftieren ließ. Die Internierung vor allem des Seniors, machte den nachhaltigsten Eindruck unter den Verwandten und Freunden der Familie, selbst unter einzelnen polnischen Magnaten, die sich alle für eine Freilassung stark machten. Unter dem Druck dieser Bewegung wurde zunächst der alte Graf am 22. Juni 1308 freigelassen, gefolgt von Peter im Hochsommer, allerdings unter Stellung von Geiseln in Person von Lorenz und Johann, den jüngeren Brüdern Peters. Diese bestachen ihre Wächter, flohen zum Bruder und dann gemeinsam zu den brandenburgischen Markgrafen. Noch im Sommer rüsteten Otto IV. und Waldemar ein großes Heer und fielen Mitte August in Pommerellen ein, wo sie plündernd und brandschatzend vordrangen. Mehrere Städte und Burgen öffneten ihre Tore, da die Gebrüder Swenza und ihr Vater im Gefolge der Brandenburger kämpften. Ende August wurde Danzig erreicht, auf deren Besitz die Markgrafen den größten Wert legten. Erinnern wir uns einige Jahrzehnte zurück, an die Lebzeiten Herzog Mestwins II., als dieser im Erbstreit mit dem eigenen Bruder den Besitz der Stadt Waldemars Vater Konrad I. zusagte. Im Gegenzug sollte dieser ihn im Kampf gegen den eigenen Bruder und Onkel beistehen. Markgraf Konrad eroberte Danzig seinerzeit mit großer Leichtigkeit, die starke deutsche Bevölkerung hatte daran tatkräftigen Anteil. Mit der angrenzenden, gut befestigten Burg sah es anders aus. Sie musste belagert und im Kampf genommen werden. Später wollte Mestwin von der getroffenen Vereinbarung nichts mehr wissen, forderte Danzig für sich, was Konrad verweigerte, worauf der treulose Herzog seinen geleisteten Lehnseid gegenüber Brandenburg brach und sich dem großpolnischen Herzog in die Arme warf, der hieraus seither seinen Anspruch auf Pommerellen ableitete.
Brandenburgs rascher Vormarsch in Pommerellen im Spätsommer 1308, rief den westlich angrenzenden Herzog Bogislaw IV. von Pommern-Stettin auf den Plan. Dieser schaute im Hinblick auf die seit Generationen schwelende Frage nach der allgemeinen Oberlehnshoheit Brandenburgs über ganz Pommern, mit größter Sorge auf den Entwicklung, und intervenierte militärisch gegen Brandenburg, alles in bestem Einvernehmen mit Władysław Ellenlang. Otto IV. und Waldemar warfen ein weiteres Heer dem Herzog entgegen. Ob es sich dabei um eine zusätzlich ausgehobene Armee handelte oder eine Abteilung des ersten, ob einer oder beiden den Befehl führte oder ein Hauptmann beauftragt wurde, ist nicht überliefert. Wie es auch war, diese Gruppe brach furchtbar verheerend ins Bistum Kammin, des Bischof sich erst wenige Jahre davor eng mit Brandenburg verbünden wollte, dann aber von Pommern kriegerisch unterworfen wurde. Bogislaws Intervention lief ins Leere, die Brandenburger blieben Herr der Lage und setzten ihren Vormarsch Richtung Danzig ungehindert fort. Anfang September 1308 standen sie vor der Stadt und abermals öffneten ihnen die überwiegend deutsche Bevölkerung die Tore, so dass Danzig kampflos eingenommen wurde. Wieder zogen sich die Verteidiger auf die Burg zurück, wie seinerzeit beim Angriff Markgraf Konrads. Das Kommando hatte Landrichter Bogussa und der Burghauptmann Woyciech (deutsch Albrecht). Täglich bestürmten die Brandenburger die Mauern, konnte aber von der starken polnischen Besatzung beherzt zurückgeschlagen werden. Die brandenburgischen Markgrafen waren derweil Mitte September zurück aufs Jagdschloss Werbellin gegangen. An diesem Ort in der Neumark konnten sie schneller auf die eingehenden Nachrichten von den Verhandlungen im Zusammenhang mit der im Reich anstehenden Königswahl regieren, zugleich waren sie nicht zu weit von den Kriegsschauplätzen in Pommerellen entfernt. Otto IV. machte sich zu dieser Zeit noch gewisse Hoffnungen auf die Wahl zum römisch-deutschen König, tatsächlich waren aber im frühen Herbst am Rhein die Würfel zugunsten des Grafen Heinrich von Luxemburg gefallen.
In der arg bedrängten Burg zu Danzig wurde die Lage für die Belagerten immer schwieriger. Während die Brandenburger von den deutschen Stadtbewohnern versorgt wurden, machte sich unter den Burginsassen erster Mangel bemerkbar. Mit polnischem Entsatz war nicht mehr zu rechnen, das hatten die wenigen aber deutlichen Nachrichten eingesickerter Kuriere unmissverständlich vermittelt. In dieser äußerst ernsten Lage übergab Landrichter Bogussa den Oberbefehl an Burggraf Woyciech. Er selbst musste persönlich bei Władysław Ellenlang vorstellig werden, um ihm die Dringlichkeit der Situation Auge in Auge mitzuteilen. Vielleicht war auch ein ganzes Stück Eigennutz dabei, denn es war nur zu wahrscheinlich, dass die Burg demnächst fiele, wodurch er den Brandenburgern in die Hände geriete. Unentdeckt gelang ihm in kleiner Begleitung die gefährliche Flucht aus der belagerten Festung. Anfang Oktober traf er seinen Landesherren zu Sandomierz und empfahl zum Deutschen Orden Kontakt aufzunehmen. Das gegenseitige Verhältnis zwischen den Deutschrittern und den südlich angrenzenden polnischen Teilherzogtümern, hatte seit der fulminanten Expansion des Ordens gelitten, besonders hinsichtlich Masowien, trotzdem war es keineswegs feindlich. In dem stets vorzüglich gewappneten Ritterorden hätte man, sollte es zur Einigung kommen, einen mehr als potenten Zweckverbündeten gegen Brandenburg gefunden. Bislang musste ihm das volle Ausmaß des brandenburgischen Vorstoßes in Pommerellen nicht klar gewesen sein. Möglicherweise hielt er den Einfall für nicht mehr, als einen neuerlichen Plünderzug, wie es zu vielen seit Beginn der Auseinandersetzung um das Herzogtum in abwechselnder Weise gekommen war. Unter dieser Art Kriegsführung litten hauptsächlich die Bauern und ungeschützten Dörfer auf dem Land, sonst hatte es aber bislang kaum konfliktentscheidenden Einfluss gehabt. Überzeugt von der Notwendigkeit nun schnell handeln zu müssen, stimmte er dem Plan des Landrichters zu, der sich unmittelbar auf den Weg nach Elbing machte, wo er den preußischen Landmeister Heinrich von Plötzke traf und mit ihm unterhandelte. Dem Orden kam die Anfrage nicht unbedingt gelegen, immerhin war sie gegen einen Vasallen des Reichs gerichtet, dem man sich aufs Engste verbunden fühlte und dessen Reichsadler das eigene Wappen zierte. Heinrich von Plötzke, auch von Plötzkau genannt, entstammte aus einer Familie anhaltinischer Ministeriale im Dienste der askanischen Grafen von Anhalt, Verwandte unserer brandenburgischen Markgrafen, was die Umstände für den Landmeister nicht einfacher machten. Hinsichtlich der akuten Querelen mit dem Erzbischof von Riga, konnte man sich jedoch Polen, oder auch nur Teile davon, nicht als verprellten Nachbaren leisten und so kam es zu einer Einigung. Für ein Jahr traten Verbände des Ordens gegen Bezahlung in den Dienst Władysław Ellenlangs. Mit einem stattlichen Heer rückten die Ordensritter heran. Die Burg wurde je zur Hälfte mit polnischen und pommerellschen Truppen unter Führung des Landrichters Bogussa und einer Mannschaft der Ordensritter unter dem Kommando Günthers von Schwarzburg, dem Landkomtur von Kulm, belegt. Schon bald ließen es die kriegserfahrenen Ordensritter nicht mehr nur mit bloßer Abwehr der brandenburgischen Angriffe auf sich beruhen, sie unternahmen ihrerseits beherzte Ausbrüche, und fügten dabei den Belagerern empfindliche Verluste zu. Die Eroberung der Burg war durch die verstärkte Besatzung in weite Ferne gerückt und das herbstliche Wetter kündete bereits den nahenden Winter an und so zogen sixh die Brandenburg unter Zurücklassung einer Stadtgarnison zurück. Mit Hilfe einer Anzahl deutscher Bürger, gelang es zunächst die Stadt zu halten. Aus den Belagerern wurden jetzt Belagerte und bald schon drangen die Polen in die Stadt ein, wobei die brandenburgische Besatzung in wilden Straßenkämpfen niedergemacht wurde. Hierbei kam wohl auch eine unbestimmte Zahl Zivilisten ums Leben. Nach geglückter Eroberung glaubten die Polen den Orden nicht mehr zu benötigen, der davon irritiert, auf Einhaltung ihres Vertrags pochte und sein Geld verlangte. Es kam zu ernsten Szenen untereinander und beide Seiten, eben noch Verbündete, verschanzten sich in ihrer jeweiligen Hälfte der Burg. Danzig selbst, blieb in den Händen der Polen, die unter der deutschen Bevölkerung nach den Unterstützern der Brandenburger fahndeten und eine Reihe Todesurteile vollstreckten.
Die auf dem Siedepunkt angekommene Stimmung in der Burg, eskalierte eines Nachts, indem die Deutschritter über die Besatzung der polnischen Burghälfte herfielen und wen sie nicht erschlugen, gefangen nahmen, darunter Bogussa samt einer Anzahl seiner Ritter und Mannen. Der Rest floh zu den eigenen Leuten in der Stadt, wo man eilig die Verteidigung vorbereitete. Schon wieder drehte sich das Kriegsglück für Polen und ihrer pommerellschen Anhänger. Die Brandenburger war aus dem Land, zumindest aus den östlichen Teilen des Herzogtums, doch dafür hatte man jetzt die Ritter des Deutschen Ordens am Hals. Der Kulmer Landkomtur Günther von Schwarzburg war sich seiner Sache nicht sicher, sandte Eilboten mit Bericht über die Weichsel zum Landmeister, bat darin um Verstärkung, und harrte derweil in der Burg mit seinen Gefangenen aus. Landmeister Heinrich von Plötzke säumte nicht, rüstete ein Heer aus und führte es persönlich gegen Danzig. Die von zeitgenössischen polnischen Chronisten berichtete Zahl von 10.000 Mann, dürfte es keinesfalls erreicht haben, doch war es den Verteidigern in der Stadt dennoch zahlenmäßig weit überlegen. Am 13. November 1308 kam es zu den entscheidenden Kampfhandlungen. Der endgültigen Eroberung gingen sehr heftige Kämpfe in den Straßen voraus. Berichten zufolge kamen an die 50 polnische Ritter dabei ums Leben, sowie eine wahrscheinlich hohe Zahl Bürger, die sich den Verteidigern angeschlossen hatten. Auch wenn es keinesfalls zu jenen Massentötungen kam, die in polnischen Chroniken mit 10.000 Erschlagenen beziffert werden, ganz Danzig hatte damals wohl gerade so viele Einwohner in der Summe, darunter viele Deutsche, scheinen die Ordensritter nichtsdestotrotz mit großer Schonungslosigkeit bei der Eroberung vorgegangen zu sein, weswegen nicht zu bezweifeln ist, dass es zu ungezählten blutigen Szenen kam. Gräuelpropaganda einerseits, verharmlosende Gegendarstellungen andererseits, war bereits damals gängiges Mittel waffenloser Kriegsführung.
Landrichter Bogussa, wohl um seine Freiheit zu erlangen, bot den Ordensrittern das Nießbrauch die Burg an, bis es zur Einigung wegen der ausstehenden Kriegskosten mit Władysław Ellenlang käme. Landmeister von Plötzke hatte inzwischen andere Pläne. Er glaubte wohl schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an eine Begleichung der Kosten, die sich mit der zweiten Belagerung Danzigs noch erhöht hatten, und schritt zur Unterwerfung ganz Ostpommerellens. Diesem Plan folgend, zog er zum wichtigen Weichselübergang bei Dirschau, wo seit dem frühen 13. Jahrhundert eine starke Burganlage die angrenzende Stadt schützte, ganz ähnlich dem Beispiel Danzigs. In Dirschau hatte einer der Neffen Władysławs seine Residenz, Herzog Kasimir von Kujawien. Angeblich soll dieser dem heranziehenden Landmeister entgegen gezogen sein und sich eingedenk der langen und guten Beziehungen, auf die Knie geworfen haben und um Verschonung Dirschaus gebeten haben. Der Landmeister soll das Anerbieten kühl abgeschlagen und freien Abzug des Herzogs angeboten haben. Es kam zur Belagerung Dirschaus. Der Orden beschoss mit mehreren Wurfmaschinen die festen Mauern und berannte wieder und wieder die Wehranlage, deren Besatzung sich mit Geschick und Tapferkeit zur Wehr setzte und den Angreifern manchen Verlust zufügte. Den Fall ihrer Burg konnten sie nicht verhindern. Ob durch Beschuss oder Brandstiftung der Besatzung ist ungeklärt, doch geriet die Burg in Flammen und wurde aufgegeben. Im allgemeinen Chaos konnten erhebliche Teile der Verteidiger fliehen. Dem Deutschen Orden fiel, sehr zum Missvergnügen des Landmeisters, eine schwelende Ruine in die Hände. Aufgeschreckt von den desaströsen Nachrichten aus Pommerellen, fühlte sich Władysławs veranlasst auf dem Verhandlungsweg zu einer Einigung mit dem Heinrich von Plötzke und dem Orden zu kommen. Zu bieten hatte er nichts, seine Kassen waren weiterhin leer und seit dem Fall Danzigs war klar, dass die Deutschritter mehr als die ursprünglich geforderten 10.000 Mark Silber zur Begleichung ihrer Kriegskosten wollten. Mit leeren Taschen aber den langatmigsten Worten das traditionell freundschaftliche und ehrenvolle gegenseitige Verhältnis betreffend, traf er den Landmeister im Grenzgebiet Kujawiens, in der wohl zuversichtlichen Hoffnung eine einvernehmliche Einigung erzielen können und mit dem Orden Ratenzahlung zu vereinbaren. Heinrich von Plötzke eröffnete ihm nun seine Rechnung und Władysław war tief erschüttert. Der Orden forderte 100.000 Schock (60) böhmische Silbergroschen. Aus den ursprünglich 10.000 Mark Silber, das einem Gewicht von rund 2.300 Kilogramm entsprach, waren jetzt mehr als 6.000.000 böhmische Groschen, mit einem Silbergewicht von mehr als 21 Tonnen geworden, eine ungeheuerliche Summe. Tief bestürzt wollte Władysław die Entscheidung einem Schiedsgericht überlassen, doch Landmeister Heinrich von Plötzke, sicher das Geld, gleich welche Summe auch immer, niemals zu sehen, blieb unerbittlich. Władysław brach das Treffen ab und verließ im Groll den Versammlungsort. Ein tiefes Zerwürfnis war eingetreten, der Gegensatz zwischen Polen und dem Deutschen Orden nahm hier seinen Anfang. Allerspätestens jetzt waren die Würfel gefallen, das Weichselgebiet Pommerellens sollte fest in die Hand der Ordensritter geraten. Mit dem Fall Danzigs und Dirschaus waren die Vorraussetzungen geschaffen, es fehlte noch Schwetz (polnisch Świecie) an der Weichsel. War die Einnahme Dirschaus schon kein einfaches Unterfangen, stellte Schwetz noch eine weit größere Herausforderung dar.
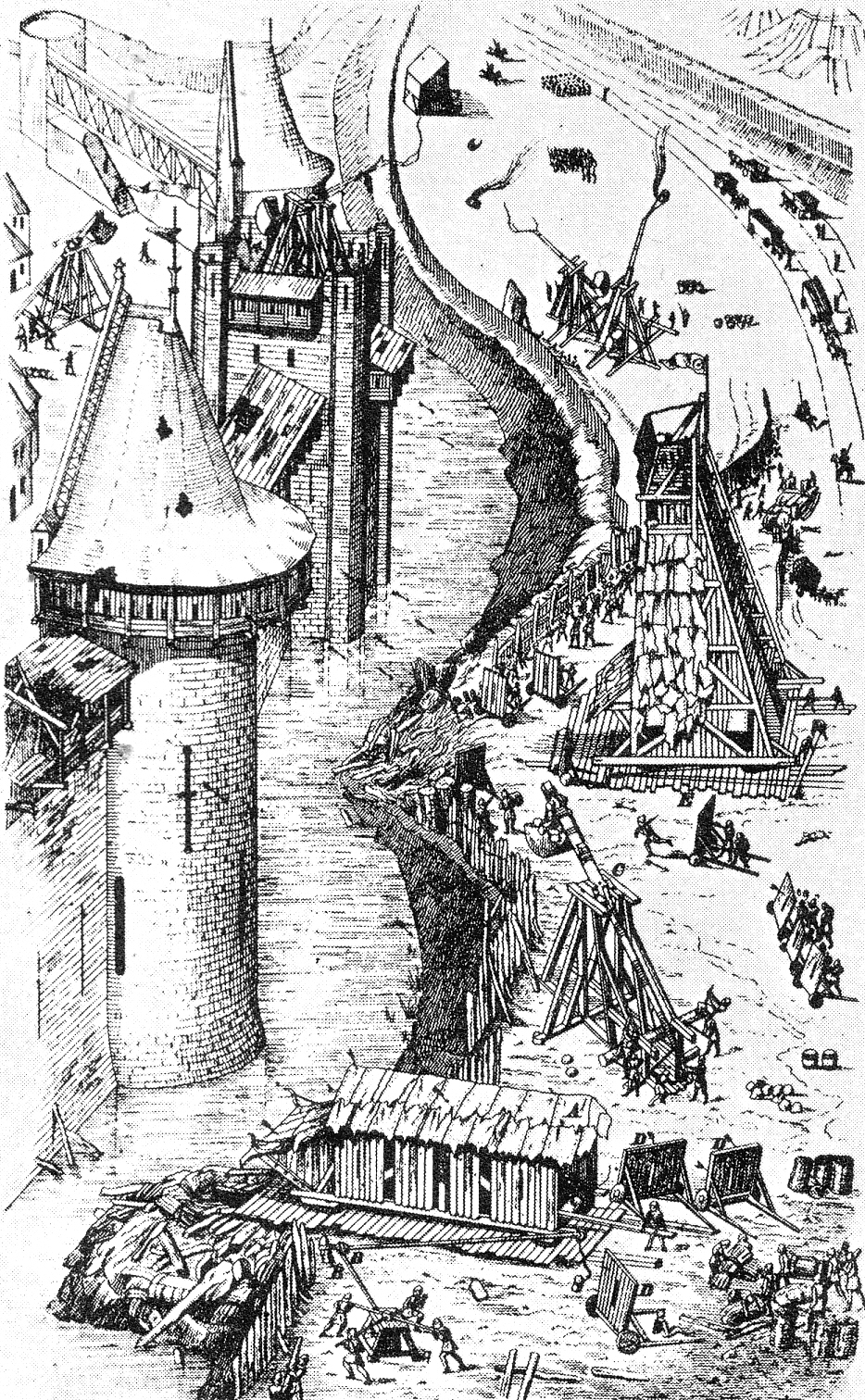 Am Zufluss der Wda (deutsch Schwarzwasser) in die Weichsel gelegen, erlaubte die nah an der Stadt liegende Burg, nur im Süden, dort zusätzlich geschützt von einer Vorburg, die Möglichkeit zum Angriff. Neben der ohnehin starken Besatzung, wurde die Verteidigung zusätzlich von den aus Dirschau entkommenen Streitkräften verstärkt. Gegen Ende 1308 begann die Belagerung. Zur Einnahme wurden vier große Belagerungstürme errichtet, die über Wochen in ständiger Bewegung Angriff auf Angriff gegen die massiven Festungsmauern durchführten. Die Verteidigung, die auf auf ein stattliches Arsenal von Verteidigungsmaschinen zurückgreifen konnten, hielt allen Angriffen stand. Die Einnahme auf herkömmlichem Weg war unabsehbar und so griffen die Ordensritter zu allerlei Mitteln der psychologischen Kriegsführung. In guter Sichtweite zur Burg, wurden zwölf Galgen errichtet, zum abschreckenden Beispiel, was den Verteidigern blühte, sollten sie ihren Widerstand fortführen. Allein, es half nichts. Die Burgbesatzung war sich seiner vorteilhaften Stellung sehr sicher und unternahm keinerlei Anstalten zur Übergabe. Wie oft gab Verrat am Ende den Ausschlag. Neben polnischen Truppen, waren ebenso zahlreiche pommerellsche Ritter und Mannschaften unter den Verteidigern. Nicht alle von diesen waren in ihrer Anhänglichkeit gegenüber Władysław Ellenlang unkompromittierbar und so fand sich unter der Mannschaft ein gewisser Edelmann Namens Czedrowicz, der sich bestechen ließ. Eines Nachts durchschnitt er die Seile und Sehnen der Verteidigungsmaschinen und flüchtete aus der Burg zu den Ordensrittern, um davon zu berichten. Schon am frühen nächsten Morgen begann ein neuerlicher Ansturm auf die Mauern. Die Insassen der Burg, beraubt ihrer effizientesten Verteidigungsgeräte, mussten unter Einsatz aller Hilfsmittel den Angriff abschlagen und konnten so noch einmal einige Tage gewinnen, doch war der Durchhaltewille ernsthaft untergraben. Sie ersuchten um eine einmonatige Waffenruhe. Nach Ablauf der Frist, käme von außen keine Hilfe, würde man die Burg übergeben. Landmeister Heinrich von Plötzke bewilligte die Waffenruhe. Seine Truppen benötigten der Erholung, zumal der Winter zwischenzeitlich mit ganzer Härte hereingebrochen war. Aus der Burg wurden Boten in aller Heimlichkeit an den Hof Władysławs gesandt, um dringend Unterstützung anzufordern. Er vermochte nur wenig zu leisten und sandte mit Kastellan Andreas von Rosberg und Landrichter Michael von Sandomierz, was er an Truppen entbehren konnte, und es war wenig genug. Kaum wurden sie der Ordensritter ansichtig, zogen sie kampflos ab. Die Burg musste vereinbarungsgemäß aufgeben. Den Insassen wurde freier Abzug gewährt, darunter befanden sich die Herzöge Przemysław und Kasimir, beides Söhne Herzog Siemomysławs von Kujawien, einem Halbbruder Władysław Ellenlangs. Neben den starken Festungsalagen von Danzig, Dirschau und Schwetz, waren währenddessen von anderen Heerhaufen des Ordens weniger befestigte Orte genommen worden, so etwa Könitz, Tuchel oder Schlochau. Für die heimgesuchte Bevölkerung der erwähnten Städte kehrte jetzt nicht wie erhofft Friede unter neuen Herren ein. Schwere Steuern, Enteignung allen Besitzes, Vertreibung des polenfreundlichen Adels bis hin zur Vertreibung einer ganzen Stadtbevölkerung, wie im besonders tragischen Fall von Dirschau. Die Habe der Bewohnerschaft genügte nicht, die Schadensersatzforderungen des Ordens zu befriedigen und der Magistrat musste sich im Februar 1309 dazu verpflichten nach Pfingsten mit der gesamten Bevölkerung die Stadt zu verlassen und nie wieder zu kommen. Die ungewöhnliche Härte, mit der die Ordensherren in Pommerellen gegen Städte und Adel vorgingen, kann nicht auf Geldnot zurückgeführt werden, es scheint vielmehr, dass man grundsätzlich wenig Vertrauen in die Bewohnerschaft hatte und ganz der bisherigen Besiedlungsstrategie in Preußen, deutsche Siedler und Edelleute heranführen wollte. Das eingetriebene Geld, es können etwa 30.000 Mark Silber veranschlagt werden, sollte zur Entschädigung Władysławs aufgewendet werden. Der Orden war fest entschlossen der Besetzung Ostpommerellens, die endgültige Annexion folgen zu lassen und hierzu sollte Władysławs ausbezahlt werden, damit er auf seine Ansprüche verzichte. Ob er tatsächlich den Betrag oder Teile davon je erhielt, wissen wir nicht. Dem Orden, der bei Anwendung von Waffengewalt wenig Hemmungen bewies, war andererseits auf der staatsrechtlichen Seite desto bemühter seine Erwerbungen zu legalisieren und abzusichern. So kaufte er für tausend Mark Thorner Denare von Herzogin Salome, Mutter der oben erwähnten Kujawischen Herzöge, den sogenannten Fischwerder zwischen Nogat und Weichsel ab. Der mit viel Rücksicht ausgehandelte Vertrag, wurde im Oktober 1309 ratifiziert.
Am Zufluss der Wda (deutsch Schwarzwasser) in die Weichsel gelegen, erlaubte die nah an der Stadt liegende Burg, nur im Süden, dort zusätzlich geschützt von einer Vorburg, die Möglichkeit zum Angriff. Neben der ohnehin starken Besatzung, wurde die Verteidigung zusätzlich von den aus Dirschau entkommenen Streitkräften verstärkt. Gegen Ende 1308 begann die Belagerung. Zur Einnahme wurden vier große Belagerungstürme errichtet, die über Wochen in ständiger Bewegung Angriff auf Angriff gegen die massiven Festungsmauern durchführten. Die Verteidigung, die auf auf ein stattliches Arsenal von Verteidigungsmaschinen zurückgreifen konnten, hielt allen Angriffen stand. Die Einnahme auf herkömmlichem Weg war unabsehbar und so griffen die Ordensritter zu allerlei Mitteln der psychologischen Kriegsführung. In guter Sichtweite zur Burg, wurden zwölf Galgen errichtet, zum abschreckenden Beispiel, was den Verteidigern blühte, sollten sie ihren Widerstand fortführen. Allein, es half nichts. Die Burgbesatzung war sich seiner vorteilhaften Stellung sehr sicher und unternahm keinerlei Anstalten zur Übergabe. Wie oft gab Verrat am Ende den Ausschlag. Neben polnischen Truppen, waren ebenso zahlreiche pommerellsche Ritter und Mannschaften unter den Verteidigern. Nicht alle von diesen waren in ihrer Anhänglichkeit gegenüber Władysław Ellenlang unkompromittierbar und so fand sich unter der Mannschaft ein gewisser Edelmann Namens Czedrowicz, der sich bestechen ließ. Eines Nachts durchschnitt er die Seile und Sehnen der Verteidigungsmaschinen und flüchtete aus der Burg zu den Ordensrittern, um davon zu berichten. Schon am frühen nächsten Morgen begann ein neuerlicher Ansturm auf die Mauern. Die Insassen der Burg, beraubt ihrer effizientesten Verteidigungsgeräte, mussten unter Einsatz aller Hilfsmittel den Angriff abschlagen und konnten so noch einmal einige Tage gewinnen, doch war der Durchhaltewille ernsthaft untergraben. Sie ersuchten um eine einmonatige Waffenruhe. Nach Ablauf der Frist, käme von außen keine Hilfe, würde man die Burg übergeben. Landmeister Heinrich von Plötzke bewilligte die Waffenruhe. Seine Truppen benötigten der Erholung, zumal der Winter zwischenzeitlich mit ganzer Härte hereingebrochen war. Aus der Burg wurden Boten in aller Heimlichkeit an den Hof Władysławs gesandt, um dringend Unterstützung anzufordern. Er vermochte nur wenig zu leisten und sandte mit Kastellan Andreas von Rosberg und Landrichter Michael von Sandomierz, was er an Truppen entbehren konnte, und es war wenig genug. Kaum wurden sie der Ordensritter ansichtig, zogen sie kampflos ab. Die Burg musste vereinbarungsgemäß aufgeben. Den Insassen wurde freier Abzug gewährt, darunter befanden sich die Herzöge Przemysław und Kasimir, beides Söhne Herzog Siemomysławs von Kujawien, einem Halbbruder Władysław Ellenlangs. Neben den starken Festungsalagen von Danzig, Dirschau und Schwetz, waren währenddessen von anderen Heerhaufen des Ordens weniger befestigte Orte genommen worden, so etwa Könitz, Tuchel oder Schlochau. Für die heimgesuchte Bevölkerung der erwähnten Städte kehrte jetzt nicht wie erhofft Friede unter neuen Herren ein. Schwere Steuern, Enteignung allen Besitzes, Vertreibung des polenfreundlichen Adels bis hin zur Vertreibung einer ganzen Stadtbevölkerung, wie im besonders tragischen Fall von Dirschau. Die Habe der Bewohnerschaft genügte nicht, die Schadensersatzforderungen des Ordens zu befriedigen und der Magistrat musste sich im Februar 1309 dazu verpflichten nach Pfingsten mit der gesamten Bevölkerung die Stadt zu verlassen und nie wieder zu kommen. Die ungewöhnliche Härte, mit der die Ordensherren in Pommerellen gegen Städte und Adel vorgingen, kann nicht auf Geldnot zurückgeführt werden, es scheint vielmehr, dass man grundsätzlich wenig Vertrauen in die Bewohnerschaft hatte und ganz der bisherigen Besiedlungsstrategie in Preußen, deutsche Siedler und Edelleute heranführen wollte. Das eingetriebene Geld, es können etwa 30.000 Mark Silber veranschlagt werden, sollte zur Entschädigung Władysławs aufgewendet werden. Der Orden war fest entschlossen der Besetzung Ostpommerellens, die endgültige Annexion folgen zu lassen und hierzu sollte Władysławs ausbezahlt werden, damit er auf seine Ansprüche verzichte. Ob er tatsächlich den Betrag oder Teile davon je erhielt, wissen wir nicht. Dem Orden, der bei Anwendung von Waffengewalt wenig Hemmungen bewies, war andererseits auf der staatsrechtlichen Seite desto bemühter seine Erwerbungen zu legalisieren und abzusichern. So kaufte er für tausend Mark Thorner Denare von Herzogin Salome, Mutter der oben erwähnten Kujawischen Herzöge, den sogenannten Fischwerder zwischen Nogat und Weichsel ab. Der mit viel Rücksicht ausgehandelte Vertrag, wurde im Oktober 1309 ratifiziert.
Einen Monat vorher kam es zum vielleicht wichtigsten Vergleich, nach jener mit Władysław Ellenlang. Brandenburgs Ansprüche auf Pommerellen, auch auf jene östliche Hälfte rechts und links der Weichsel, die nun fest in der Hand des Deutschen Ordens waren, blieben bislang unbefriedigt. Die Eroberung Danzigs im Vorjahr, damals noch durch die kombinierte Waffengewalt der mit Polen verbündeten Deutschritter, sowie polnischen Parteigängern aus dem Herzogtum Pommerellen, lastete auf schwer auf dem Verhältnis Brandenburgs und des Ordens. Die damals laufenden Verhandlungen zur Wahl des römisch-deutschen Königs verhinderten etwaige brandenburgische Gegenmaßnahmen. Man würde sich schon arg im seinerzeit noch lebenden, wenn auch hochbetagten Markgraf Otto IV. getäuscht haben, hätte er nicht ganz seiner Natur folgend, zu kriegerischen Maßregeln gegriffen. Die Zeit dazu war jedoch eine höchst ungünstige gewesen und die Reichsangelegenheiten fesselten in den entscheidenden Wochen des Herbst 1308 seine Aufmerksamkeit. Nun war er tot, gestorben Anfang des Jahres 1309. Aus dem Holze seines Onkels war Waldemar nicht geschnitzt, zwar ähnlich reizbar, mitunter ungestüm, doch kein Feldherrentypus, den der Ruhm des Schlachtfeldes lockte. Der kinderlose Tod seiner Halbbrüder, die ebensolche Kinderlosigkeit des verstorbenen Onkels und das vorzeitige Dahinscheiden Markgraf Hermanns, dem letzten lebenden Regenten der Ottonischen Linie, machte ihn in kurzer Zeit zum Herrn fast des gesamten brandenburgischen Territorialbesitz. Der noch lebende Halbonkel Heinrich mischte sich fast nicht ein und die Halbwaise Johann, Hermanns Sohn, war sein unmündiger Schutzbefohlener. Waldmar war als Erbe der umfangreichen Johanneischen Besitzungen und als vorläufiger Verweser der Ottonischen Ländereien seines Mündels, ohne Übertreibung der mächtigste brandenburgische Landesfürst, seit bestehen der Mark.
Der Orden ging zur Regelung dieser Frage auf den Markgrafen zu, um mit ihm über die Abtretung seiner Ansprüche und Rechte hinsichtlich des östlichen Pommerellens zu verhandeln. Bis zum 13. September 1309 zogen sich die Verhandlungen hin. An diesem Tage trat Waldemar im Beisein des Landmeisters von Preußen zu Soldin für die Kaufsumme von 10.000 Mark Silber nach brandenburgischen Gewicht, die drei Gebiete von Danzig, Dirschau und Schwetz ab. Er verpflichtete sich dem Orden die Zustimmung über diesen Verkauf von dem Fürsten von Rügen und dem Herzoge von Glogau einzuholen. Beide glaubten gleichfalls Anrechte auf diese Region zu haben. Ebenso verpflichtete sich der Markgraf dem Orden beim römisch-deutschen König Heinrich VII. die Bestätigung einzuholen. Dem Deutschen Orden blieb es überlassen die päpstliche Anerkennung zu erwirken. Der 2. Februar des Folgejahres wurde festgelegt, bis die Zustimmungen und Bestätigungen eingeholt sein sollten. Würde dies bis zum festgelegten Termin nicht erfolgen, so galt der Kaufvertrag als aufgehoben und neue Verhandlungen sollten eingeleitet werden. Tatsächlich leisteten die Herzöge Heinrich, Konrad und Boleslaus von Schlesien, Herren zu Glogau, am 8. Januar 1310 eine Verzichtserklärung auf ihre Ansprüche in besagten Gebieten zugunsten der Markgrafen Brandenburgs, ihrer Schwäger, wie es in der Urkunde hieß. Gemeint war zuvorderst Waldemars Mündel Johann, dessen älteste Schwester Mechthild mit Herzog Heinrich verheiratet war, aber wohl auch schon Waldemar, wenngleich seine Verlobung mit Agnes, die jüngere Schwester der Mechthild, noch nicht ehelich vollzogen war. Wizlaw von Rügen fehlte noch und der 2. Februar verstrich, ohne dass zu einer gleichlautenden Erklärung gekommen war. Unter Mithilfe Herzog Wartislaws von Pommern-Stettin gelang es Waldemar schließlich eine entsprechende Verzichtleistung am 12. April 1310 zu erwirken, so dass die größten Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt waren. Etwas später kommen wir darauf nochmal kurz zu sprechen.
Wenn auch der Besitz Danzigs für die weitere Entfaltung der Mark von herausragender Bedeutung gewesen wäre, so war die Rückgewinnung des Gebiets aus den Händen der kriegserprobten, gut gerüsteten und wirtschaftlich vortrefflich aufgestellten Deutschritter kaum zu erwarten. Mit dem Verkauf seiner Anrechte machte Waldemar das Beste aus einer schon verlorenen Sache. Für den Deutschen Orden kamen die Ereignisse seit Spätsommer 1308 zu einer besonders günstigen Zeit, denn an den unruhigen Ostengrenzen seines Herrschaftsgebiets, herrschte relative Ruhe. Die verfeindeten heidnischen Litauer verzichteten, bis auf einen Vorfall, auf größere Plünderzüge in die östlichen Siedlungsräume des Ordens und so konnten namhafte Teile der Ordensstreitkräfte und Mittel in Pommerellen zum Einsatz gebracht werden.

Die starke militärische Konzentration erzielte trotz verbissener Abwehr der Verteidiger, einen verhältnismäßig schnellen Erfolg, was ganz im Sinne des Hochmeisters war, der sorgenvoll den Entwicklungen im schwelenden Konflikt mit dem Rigaer Erzbistum entgegen sah, über den im vorigen Kapitel berichtet wurde. Sicherlich war es jene Auseinandersetzung mit dem dortigen Erzbischof, die im Anschluss an den Eroberungsfeldzug, den Landmeister von Preußen einen versöhnlichen Kurs einschlagen ließ, möglicherweise unter Weisung des Hochmeisters. Wer immer als treibende Kraft dahinter stand, ein einvernehmlicher Vergleich mit den gegnerischen Parteien sollte erzielt werden, ganz besonders mit dem Markgrafen Waldemar. Brandenburg konnte sich neben der Aussicht auf jene erwähnten 10.000 Mark Silber, die Burgbezirke Schlawe, Rügenwalde und Stolp sichern, womit zwar der lang ersehnte Zugang zur Ostseeküste verbunden war, jedoch ohne einen leistungsfähigen Seehafen, was den Gesamtwert der Erwerbungen erheblich schmälerte.
Gegen die Seestädte
Dem neugewählten König Heinrich VII. gelang es auffallend schnell im deutschen Reichsteil stabile Zustände herzustellen. Sein Bruder, Erzbischof Balduin von Trier, hatte im Konzert der anderen rheinischen Kurfürsten hieran den größten Anteil. Vor diesem günstigen Hintergrund schickte Heinrich sich an, auch die Situation im oberitalienischen Reichsteil zu regeln. Über die Unabhängigkeitsbestrebungen der dortigen Stadtrepubliken wurde schon in vorangehenden Kapiteln mehrmals gesprochen. Dort herrschten zu den Zeiten der späten Staufer vordergründig zwei Parteiungen. Die Ghibellinen, im Ursprung die Bezeichnung der staufischen Anhänger in Italien, in der nachstaufischen Zeit dann allgemein eine pro kaiserliche Gruppe, und die Guelfen, oder in staufischer Zeit, die Anhänger der Welfen, in der Zeit nach den Staufern allgemein hin die Parteianhänger des Papstes. Die Grenzen waren nicht scharf und es gab Dynamiken unter den jeweiligen Parteien. So musste ein guelfischer Anhänger nicht notwendigerweise ein Gegner des Kaisers sein, gleichzeitig konnte ein Ghibelline im Einklang päpstlicher Politik agieren. Die spezifischen Motivationen ergaben sich in den meisten Fällen aus den regionalen Rivalitäten der Städte untereinander. Die Macht der Städte war in den zurückliegenden 50 Jahren auch nördlich der Alpen außerordentlich gewachsen und sie strebten aus dem Griff ihrer Herren hinauszuwachsen. Es entstanden nördlich der Alpen die Freien Städte. Solche, die sich in oft langwierig und blutigen Kämpfen der Verwaltung eines Bischofs entwanden. Es folgten die Reichsstädte, die sich in gleicher Weise dem Griff eines weltlichen Landesherren entzogen. Die letzteren bildeten die große Mehrheit und waren dem Reichsoberhaupt abgabenpflichtig, der umgekehrt ihre Autonomie garantierte, so zumindest die reine Lehre. Oft war der König oder Kaiser genötigt seine Rechte in diesen Städten, oder immerhin Teile davon, aus Geldmangel oder anderen Gründen zu verpfänden. Meist an jene Gruppe, aus deren Griff die Städte sich einst befreit hatten und so gerieten sie wieder unter mittelbare oder sogar unmittelbare Kontrolle weltlicher oder geistlicher Fürsten.
Daneben gab es das Heer der abhängigen Städte, die weiterhin unter landesherrlicher Kontrolle standen und deren Magistrat abgängig von den Vorgaben eines fürstlichen Vertreters war, sei es ein Burggraf, ein Vogt oder anderer Formen hoheitlicher Verwaltung. Selbst zu klein, um aus eigenen Kräften die Autonomie zu erlangen, wurde es Mode, dass sich Städtebünde bildeten. Mitunter waren Freie Städte und Reichsstädte daran beteiligt. In den meisten Fällen waren es aber Städte eines Fürstentums oder benachbarter Regionen. Autonomiebestrebungen und Gegensatz zum Landesherren waren dabei nicht die ausschließlichen Gründe derartiger Vereinigungen. Die Landesherren hätten solche separatistischen Bewegungen sonst mit aller Entschlossenheit bekämpft und schon im Keime erstickt. Aufhänger der meisten Verbindungen waren die desolaten Zustände auf den Binnenhandelsstraßen. Wegelagerei war in manchen Regionen zu einer solchen Plage geworden, dass sich regelrechte Karawanen in den Städten sammelten und unter starker Bewachung zum Zielort reisten. Neben den räuberischen Überfällen Gesetzloser, war das ausufernde Fehdewesen mindestens ebenso abträglich für den Handel. In allen Fällen litten neben den Kaufleuten, nicht zuletzt die fürstlichen Kassen unter einem eingeschränkten Handel. Zu den ureigensten Aufgaben eines Landesherren gehörte die Wahrung der Sicherheit seiner Bewohner. Auf Raub etc., standen die schlimmsten denkbaren Strafen, doch in Ermangelung einer Exekutive, war den Zuständen auf den Straßen nicht Herr zu werden. Gelang es den oder die Übeltäter zu erwischen und durch Zeugenaussagen zu überführen, was schwer genug war, flocht man ihn auf das Rad und ließ den jämmerlich zerschmetterten Sterbenden zur Abschreckung Tage, gelegentlich Wochen hängen. Doch es half alles nichts. Die Chance gefasst zu werden, war nicht eben hoch. Die Städte schlossen sich also gegen diese Verhältnisse zusammen, bündelten damit ihre Kräfte, pflegten untereinander Beziehungen und schufen damit, wenn auch auf Umwegen, so doch als beabsichtigten oder unbeabsichtigten Nebeneffekt, ein wirksames Mittel gegen allzu herrische Landesfürsten. Die überwiegend noch jungen Städte der Mark waren, verglichen mit solchen in Schwaben, Franken, entlang des Rheins, in der Schweiz oder im Elsaß, alle mehr oder minder mit dem markgräflichen Geschlecht im Einvernehmen. Entlang der Küste sah es schon anders aus. Lübeck hatte sich längst aus dem Verband der Holsteiner Grafen entfernt, Hamburg hatte seine Emanzipation so gut wie abgeschlossen. Dem Beispiel folgend, wurden die mecklenburgischen Seestädte zunehmend renitenter und entglitten ihren Herren. Rostock war seit den Ereignissen um Nikolaus, den man das Kind nannte, formal an Dänemark gefallen, tatsächlich aber praktisch autonom, sehr zum Verdruss König Erik VI. Menveds, der nur nach einer Ursachse suchte, die rebellische Stadt zu züchtigen und zu unterwerfen. Doch nicht genug, Stralsund und Greifswald verbanden sich mit Rostock in einem Städtebund zum gegenseitigen Schutz gegen jedermann, was auch die eigenen Herren beinhaltete. Wismar, die wichtigste Stadt Heinrichs II. von Mecklenburg, verhielt sich mittlerweile offen oppositionell gegen den Landesherren. Dieser hatte seine einzige Tochter, Margarethe, mit Herzog Otto von Lüneburg, Sohn Ottos des Strengen, verlobt und wollte im März 1310 die großangelegte Hochzeit standesgemäß in seiner alten Residenzstadt abhalten. Das dortige Schloss hatte die reiche Stadt dem stets in Geldverlegenheiten befindlichen Fürsten abgekauft und zwischenzeitlich niederreißen lassen, er war als Bittsteller in seiner eigenen Stadt auf deren guten Willen und Gastfreundschaft angewiesen. Wismar verweigerte ihm tollkühn das Vorhaben und begründete es mit befürchteten Ausschreitungen, die bei einer so großen Veranstaltung kaum ausblieben und von den zahlreich anwesenden Dienstmannen der hohen Gäste heraufbeschworen würden. Wenn die Begründung grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen war, wie es zahlreiche Beispiele andernorts bewiesen, war die Verweigerungshaltung dennoch nichts weniger, als ein Affront und ein offener Bruch mit dem Landesherren. Heinrich von Mecklenburg war brüskiert worden und sann auf Vergeltung für diese Schmach, doch für den Augenblick galt es einen Ausweichort zu finden, wozu Sternberg gewählt wurde, wo Heinrich fortan auch seine Residenz hielt. Noch auf dem mehrtägigen Fest eröffnete er den anwesenden Fürsten und Rittern seinen Plan. Die rebellischen Seestädte sollten an die Kandare genommen und für ihre Aufsässigkeit gezüchtigt werden. Als wichtigsten Verbündeten gewann er den dänischen König, der schriftlich dazu eingeladen wurde. Dieser stimmte erwartungsgemäß zu, schließlich hatte er seine Rechnung mit Rostock noch nicht gemacht. Er gab dabei eine überraschende Empfehlung ab, über deren Motivation nur spekuliert werden kann. Die Unternehmung habe dann besondere Chance auf Erfolg, wenn es gelänge den brandenburgischen Markgrafen Waldemar dafür zu gewinnen. Das Verhältnis zu Dänemark war seit der brandenburgischen Strafaktion gegen Fürst Nikolaus von Rostock und der damaligen Intervention Dänemarks, stark unterkühlt. Der König wollte vermeiden, dass Brandenburg sich auf die Seite der Seestädte schlug, was keinesfalls auszuschließen war. Den Konflikt in Pommerellen hatte Waldemar mit dem Vertrag von Soldin für Brandenburg günstig zum Abschluss gebracht und mit dem Deutschen Orden einen gewogenen und militärisch potenten Nachbarn an seiner nordöstlichen Grenze gewonnen. Er hatte somit die Hände frei, Vorsicht war also geboten. Noch konnte niemand den jungen Markgrafen Waldemar einschätzen und es war vernünftig ihn einzubinden. Zu welchen Bedingungen dies möglich würde, sollte sich zeigen.
 Auf April 1310 lud Heinrich von Mecklenburg, gemeinschaftlich mit dem König von Dänemark den Markgrafen zur Unterredung nach Ribnitz ein. Ob Waldemar davon überrascht war, ob er zögerte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch schien der Ton der Einladung eine prägnante Charakterfacette des jungen Fürsten getroffen zu haben. Wir werden noch sehen was damit gemeint ist. Er ging darauf ein und war in der ersten Hälfte des April in Ribnitz zugegen, wo neben den Gastgebern Heinrich von Mecklenburg und Erik von Dänemark, Herzog Wartislaw von Pommern-Stettin, Fürst Wizlaw von Rügen, Waldemars askanischer Verwandter, Graf Albrecht von Anhalt, Graf Heinrich von Regenstein und weitere sich versammelten. Die Absicht war klar, doch nicht das eigentliche Vorgehen. Ohne triftigen Grund konnte man nicht gegen die Städte vorgehen, ohne einen Aufschrei im ganzen norddeutschen Raum, besonders unter den Städten der sich in Entfaltung befindenden Hanse. Wismar hatte seinem Landesherren bereits den notwendigen Anlass geboten, doch konnte König Erik gegen Rostock nicht vorgehen, ohne das Rostock eine ausreichenden Grund dazu bot. Bevor darauf näher eingehen, zunächst die Bedingungen Waldemars, zu denen er bereit war der Unternehmung sich anzuschließen. Sie wirft ein bezeichnendes Bild auf jene schon angedeutete charakterliche Eigenart, die mehr als alle seine anderen Wesenszüge, das Bild und die Erinnerung von ihm prägten.
Auf April 1310 lud Heinrich von Mecklenburg, gemeinschaftlich mit dem König von Dänemark den Markgrafen zur Unterredung nach Ribnitz ein. Ob Waldemar davon überrascht war, ob er zögerte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch schien der Ton der Einladung eine prägnante Charakterfacette des jungen Fürsten getroffen zu haben. Wir werden noch sehen was damit gemeint ist. Er ging darauf ein und war in der ersten Hälfte des April in Ribnitz zugegen, wo neben den Gastgebern Heinrich von Mecklenburg und Erik von Dänemark, Herzog Wartislaw von Pommern-Stettin, Fürst Wizlaw von Rügen, Waldemars askanischer Verwandter, Graf Albrecht von Anhalt, Graf Heinrich von Regenstein und weitere sich versammelten. Die Absicht war klar, doch nicht das eigentliche Vorgehen. Ohne triftigen Grund konnte man nicht gegen die Städte vorgehen, ohne einen Aufschrei im ganzen norddeutschen Raum, besonders unter den Städten der sich in Entfaltung befindenden Hanse. Wismar hatte seinem Landesherren bereits den notwendigen Anlass geboten, doch konnte König Erik gegen Rostock nicht vorgehen, ohne das Rostock eine ausreichenden Grund dazu bot. Bevor darauf näher eingehen, zunächst die Bedingungen Waldemars, zu denen er bereit war der Unternehmung sich anzuschließen. Sie wirft ein bezeichnendes Bild auf jene schon angedeutete charakterliche Eigenart, die mehr als alle seine anderen Wesenszüge, das Bild und die Erinnerung von ihm prägten.
Er wünschte von Erik zum Ritter geschlagen zu werden. Ein Wunsch, der so ganz der Mode der Zeit entsprach und für sich alleine noch keine besondere Aussage hinsichtlich Waldemars Charakter zuließe. Das Rittertum als halbsakraler Orden, war während der Kreuzzüge entstanden. Mit Beginn des 13. Jahrhunderts kam es auch im deutschen Reichsteil auf, anfangs allerdings noch selten. Ein Orden mit mit einem Ehrenkodex und äußeren Auszeichnungen, zu dem man nicht geboren wurde, obgleich eine adlige Geburt fast in allen Fällen Bedingung zum Erwerb war. Bei allen Gelegenheiten, in der Schlacht wie bei Festivitäten, erhielten die Ritter Plätze unter den Vornehmsten. Es knüpften sich hohe Vorstellungen an diese Würde. Der Ritter symbolisierte den Inbegriff aller männlichen Tugenden. Die Ritterwürde war eine höchst erstrebenswerte. Ein Heer, wie ein Hof, erhielt erst durch Ritter Glanz und Bedeutung. Selbst Fürsten drängten sich um diese Ehre, so waren die Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg, die Ahnen Waldemars, im Jahre 1231 zu Rittern geschlagen worden, und auch Graf Wilhelm von Holland ließ sich noch vor seiner Krönung zum römisch-deutschen König, in den Ritterstand erhöhen.
Doch Waldemar begehrte nicht nur für sich, sondern für weitere 99 aus seinem Gefolge, diese Würde. Ein erstes Indiz, dass Waldemar den großen Auftritt liebte und wir werden es noch in größter Deutlichkeit erfahren. Doch greifen wir den Ereignissen nicht voraus. Der dänische König war von der Bereitwilligkeit des brandenburgischen Markgrafen überrascht. Sein Wunsch schien billig, gemessen an den Diensten, die er im gemeinsamen Kampf gegen die Seestädte in Aussicht stellte. Erik wollte die Zeremonie mit allem Pomp den die Zeit ermöglichte, in angemessener Weise begehen, und hier setzte sein Plan gegen Rostock an. Als feierliche Untermalung war ein Turnier vorgesehen und dieses Ritterspiel sollte in Rostock abgehalten werden.
Turniere waren das gesellschaftliche Großereignis des Mittelalters. Die Besucher erschienen, so sie es nur irgend einrichten konnten, in ihren prachtvollsten Gewändern. Speisen und Getränke wurden im Überfluss gereicht und der im sonstigen Leben alles bestimmende religiöse Aspekt, trat anlässlich solcher oft wochenlanger Festlichkeiten, in den Hintergrund und durch den Genuss sinnlicher Reize überdeckt. Trunk, Völlerei, ausschweifende Sittenlosigkeit, waren typische Begleiterscheinungen, die sonst von der Kirche scharf sanktioniert wurden. Der anlässlich solcher Veranstaltungen betriebene Aufwand war immens, so dass es seltene Spektakel blieben, dann aber über Staatsgrenzen hinweg bekannt und zahlreich besucht wurden.
Wie erwartet, verweigerte sich Rostock dem Vorhaben des Königs. Der örtliche Rat machte die gleichen Bedenken geltend, wie zuvor Wismar anlässlich des Hochzeitsgesuchs Heinrichs von Mecklenburg. Die Ruhe und der städtische Friede würde durch die große Anzahl Ortsfremder gestört, die Natur der Veranstaltung, der exzessive Alkoholausschank, die daraus sich üblicherweise ableitenden Ausschweifungen, führten ohne Zweifel zu Reibereien, schlimmstenfalls zu Ausschreitungen und Schäden an der Stadt. Der Argumentation konnte man objektiv gesehen nicht widersprechen, allein sie war wider den Wunsch ihres Herren, und damit war die Falle zugeschnappt, ein Vorwand zur Züchtigung gefunden. Vom Turniervorhaben wollte sich der König deswegen nicht abbringen lassen, der Gedanke daran beflügelte ihn augenscheinlich, zumal es das geeignete Mittel zum Zweck war . Vor der Stadt sollte das Turnier abgehalten werden, die zahlreichen gerüsteten Besucher gleich einem Heerlager um die Stadt lagern. In dieser Zeit könnte sich leicht eine günstige Gelegenheit gefunden werden, sich der Stadt zu bemächtigen. Auf vier Wochen war es angesetzt, wozu die Sommerzeit wegen der geeigneten Temperaturen am geeignetsten erschien, da die teilnehmenden Herren vom Adel ihre Frauen mitführten und man diesen glaubte keine witterungsbedingten Strapazen zumuten zu dürfen. Zur Vorbereitung einer Veranstaltung dieser Größenordnung, war die Zeit bis zum Sommer schon zu knapp, weswegen es auf Sommer 1311 verschoben wurde. Alle Eingeweihten sollten derweil die Zeit nutzen und sich für das eigentliche Vorhaben präparieren.
Für den Moment war alles besprochen und die Versammlung der verschworenen Fürsten ging wieder auseinander. Waldemar nutzte die Gelegenheit und traf sich in Triebsees mit Wizlaw von Rügen, um von ihm die noch ausstehende Zustimmung zum Vertrag von Soldin zu erhalten. Wir erinnern uns, die Vertragsklausel sah vor, dass Waldemar bis zum Februar 1310 die Zustimmung der Herzöge von Glogau und des Fürsten von Rügen, sowie die des römisch-deutschen Reichsoberhaupts erlangen sollte. Hinsichtlich Glogaus gelang es ihm fristgerecht, doch Wizlaw von Rügen war bislang nicht zur Aufgabe seiner Ansprüche zu bewegen. Die nun gerade getroffenen Vereinbarungen wider die Seestädte schuf eine neue Verhandlungsbasis und mit Beihilfe des Herzogs von Pommern-Stettin konnte Wizlaw umgestimmt werden, trat die eigenen Ansprüche ab und gab seinen Konsens. Die Zustimmung König Heinrichs VII. erfolgte, wie wir bereits sahen, anlässlich des Hoftags zu Frankfurt im Sommer 1310.
Heinrich VII. erwirbt die Kaiserkrone
Heinrichs Wahl zum römisch-deutschen König fand im Reich großen Anklang. Doch galt es auch einige Unruheherde zu befrieden. Akut waren hier die Habsburger, die Söhne des ermordeten Königs Albrecht, welche bei der Königswahl leer ausgingen. Er suchte einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, bewies gleichzeitig aber königliche Autorität und Selbstbewusstsein. Zur Beilegung diverser Streitpunkte, besonders in Bezug einiger eidgenössischer Gebiete in der heutigen Schweiz, die sich aus dem habsburgischen Länderverband hinaus revoltiert hatten, und deren Reichsunmittelbarkeit der neue König anerkannte, bot er zum Ausgleich die verwaiste Markgrafschaft Mähren als Pfandbesitz an. Aus den innerfamiliären Streitigkeiten der Wettiner, hielt er sich heraus und macht keine Ansprüche auf die Landgrafschaft Thüringen und Markgrafschaft Meißen geltend, wie es die Vorgänger erfolglos versuchten. Adolf von Nassau wurde seine damalige Intervention zum Verhängnis, er wurde abgesetzt, ein Novum in der bisherigen Reichsgeschichte. Heinrichs unmittelbarer Vorgänger, Albrecht von Habsburg, erlitt in der Schlacht bei Lucka am 31. Mai 1307 eine verheerende Niederlage und zog sich danach überwiegend in die habsburgischen Stammgebiete nach Südwestdeutschland zurück, wo er 1308 ermordet wurde. Wenn auch der Norden, Nordosten und Osten des deutschen Reichsteils, wie schon seit Generationen königsfern blieb, so kamen von dort dennoch keine Stimmen. Das seit 1306 existierende Machtvakuum in Böhmen hatte daran einigen Anteil. Nach dem Tod Wenzels III., dem letzten männlichen Přemysliden, vermochten weder die Habsburger, noch die Meinhardinger aus Kärnten in Böhmen Fuß zu fassen, die dortigen Stände für sich zu gewinnen, das Land zu befrieden und zu unterwerfen. Vertreter der böhmischen Stände traten an Heinrich heran, um sich er beklagenswerten Zustände in Böhmen anzunehmen. Im Sommer 1310 wurden die böhmischen Hilferufe und gleichzeitigen Offerten so konkret, dass Heinrich die Krone des Landes ans Haus Luxemburg zu bringen gedachte. Im Juli wurde Herzog Heinrich von Kärnten offiziell des Anrechts auf Böhmen für verlustig erklärt. Heinrich schlug zunächst seinen jüngeren Bruder Walram vor, der aber unter den böhmischen Gesandten auf Ablehnung stieß. Schließlich fiel die Entscheidung auf Johann, Heinrichs 1296 geborenen Sohn.

Am 30. August fand in Speyer die feierliche Belehnung Johanns mit Böhmen statt. Zur dynastischen Festigung der Belehnungsaktes, wurde ihm noch am gleichen Tag Prinzessin Elisabeth von Böhmen angetraut, die Schwester des verstorbenen Wenzels III., der letzten Přemyslidin. Aus dem Stand schlossen die Luxemburger mit dem Erwerb Böhmens zu den mächtigsten Dynastien im Reich auf. Am 7. Februar 1311 erfolgte durch den Erzbischof von Mainz die Krönung Johanns in Prag. Ganz so leicht wie es hier Eindruck vermittelte, verlief es für den jungen König derweil nicht. In Böhmen gab es weiterhin eine starke Partei des Herzog Heinrich von Kärnten. Johann musste mit einem Heer nach Böhmen ziehen und vermochte vorerst die Hochburgen seines Gegners nicht einzunehmen, doch wollen wir es hier auf sich beruhen lassen und kehren zu Johanns Vater zurück, dem römisch-deutschen König.

Dieser war zeitgleich an der Spitze eines 5.000 Mann starken Heers, nach Italien aufgebrochen, um dort die Verhältnisse zu regeln und die Kaiserkrone zu erwerben. Die größtenteils ruhigen Verhältnisse im deutschen Reichsteil ermöglichten diesen erstaunlich frühen Italienzug, was fünf seiner direkten Vorgänger nicht vermochten. Dem Unterfangen gingen mehrere sorgsam vorbereitete diplomatische Gesandtschaften zu Papst Clemens V. nach Avignon, wie auch nach Reichsitalien voraus, um sein Vorhaben anzuzeigen und die Parteiungen auszuloten.
Heinrich VII. hatte seit seinem Regierungsantritt nicht nur alte Rechte an der erodierenden Westgrenze des Reichs geltend gemacht und löste dadurch am französischen Hof Missfallen aus, er wollte ebenso wieder das dem Reich stark entfremdete Oberitalien fester einbinden, worunter sein bisheriges gutes Einvernehmen zum Papst litt. Aus dem sächsischen Raum schloss sich keiner der bedeutenden Territorialfürsten dem Italienzug an, wenngleich einige bei den vorbereitenden Hoftagen zugegen waren, so Markgraf Waldemar im Juli 1310 zu Frankfurt. Wie berichtet, holte er damals die königliche Zustimmung zur Abtretung seiner Rechte an Danzig, Dirschau und Schwedt ein, trat aber sonst nicht weiter in Erscheinung.
Heinrich war nach mehr als einem halben Jahrhundert, der erste römisch-deutsche Herrscher, der italienischen Boden betrat. Seine Ankunft war selbst von ansonsten oppositionellen guelfischen Gruppen mit Hoffnungen verknüpft, während die prokaiserlichen Ghibellinen ohnehin die größten Erwartungen hatten und fest mit einer klaren Parteinahme zu ihren Gunsten rechneten. Die Guelfen hatten sich in der langen königsfernen Zeit in weiße -, sogenannte Bianchi und schwarze Guelfen, Negri, geteilt. Besonders im traditionell antikaiserlichen, guelfischen Florenz, war die Aufspaltung besonders ausgeprägt. Der wohl berühmteste Bianchi, Dante Alighieri, eigentlich vom familiären Hintergrund eher ein Negri, drückte in einigen seiner Briefe Hoffnung und unverhohlene Sympathie für das Kaisertum und Heinrich VII. aus, wofür er in Florenz zum Staatsfeind erklärt und verbannt wurde. Auf diesem immerhin günstigen Nährboden, kam der römisch-deutsche König in Oberitalien an. Er nahm untypischerweise den Weg über den Mont Cenis, statt wie die meisten seiner Vorgänger, den Weg über Innsbruck, Bozen, Trient. Hauptgrund war die Zusammensetzung seines Gefolges, dass sich zum größeren Teil aus dem romanischen und somit westlichen Reichsteil rekrutierte. Heinrich hatte die ernsthafte Absicht, in den Streitigkeiten der Ghibellinen und Guelfen, sowie der guelfischen Parteiungen der Bianchi und Negri, als neutraler Vermittler aufzutreten. Seinem ehrenwerten Anliegen, stand die höchst verworrene politische Lage in Oberitalien entgegen, wo sich neben dem Papst, auch der französische König und der französisch verwandte unteritalienische Hof der Anjou in Neapel, mit aller Macht einmischten. Eine Zerreissprobe zwischen lange brach gelegener imperialer Wunschpolitik und machbarer Realpolitik. In Italien hielt Heinrich sich zunächst in Savoyen, vor allem in Turin auf, dem Herrschaftsbereich seines Schwagers Amadeus V., der als lavierender Vasall, seit Heinrichs Wahl wieder auf die Reichslinie eingeschwenkt war. Er setzte zur Ausübung einer reichsnahen Zentralpolitik Vikare ein, die sich in die Belange der Kommunen einmischten und deren gewohnte Unabhängigkeit und Rechte beschnitten, was schnell Unruhen führte, geschürt von verschiedenen oppositionellen Adelsfamilien, wie den della Torre in Mailand. Die alten guelfischen Bündnisse nahmen wieder Gestalt an, Mailand, Florenz und Bologna an der Spitze, gefolgt von Parma, Reggio, selbst Pavia und anderen. Kaiserliches Zentrum in Oberitalien war das ghibellinische Pisa. Nach offen ausgebrochenen Feindseligkeiten, die Heinrich mit seinem zu geringen militärischen Gefolge nicht für sich entscheiden konnte, fällte er den Entschluss vorerst die Kaiserwürde in Rom zu erlangen. Zu groß war die Gefahr, dass der Papst, der mehr und mehr unter die Kontrolle Philipps VI. von Frankreich geriet, seine Zustimmung zurückzog. Papst Clemens V., der wie wir wissen in Avignon und nicht in Rom residierte, beauftrage drei Kardinäle an seiner statt die Krönung vorzunehmen. Mai 1312 stand Heinrich vor den Toren Roms. Dort hatte sich der Widerstand gegen ihn aufgebaut. Unterstützt wurden die guelfischen Rebellen von neapolitanischen Truppen des Roberts von Anjou. Selbst nach wochenlangen Versuchen und blutigen Straßenkämpfen, vermochten Heinrichs Anhänger nicht den Zugang zu Sankt Peter zu erzwingen, weswegen der Lateran als Ausweichort gewählt wurde.
 Hier fand am 29. Juni 1312 in der Lateranbasilika Heinrichs Krönung zum Kaiser statt. Fast hundert Jahre, seit 1220, war es niemandem mehr gelungen, die höchste weltliche Würde zu erlangen. Im Anbetracht der geringen Truppenstärke, mit der Heinrich vor fast zwei Jahren nach Italien gezogen war, und vor dem Hintergrund der sich seither zuspitzenden Verhältnisse in Oberitalien, war dies eine beachtenswerte Leistung. Der frischgekrönte Kaiser knüpfte, trotz der sehr langen kaiserlosen Zeit, fast nahtlos an die universalen Machtansprüche der Staufer an. Spätestens jetzt rückte der Papst von ihm ab und unterstützte offen den Anjou in Neapel, den er als letzte Widerstandspartei in Italien sah, vor allem seit Heinrich VII. sich im Kampf gegen Robert von Anjou eng mit dem aragonesischen König von Sizilien, Friedrich II., verband. Clemens V. drohte von Avignon aus mit der Kirchenacht, sollte gegen Robert militärisch vorgegangen werden. Heinrich ließ sich davon nicht schrecken und vereinbarte mit Sizilien und seinen oberitalienischen Parteigängern, darunter wieder besonders Pisa, ein kombiniertes Vorgehen zu Wasser und zu Land. Aus dem Reich sollte Heinrichs Bruder Balduin von Trier Verstärkung heranführen. Anfang August begab sich der Kaiser an der Spitze von 4.000 gepanzerten Reitern nach Süden, während die Flotten von Pisa und Sizilien sich auf eine Seeblockade Neapels vorbereiteten.
Hier fand am 29. Juni 1312 in der Lateranbasilika Heinrichs Krönung zum Kaiser statt. Fast hundert Jahre, seit 1220, war es niemandem mehr gelungen, die höchste weltliche Würde zu erlangen. Im Anbetracht der geringen Truppenstärke, mit der Heinrich vor fast zwei Jahren nach Italien gezogen war, und vor dem Hintergrund der sich seither zuspitzenden Verhältnisse in Oberitalien, war dies eine beachtenswerte Leistung. Der frischgekrönte Kaiser knüpfte, trotz der sehr langen kaiserlosen Zeit, fast nahtlos an die universalen Machtansprüche der Staufer an. Spätestens jetzt rückte der Papst von ihm ab und unterstützte offen den Anjou in Neapel, den er als letzte Widerstandspartei in Italien sah, vor allem seit Heinrich VII. sich im Kampf gegen Robert von Anjou eng mit dem aragonesischen König von Sizilien, Friedrich II., verband. Clemens V. drohte von Avignon aus mit der Kirchenacht, sollte gegen Robert militärisch vorgegangen werden. Heinrich ließ sich davon nicht schrecken und vereinbarte mit Sizilien und seinen oberitalienischen Parteigängern, darunter wieder besonders Pisa, ein kombiniertes Vorgehen zu Wasser und zu Land. Aus dem Reich sollte Heinrichs Bruder Balduin von Trier Verstärkung heranführen. Anfang August begab sich der Kaiser an der Spitze von 4.000 gepanzerten Reitern nach Süden, während die Flotten von Pisa und Sizilien sich auf eine Seeblockade Neapels vorbereiteten.

Heinrich hatte sich während seines Aufenthalts in Italien mit der Malaria infiziert. Wiederholte schwere Fieberschübe plagten ihn im Sommer 1313, die ihn erheblich schwächten. Am 24. August 1313 stirbt der Kaiser im Feldlager bei Buonconvento an den Folgen eines erneuten Malariaschubs. Seine Leiche wurde ins reichstreue Pisa überführt, wo er im dortigen Dom prächtig beigesetzt wurde. Das Reich hatte für nur 5 Jahre einen fast durchweg anerkannten König und nur ein Jahr einen Kaiser. In diesem einen Jahr gelang es Heinrich nicht, seinen Sohn Johann als König und Mitregent bei den Kurfürsten durchzusetzen. Das Reich drohte wieder in einen unruhigen Dornröschenschlaf zu fallen. Die großen Erwartungen, die seit den vielversprechenden Aktivitäten Heinrichs in deutschen Reichsteil und unter den kaiserlichen Anhängern in Reichsitalien existierten, brachen in sich zusammen.
Turnier zu Rostock und Ritterschlag
Kehren wir in den norddeutschen Raum und das Jahr 1311 zurück. Der römisch-deutsche König befand sich seit dem Herbst des Vorjahres in Oberitalien, wo er zwischen den Parteien der Ghibellinen und Guelfen zu vermitteln versuchte. Gleichzeitig wollte er seinen Herrschaftsanspruch auf Reichsitalien geltend machen. Im Reich war, abgesehen vom niederschwäbischen Raum, wo Graf Eberhard von Württemberg seit langem eine aggressive Expansionspolitik betrieb, und er im Krieg mit einem schwäbischen Städtebund lag, die Lage größtenteils stabil. Gegen besagten Graf wurde im Frühjahr 1311 der Reichskrieg ausgesprochen. Mit der Exekution wurde Konrad IV. von Weinsberg beauftragt, der als königlicher Landvogt für Niederschwaben von Heinrich VII. eingesetzt war.
In der Mark hatte sich seit dem Vertrag von Soldin September 1309 mit dem Deutschen Orden, und den Vereinbarungen im April 1310 zu Ribnitz, im Zusammenhang mit der geplanten Züchtigung der Seestädte Mecklenburgs, nicht viel bedeutsames getan. Es liegen eine Reihe von Urkunden vor, die von üblichen Tätigkeiten im Rahmen landesherrlicher Administration zeugen. So werden neben Schenkungen an geistliche Institutionen, wirtschaftliche Aspekte in den Städten geregelt. Beispielsweise ordnete er am 15. März 1311 für die Stadt Löbau an, dass die dortigen Wirte nicht mehr als vier Wagen pro Nacht einquartieren durften, um damit den anderen Gastwirten der Stadt keinen wirtschaftlichen Abbruch zu tun. Ähnliche Regelungen sahen wir schon bei Großvater Johann I. Die Markgrafen, überhaupt die Landesherren im Mittelalter, griffen durch Maßregeln aktiv in die Wirtschaftskreisläufe ein. Es folgte dem landesväterlichen Wunsch, wonach möglichst breite Schichten einer jeweiligen Zunft, einträgliche Einkünfte erhielten und so ein Auskommen hatten, von dem sie und die Familie leben konnten. Fatalerweise gingen dergleichen, grundlegend gutgemeinten Anordnungen, fast immer mit Preisabsprachen einher, so dass alles wieder seine Kehrseite hatte.
Im Zusammenhang mit Markgraf Heinrich, dem Halbonkel Waldemars, den wir nicht vergessen wollen, ergaben sich in seiner Mark Landsberg, die er regierte, einige erwähnenswerte Ereignisse, über die jedoch erst in einem späteren Kapitel gesprochen werden soll.
Pfingsten 1311, es war der 30. Mai., verbrachte Markgraf Waldemar in Tangermünde. Wir glauben aus dem überlieferten Urkundenbericht die offizielle Vermählung Waldemars mit seiner Verlobten Agnes herleiten zu können. Der Kontext lässt auf kein anderes Ereignisse schließen. Herzogin Anna von Breslau, die Mutter der Braut, war eigens aus Schlesien angereist. Für den Tag sind außergewöhnlich große Schenkungen zu Gunsten des Klosters Campen urkundlich belegt. Sowohl Markgraf Waldemar, als auch die Brautmutter, waren die Schenkenden. Akte solcher Generösität die, nur am Rande erwähnt, nicht dem Naturell Waldemars entsprachen, lassen auf ein besonders freudiges Ereignis schließen. Berücksichtigt man ferner, dass schon die Verlobung in Tangermünde gefeiert wurde, dass die junge Braut im unweit gelegenen Arneburg, einem der ehemaligen Witwensitze der vormaligen Markgräfin Anna, Jahre ihrer Jugend verbrachte, womöglich auch seit der Verlobung weiterhin verweilte, es sonst keinerlei sinnvolle Erklärung gibt, weswegen die Herzogin die beschwerliche Reise an die Elbe angetreten haben könnte, noch dazu bei den schon erwähnten schlechten Wetterverhältnissen, bleibt nur der Schluss, dass ein wichtiges Familienereignis stattgefunden haben musste. Waldemar war jetzt etwa 20 Jahre alt, seine Gattin 14.
Das einprägsamste Ereignis des Jahres 1311, zumindest für den norddeutschen Raum, blieb das von König Erik VI. von Dänemark geplante Turnier vor den Toren Rostocks. Jener Erik Menved war über seiner Mutter Agnes von Brandenburg, eine Tochter Markgraf Johanns I. und dessen zweiter Frau Jutta von Sachsen, mit den brandenburgischen Askaniern verwandt. So war Markgraf Heinrich ein Onkel des Königs.
Um ein Gefühl des gesellschaftlichen Stellenwerts dieses Turnier zu bekommen, anbei ein Blick auf den Teilnehmerkreis: Neben dem königlichen Gastgeber und Waldemar von Brandenburg, nahmen Herzog Otto von Lüneburg, Herzog Waldemar von Schleswig, Heinrich von Mecklenburg, die Herren Günther und Henning von Werle, Pribislaw von Wollin, ferner weitere Herzöge, Fürsten, zahlreiche Grafen und Herren aus Polen, Braunschweig, Thüringen, Meißen, Sachsen-Lauenburg, Hessen, Brandenburg, Mecklenburg, Wenden, Engern, Kleve, Friesland, Holstein, Schwerin und Sachsen-Wittenberg teil. Selbst aus Franken, Schwaben und Bayern kamen Teilnehmer und Gäste. Zum Kreise der weltlichen Fürsten gesellte sich eine große Zahl geistiger Würdenträger, darunter die Erzbischöfe von Magdeburg, Bremen und Lund, die Bischöfe von Hildesheim, Halberstadt, Cammin, Schleswig, Lübeck, Brandenburg, Havelberg, Schwerin, Ratzeburg, Roskilde, Odense und Abo, dazu eine Anzahl Domherren, Mönche sowie ungezählte Hofkaplane anwesender Fürsten. Einzelne hohe Heeren kamen teilweise mit bis zu 300 gerüsteten Begleitern. Alles in allem waren rund 6.400 registrierte Besucher und Teilnehmer zugegen, dazu eine unbekannte Zahl Schaulustiger aus der näheren und ferneren Umgebung, die tageweise anreisten. Menschen und ihre Tiere waren Gast des dänischen Königs und mussten verköstigt werden. Der König musst sich das alles einiges Kosten lassen. Das Jahr 1311 sah einen ungewöhnlich regenreichen, dazu kühlen Frühling, was sich auch durch den Sommer zog, wodurch unter anderem die Getreideernte einbrach. Es war ein Vorbote auf ein sich damals drastisch veränderndes Klima, das gut drei Jahrzehnte in wechselvoller Weise anhielt. In Erwartung eines erheblichen Ernteausfalls, zogen noch im gleichen Jahr die Getreidepreise an, eine allgemeine Teuerung setzte ein.
Eine Veranstaltung dieser Größenordnung, besonders wenn der Gastgeber und Schirmherr von hohem, sogar königlichem Rang war, gab Gelegenheit zu einem weiteren Schauspiel, das bis in höchste Fürstenkreise gesellschaftliches Gewicht hatte. Wir erwähnten es schon, die Erlangung der Ritterwürde. Die einstmalige Schwertleite, sowohl im deutschen Reichsteil, als in anderen germanisch geprägten Landschaften Europas seit Alters her bekannt, war sukzessiv durch dieses erhabenere, sakralere Ritual ersetzt worden. Die Ritterwürde wurde für jeden jungen Herren aus adligem Hause in hohem Maße zur standesgemäßen Konvention. Waldemar lag nicht nur viel an der Sache als solches, ein großartiger, besonders prunkvoller Rahmen spielte für ihn eine nicht minder wichtige Rolle.
Man mag sich vielleicht fragen, warum Waldemar hierzu den dänischen König auswählte, statt des römisch-deutschen Königs? Wäre es einem hohen Reichsfürsten nicht gut zu Gesichte gestanden, diese Ehre von seinem Lehnsherren zu empfangen, denn von einem reichsfremden König? Eine Reihe Gründe können angeführt werden. Zunächst ergriff Waldemar zu Ribnitz April 1310 einfach die Gunst der Stunde, unterbreitete dem dänischen König seine Bedingungen für eine Teilnahme an der Strafaktion gegen die Seestädte und erhielt ohne Weiteres dessen freudige Zusage. Der ursprünglich niedrige Rang Heinrichs VII. spielte eine wichtige Rolle. Wenn er auch aus reichsunmittelbarem Adel stammte, war er vor der Erhebung zum König, doch nur ein einfacher Graf an der westlichen Peripherie des Reichs, schon mehr französisch als deutsch. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an König Ottokar II. von Böhmen, der nach der Wahl des habsburgischen Grafen Rudolf zum Reichsoberhaupt, diesen als nicht gleichwertig betrachtete. Heinrich VII. war durch seine Wahl zum König zwar Waldemars Haupt geworden, doch von Geburt niedrigeren Ranges, als der Markgraf. Erik VI. von Dänemark dagegen, als Sohn eines Königs, war hohen Ranges von Geburt. Ausschlaggebend dürfte letztlich Waldemars geäußerter Wunsch gewesen sein, wonach 99 seiner Vasallen mit ihm in den Ritterstand erhoben werden sollten. Schwerlich wäre vom römisch-deutschen König eine solche Gefälligkeit zu erlangen gewesen, keinesfalls ohne dass er Bedingungen gestellt hätte, die zu dieser Zeit wohl kaum anders lauten konnten, als sich mit einem starken brandenburgischen Kontingent seinem Italienzug anzuschließen. Ein Unterfangen, an dem sich seit vielen Generationen kein Askanier mehr beteiligte. Die großen sächsischen Territorialfürsten begnügten sich in Reichsangelegenheiten seit langem darauf, von der Außenpolitik des Königs oder Kaisers möglichst fern zu bleiben. Waldemar verfolgte mit seiner Forderung 99 Mannen aus seinem Gefolge zu erhöhen, eine Doppelstrategie. Erstens suchte er damit jene ritterlichen Vasallen, größtenteils aus dem märkischen Adel stammend, ans brandenburgische Haus zu binden. Das mittelalterliche Feudalsystems als Herrschaftsinstrument, beruhte vor allem auf einem funktionalen Personenverband, daran hatte sich auch im Spätmittelalter wenig verändert. Die möglichst enge Bindung der Vasallen ans Herrscherhaus war eine Grundbedingung. Als zweiten Motivationsgrund kann Waldemars Hang nach glamourösen Auftritten und pompösen Zeremonien erwähnt werden. Am Hofe seines Onkels Otto IV. aufgewachsen, wo Minnesänger verkehrten und von den großen Taten und dem Glanz der europäischen Höfe in ihren Erzählungen und Lichtern berichteten, war er von Kindesbeinen an, vorbelastet, weswegen zur effektiven Machtentfaltung eines Landesherren, ein prächtiger Habitus gehörte. Er wollte, dass man von ihm ihm sprach und wo hatte man je davon gehört, dass einem Landesfürsten in seinem Beisein und zu seinen Ehren, derart viele seiner Edlen zu Rittern gemacht wurden? Es war im Reich einmalig und trieb Waldemars Prestige in die Höhe, was ganz nach seinem Geschmack war. In Sachen Prunk und Pracht standen sich Erik und Waldemar übrigens in nichts nach.

Gehen wir nun näher auf den festlichen Akt ein, dem Waldemar so ungeduldig entgegenfieberte, der sehnlichst herbeigewünschte Ritterschlag. Heinrich von Meißen, ein schon zu Lebzeiten im gesamten Reich und über dessen Grenzen hinaus populärer Minnesänger, besser bekannt unter seinem Beinamen Frauenlob, war Zeuge des Turniers und widmete Waldemar eine poetische Schilderung der Zeremonie. Von ihm haben wir auch das Zeugnis, dass der Rostocker Fürstentag und das Turnier, alles an Pracht und Größe übertraf, was bislang aus den süddeutschen Landen bekannt war. Wenn man berücksichtigt, dass Heinrich von Meißen ebenso am Königshofe Rudolfs I. von Habsburg verkehrte, wie am Hofe des böhmischen Königs Wenzel II., darf man zurecht sagen, dass sein Urteil ein sachverständiges Gewicht hat.
Am Vorabend der Zeremonie sandte König Erik an die vornehmsten der Kandidaten als Geschenke einen scharlachroten Mantel, einen Überrock und Rock, alles reich gefüttert mit Grauwerk (Pelzen), einen aufgezäumten dänischen Zelter (ruhiges, leichtes Reitpferd) sowie ein Schild und ein Schwert. Am folgenden Morgen, nach einer gemeinsamen Messe, empfing der König in einem großen Zelt, auf einem prachtvoll geschmückten Throne sitzend, die Ehrengäste denen dieser Akt galt. Im davorliegenden Lager waren alle Gruppierungen der verschiedenen Kandidaten versammelt. Waldemar ritt, begleitet mit Bannern und Fahnen, gefolgt von 19 hohen Herren und 80 Mannen, ohne die Bediensteten, in die reiche Gewänder vom Vorabend gekleidet, aus seinem Teil des Lagers vor den königlichen Thron. Laut schmetternde Musik begleitete seinen Weg. Alle folgten mit großem Jubel dem Spektakel und ein ständiges Jauchzen und Frohlocken ging durch die Reihen. Es gehörte zur guten Sitte, anlässlich eines solchen Rahmens, die innere Lust laut auszudrücken. Ein Gastgeber wäre gekränkt gewesen, hätten seine Gäste ihrer Freude nicht sichtbar und hörbar Ausdruck verliehen. Als der Zug sich dem Zelt genähert hatte, saß der Markgraf von seinem Pferd ab und alle Herren und Mannen seines brandenburgischen Anhangs beugten mit großer Ehrfurcht ihr Knie vor dem König. Sodann schritt Waldemar vor den König und empfing nach der überlieferten Weise durch den König den Ritterschlag mit dem Schwert. Als sichtbares Zeichen und Beweis dieses vollzogenen Aktes, wurde ihm der ritterliche Gürtel und die goldenen Sporen angelegt. Ihm folgten seine 99 Begleiter ihrem Rang nach.
Nach dieser lang andauernden Zeremonie, ging es an die überreich gedeckte Tafel. Aufgrund der Größe und der Entfernungen, wurden die Speisen mit Pferden gebracht, die hierzu eigens in Decken gehüllt wurden. Der Nachmittag wurde mit Tanz und dem Spiel der zahlreich anwesenden Gaukler verbracht. An den folgenden beiden Tagen folgten die Turnierkämpfe. Lanzenreiten, Schwertkampf, Kampf mit dem Streitkolben. Besonders die neuen Ritter wollten ihre Waffengeschicklichkeit unter Beweis stellen. Reine Schaukämpfe waren Turniere nie, es kam immer wieder zu allerlei Verletzungen, darunter sehr schwere, und kaum ein Turnier, wo es nicht auch zu manchen Todesfällen kam. Auch nach den Turniertagen wurden weitere Mannen zu Rittern geschlagen. Insgesamt sollen in den vier Wochen unaufhörlicher Festlichkeiten, 859 edle Herren in den begehrten Stand gehoben worden sein, eine enorme Zahl. Noch am Abschlusstag erhielt Günther von Werle, einer der Verschworenen von Ribnitz, als letzter die Ritterwürde verliehen.
Das Turnier hatte, wie wir wissen, seinen besonderen Grund. Die versammelten Fürsten, jene die sich zur Züchtigung der Seestädte verschworen, nutzten die Zeit um ein koordiniertes Vorgehen abzustimmen. Den miteinander verbündeten Seestädten blieben die April 1310 getroffenen Absichten ihrer Widersacher nicht verborgen. Die Vorbereitungen der Fürsten waren nicht zu verheimlichen, umherziehende Kaufleute trugen Nachrichten darüber an die Magistrate heran, die über eigene Maßnahmen berieten und sich noch fester miteinander vereinten. Nach Abschluss der Festivitäten, zog Heinrich von Mecklenburg, der Löwe genannt, mit einem starken Aufgebot eigener und verbündeter Truppen vor Wismar, um die Stadt zu unterwerfen. Waldemar schien bald danach, unter Zurücklassung von Hilfstruppen, in die Mark abgezogen zu sein, denn wir sehen ihn am 16. Juli zu Werbellin urkunden.
Am 7. Juli begann die Belagerung Wismars von der Landseite. Hierzu ließ Heinrich zwei Belagerungstürme errichten. Der dänische König blockierte gleichzeitig mit seinen Schiffen von der Seeseite den Zugang zur Stadt. Ringsherum wurden die Felder verwüstet und das umliegende Land geplündert. Wismars Bürger wehrten sich mit Geschick und schlugen einen Großangriff blutig zurück. Währenddessen hatten sich die vereinten Flotten Wismars, Greifswalds, Stralsunds und Rostocks gegen die dänische Blockadeflotte gestemmt, die der gegnerischen Übermacht weichen mussten und die Flucht auf die offene See antrat. Das nun über den Seeweg offene Wismar, wurde von den Verbündeten verstärkt und trat zum Gegenangriff an, indem es einen Ausfall wagte, der allerdings zu einer schweren Niederlage, mit vielen Verlusten führte. Die Angreifer gerieten von zwei Seiten in die Zange einer Übermacht der Belagerer. Der Mut der Bürger begann zu sinken. Sie befürchteten aus Rostock, das bislang noch nicht belagert wurde, keine Hilfe mehr erwarten zu können, seit König Erik von Warnemünde aus heftige Drohungen gegen Rostock aussprach, sollte von dort weiter Beistand erfolgen. Rostock weigerte sich auf die Drohungen einzugehen und setzte seine Unterstützung gemäß den Bündnisverpflichtungen fort, worauf nun auch gegen diese Stadt militärisch vorgegangen wurde. Derweil war der Herbst hereingebrochen. In Wismar machte sich die Versorgungslage negativ bemerkbar, doch auch die Belagerer litten Mangel. Die Ernte war in fast ganz Deutschland und weiten Teilen Europas katastrophal ausgefallen, so dass sich die Preise für Getreide von einem Hoch, zum nächsten schwangen. Mit herannahendem Winter waren Belagerer wie Belagerte bereit Verhandlungen zu beginnen, die am 15. Dezember zum Abschluss kamen. Heinrich von Mecklenburg schien erleichtert überhaupt zum Abschluss gekommen zu sein und stellte keine unannehmbaren Forderungen und Wismar, von der Belagerung ausgezehrt, nahm an.
Nun wandte sich Heinrich, als Teil seiner Zusagen gegenüber dem dänischen König, gegen Rostock, und ließ bei Warnemünde, beiderseits der Warnowmündung, zwei große Holztürme errichten, wodurch der landeinwärts gelegenen Stadt der freie Zugang zur Ostsee blockiert wurde. Große Bestürzung und Wut machte sich unter den Bürgern breit, die vor das Haus des Herren Nikolaus von Rostock zogen, ihrem vormaligen Herren. Dieser wohnte als eine Art Privatier unter ihnen, seit er sich im Kampf gegen die brandenburgischen Markgrafen und Heinrich von Mecklenburg genötigt sah, um die eigene Haut zu retten, seine Herrschaftsrechte an König Erik VI. abzutreten und dessen Lehnsmann wurde. Aus dieser Zeit stammt des dänischen Königs Anspruch auf Rostock und Umland. Die aufgebrachten Bürger führten den Verschreckten ins Rathaus, wo die Ratsleute gezwungen seinen dort gelagerten Treuebrief an Erik von Dänemark exemplarisch zu zerreißen. Der unmissverständliche Bruch mit Erik VI. war vollzogen, offener Krieg erklärt. Als erstes zog eine stark bewaffnete Bürgerwehr beiderseits der Warnow nach Norden zur Küste, um die zwei dort errichteten Türme niederzubrennen. Den einen mitsamt der Besatzung, den anderen, nachdem die Insassen die Flucht ergriffen hatten. Der hereingebrochene Winter verhinderte eine Gegenreaktion Heinrichs und Eriks und so nutzten die Rostocker die Gelegenheit, um bei Warnemünde eine Festung zu errichten. Um den Mangel an Steinen zu kompensieren, rissen sie sogar den Turm ihrer Petrikirche nieder und schafften das hieraus gewonnene Baumaterial an die Mündung der Warnow. Wiederholte Überfälle ins Land Heinrichs, sowie zur See, gegen Dänemark, beispiesweise gegen die Insel Falster, bestimmten den Winter 1311/12.
Die Situation entwickelte sich ganz anders, als König Erik und Herr Heinrich von Mecklenburg dies erwartet, geschweige denn geplant hatten. Am 18. Februar 1312 kam es zu Zehdenick in der Mark zu einem Anschlussvertrag zwischen Markgraf Waldemar, der immer auch im Namen seines Mündels Johann entschied, und Heinrich von Mecklenburg, sowie in gleicher Weise mit Erik VI., wonach Waldemar 400 Mann Kriegsvolk auf eigene Kosten ausrüsten sollte. Für die Zeit nach Pfingsten, sobald üblicherweise die Schönwetterphase begann, war ein gemeinsamer Generalangriff auf Rostock geplant. Bis dahin waren es noch einige Monate und die Schiffe der vereinten Seestädte suchten die Küsten Dänemarks wiederholt und in verheerender Weise heim. Bis nach Helsingør (deutsch Helsingör) wagten sie sich vor, plünderten und brannten dabei sogar Burgen und Schlösser nieder. Auf dänische Schiffe wurde Jagd gemacht wo man sie fand und der dänische Handel erlitt in dieser Zeit schwere Einbußen. König Erik musste fast tatenlos dem Treiben seiner Feinde zusehen, denn er war auf das gemeinsame Vorgehen seiner Verbündeten von Süden her angewiesen.
Am 23. Juni landete er schließlich mit großer Heeresmacht unweit Warnemünde, wo er das dortige, im Winter von den Rostockern errichtete Bollwerk belagern ließ. Die Insassen verteidigten sich verbissen. Waldemar sandte das brandenburgische Kontingent Anfang Juli los, unter welcher Führung ist ungewiss, er jedenfalls befand sich zu dieser Zeit weiterhin in der Mark, kam dann jedoch in Begleitung des heranwachsenden Johann nach und war während der heftigen Angriffe auf die Festungsanlage vor Ort. Volle elf Wochen hielten die Belagerer unter dem Kommando des Rostocker Ratsherren Bernhard von Baggeln stand, bevor der Hunger sie zur Aufgabe zwang. Es wurden ihnen freier Abzug gewährt. Zuvor unternahmen die Rostocker mehrere, teils spektakuläre Versuche, die Eingeschlossenen mit Nahrung zu versorgen, doch fielen die Versorgungsschiffe den Belagerern in die Hände. Statt die eingenommene Festung niederzureißen, wurde sie als eigene Basis erheblich ausgebaut und verstärkt. Die Besatzung der Burg wurde nach einem festgesetzten Reglement von je einer Gruppe aus den Reihen der Verbündeten übernommen. So zur See hin abgesichert, zogen die Verbündeten vor Rostock und begannen die Belagerung. Der Sommer war inzwischen vorbei, alle Angriffsstöße gegen die Stadt bislang abgeschlagen und mit wütenden Ausfällen der Besatzung beantwortet worden. Die Einnahme der Stadt schien unabsehbar, doch rumorte es hinter den Mauern, wo der Rat gewillt war Verhandlungen aufzunehmen, während ein großer Teil der Bürgerschaft dies mit Vehemenz ablehnte. Die städtischen Kaufleute, aus ihren Reihen rekrutierte sich der Magistrat, litten unter der Blockade. Ihr Reichtum schmolz mit jeder weiteren Woche dahin. Gerade sie waren gewillt zu unterhandeln. Anders die einfachen Bürger und Handwerker, die die Hauptlast landesherrlicher Abgaben trugen. Unter ihnen tat sich ein gewisser Heinrich Runge hervor, der zum Wortführer wurde und die Menge weiter aufstachelte. Man bemächtigte sich der Ratsmitglieder, bezichtigte diese des Verrats und steckte sie in den städtischen Kerker, wo einige am 17. September brutal ermordet, andere in aller Öffentlichkeit enthauptet wurden, darunter Runges eigener Bruder. Die um ihren Wohlstand besorgten Kaufleute taten sich zusammen, stimmten gemäßigtere Töne an und traten mit dem von Nikolaus von Rostock neu eingesetzten Rat in Verbindung. Man entledigte sich der radikalen Elemente, indem Runge und seine Anhänger aus der Stadt verbannt wurden. So im Inneren befriedigt, bat der Rat um Frieden. Das Jahr war bereits weit fortgeschritten, von den Belagerern harrte noch Heinrich von Mecklenburg aus, Waldemar und sein Mündel Johann waren nach dem Fall von Warnemünde in die Mark zurückgekehrt, ebenso wie nacheinander die anderen Fürsten. Waldemar kehrte aber bereits im Oktober wieder an den Kriegsschauplatz zurück und traf sich in Mestlin mit dem dänischen König, wo die weiteren Bedingungen ihres gemeinsamen Krieges abgestimmt wurden.
Die Unterhandlungen mit der Stadt waren im Laufe des November soweit fortgeschritten, dass sich am 6. Dezember die jeweiligen Bevollmächtigten bei Polchow trafen, um die vereinbarten Friedensbedingungen zu besiegeln. Am 15. Dezember 1312 leistete der Rostocker Rat in die Hand Heinrich von Mecklenburg die Huldigung für Erik von Dänemark. Zu den Friedensauflagen gehörte die Zahlung von 14.000 Mark Silber in drei Raten, zu leisten innerhalb eines Zeitraums von sieben Monaten. Die Summe konnte ebenso in grobem Tuch und in Pelzen geleistet werden, was augenscheinlich wichtige Handelswaren der Stadt gewesen sein müssen.
Die fränkischen Besitzungen werden veräußert
Wie wir gelesen haben, war der 1298 verstorbene Markgraf Otto V. der Lange, in zweiter Ehe mit Judith (Jutta) von Henneberg-Coburg verheiratet. Sie wurde die Mutter Markgraf Hermanns, folglich Großmutter des unmündigen Johanns, dem Universalerben in spe der Ottonischen Landschaften, das aktuelle Mündel Waldemars. Judith war die Tochter des Grafen Hermann I. von Henneberg. Das Grafengeschlecht derer von Henneberg unterteilte sich in mehrere Zweige, so in die Linie Henneberg-Coburg, mit Territorialbesitz in Südthüringen und Nordfranken um Coburg aber auch Schweinfurt. Judith brachte umfangreiche Teile davon in die Ehe mit und damit an die brandenburgisch-ottonische Linie. Die fern den märkischen Kerngebieten gelegenen Gebiete wurden größtenteils von Bevollmächtigten verwaltet, sogenannten Landpflegern, woraus sich der Begriff der Coburger Landpflege entwickelte, auch Coburger Land. Als 1308 Markgraf Hermann auf einem Feldzug gegen Nikolaus von Rostock erkrankte und bald darauf starb, kamen nach Wirrungen diese Gebiete über Hermanns Sohn und Erben Johann, zur Verwaltung an dessen Vormund Waldemar, der selbst keine herrschaftlichen Aktivitäten darüber ausübte und an die stückweise oder komplette Verpfändung oder Verkauf dachte. Was sich zu Geld machen ließ, wurde unter Waldemar auch zu Geld gemacht, der Geldbedarf des Markgrafen war notorisch, worauf wir noch gesondert eingehen.
Für die Grafen von Henneberg hatte sich bislang keine Gelegenheit ergeben, die 1291 an Brandenburg gelangten Coburg- und Schmalkaldischen Lande mit ihrer Grafschaft wieder zu vereinigen. Graf Berthold VII. zu Henneberg-Schleusingen, ein Manne von ganz ausgezeichneten Charaktereigenschaften, der schon als Waldemars Gesandter anlässlich der Königswahl auftrat, stand mit dem Markgrafen im besten Einvernehmen. Graf Berthold hatte seinen ältesten Sohn Heinrich Anfang 1312 mit Jutta, einer Tochter des verstorbenen Markgrafen Hermann vermählt, Schwester Johanns und der Agnes, Waldemars Gattin. Der dahingeschiedene Markgraf hatte die fränkisch-thüringischen Lande, die Eigenbesitz waren und kein Reichslehen, auf seine vier Kinder vererbt, und so brachte Jutta ihren Anteil als Mitgift in die Ehe. Wegen weiterer, vielleicht aller sonstigen Landesteile in brandenburgischem Besitz, trat Graf Berthold mit Waldemar in Verhandlungen. Die Entlegenheit der Region, machte eine effiziente Verwaltung schwer. Schon Markgraf Hermann war gezwungen einen Regenten einzusetzen, wozu er einen fernen Verwandten, den Grafen Walther von Barby bestimmte. Dieser war ein unruhiger und streitlustiger Zeitgenosse und fing allerlei Fehden und handfeste Kriege mit angrenzenden Nachbarn an, die nur mühsam beigelegt werden konnten. All das begünstigte die Unterhandlungen Graf Bertholds mit dem notorisch in Geldverlegenheiten steckenden Waldemar sehr, der bei alledem, bis auf die Mitgift seiner Braut Agnes, dabei kein Eigengut, sondern das seines Mündels und dessen Schwestern veräußerte, im übrigen auch jenes seiner Schwiegermutter. Hieraus ergab sich noch manche Diskussion, doch war der Verkauf nicht mehr zu stoppen. Gegen Leistung mehrerer Abschlagszahlungen von 3.000, 4.000 und 6.000 Mark Silber, begleichbar ihn Raten, unter Stellung von Pfandbesitz, gingen die Landschaften um Coburg und Schmalkalden wieder in den Besitz derer von Henneberg über, das brandenburgische Intermezzo in Nordfranken und Südthüringen hatte ein Ende.
Krieg gegen Meißen – Vertrag zu Tangermünde
Das Jahr 1312 sah Brandenburg nicht nur im Krieg in Mecklenburg, Waldemar war zusätzlich in eine weitere kriegerische Auseinandersetzung verwickelt, diesmal in eigener Sache. Wir erinnern uns an die Erwerbungen der Mark Landsberg, der Pfalz Sachsen und dem Gebiet um Torgau. Diese Landschaften, die außerhalb des brandenburgischen Kernlandes lagen, wurden 1290/91 durch Otto IV. dem Markgrafen von Meißen, Albrecht II. dem Entarteten abgekauft worden. Albrecht, ein Spross aus dem Wettiner Geschlecht, führte damals Krieg gegen die eigenen Söhne aus erster Ehe und veräußerte das Gebiet lieber an die Askanier, als dass diese in die Hände seiner Söhne fallen könnten. Hintergrund des Streits waren weitere Nachkommen aus Albrechts späterer Ehe. Sicher hatte die Art wie sich Albrecht von seiner ersten Frau trennte, eine staufische Tochter des 1250 verstorbenen Kaisers Friedrich II., Mutter der genannten Söhne, eine Rolle bei den blutigen Zerwürfnissen gespielt. Jahre vor seinem Tod versöhnte sich Albrecht mit den Söhnen Friedrich und Dietrich. Jener Dietrich, auch Diezmann genannt, verkaufte 1303 den westlichen Teil der Lausitz an Markgraf Otto IV. mit dem Pfeil. Die Besitzverhältnisse um die Markgrafschaft Meißen und Landgrafschaft Thüringen, die Albrecht dem Entarteten als Erbe zugefallen waren, blieben währenddessen kompliziert. Wir haben gelegentlich schon davon gesprochen. Der römisch-deutsche König Adolf von Nassau betrachtete beide Lehen als erledigt und ans Reich zurückgefallen, worauf er, zur Vergrößerung seiner eigenen Hausmacht, militärisch intervenierte, besonders in Thüringen, um sich in den Besitz zu bringen. Bezüglich Meißen erhob ebenso der König von Böhmen Ansprüche, ob gerechtfertigt oder nicht, seine Macht war groß genug, dass die Könige Adolf und sein Nachfolger Albrecht, dies nicht grundlegend bestritten. Die politischen Umstände veranlassten Böhmen, das zu dieser Zeit Ansprüche sowohl auf die Krone Polens, wie Ungarns durchzusetzen versuchte, die Mark Meißen an Brandenburg zu verpfänden, für die enorme Summe von 50.000 Mark Silber. Wie die brandenburgischen Markgrafen, wir reden von der Zeit Markgraf Ottos IV., Haupt der Johanneischen Linie, und Markgraf Hermann, seit dem Tod des Vaters Otto V., Kopf der Ottonischen Linie, diese Summe aufbrachten, entzieht sich komplett unserer Kenntnis. Es scheint auch, dass wesentlich Markgraf Hermann, kraft seiner verwandtschaftlichen Nähe zum böhmischen König, der eigentliche Pfandnehmer war. Dass Brandenburg tatsächlich das Regiment in Meißen ausübte, erkennen wir am Itinerar Markgraf Hermanns, der wiederholt in Oschatz urkundete. Mit dem Tod Hermanns, gingen dessen Rechte an seinen minderjährigen Sohn Johann über und damit, bis zu dessen Mündigkeit, an seinen Vormund Waldemar.
Gehen wir nochmal wenig Jahre wieder zurück. Albrecht der Entartete, mittlerweile der Regierung überdrüssig geworden, trat gegen eine jährliche Pension die Regierung an die Söhne ab. Als Dezember 1307 Dietrich ermordet wurde, übernahm Friedrich die Regentschaft über beide Landstriche, 1309 erbte er zusätzlich von seinem Onkel weitere Gebiete. Margarete von Staufen (1237 – 1270), die oben erwähnte Tochter Kaiser Friedrich II., war seine Mutter. Die ghibellinischen Anhänger der Staufer in Oberitalien sahen in ihm, einem Enkel des großen Kaisers, wenn auch aus weiblicher Linie, einen möglichen zukünftigen Friedrich III. Imperator Romanorum des Reichs. Selbstbewusst nannte er sich demnach, Friedrich III., König von Jerusalem und Sizilien, Herzog von Schwaben, Landgraf zu Thüringen und Pfalzgraf zu Sachsen. Da außer der Landgrafschaft Thüringen sowie Wettiner Streubesitz, alles andere nur Titulatur war, lag Friedrich einiges daran, alten wettinischen Besitz wieder an sich zu bringen. Dementsprechend erkannte er die Verpfändung der Mark Meißen nicht an und lag auch hinsichtlich der Pfalz Sachsen mit Markgraf Heinrich wiederholt im Streit. Die Stimmung zwischen den brandenburgischen Askaniern und dem Wettiner verfinsterte sich zusehends, Verhandlungen, so am 12. Juli 1309 zu Mühlberg, führten nur zu zeitweiligem Aufschub eines Konflikts, nicht zu einer nachhaltigen Lösung. Damals wurde ein Schiedsverfahren bestimmt mit Graf Albrecht von Anhalt als Obmann. Über das Ergebnis eines gegebenenfalls existierenden Schiedsspruchs, ist leider nichts bekannt. Der Forderung nach Rückerstattung der Pfandsumme, wollte und konnte Friedrich nicht nachkommen, Waldemar war umgekehrt nicht gewillt seine, vielmehr die Anrechte seines Mündels, zu verschenken, wenngleich bis auf wenige Städte und Schlösser, zwischenzeitlich nur noch wenig im wirklichen Besitz Brandenburgs war, viel war weiterverpfändet worden. Die Situation spitze sich weiter zu und neben den Streitpunkten um Meißen, mengten sich jetzt sogar Fragen bezüglich der Lausitz und der Mark Landsberg bei. Friedrich der Freidige stellte jetzt alle Erwerbungen der Brandenburger in Frage.
Markgraf Waldemar griff nun zu dem Waffen, er zog zunächst in die Lausitz, wo er sich am 24. März 1312 aufhielt, vergewisserte sich der dortigen Verhältnisse, bevor er mit einem Schlag gegen die befestigte Stadt Hayn, heute Großenhain, seinen Feldzug gegen den Wettiner eröffnete. Die Stadt sollte in der Nacht durch Handstreich genommen werden. 30 Brandenburgern eines Voraustrupps gelang es zunächst unbemerkt die Mauer zu erklettern und sich Zugang in die Stadt zu verschaffen. Die Eindringlinge wurden dann aber von aufmerksamen Bürgern entdeckt und gefangen gesetzt. Es drohte ein kläglicher Misserfolg. Von den Aussagen der Gefangenen erfuhren die Bürger, dass sich Waldemar mit einer größeren Streitmacht im Anmarsch befand. In Furcht, schickten sie Boten zu ihrem eigenen Markgrafen und ersuchten um Hilfe. Friedrich machte sich, begleitet von seinem gleichnamigen Sohn und einer schnell zusammengerafften, nicht besonders großen Schar, sogleich auf den Weg. Unweit der Stadt fiel den Truppen Waldemars in die Hände und wurde gefangen genommen. Aus der sich abzeichnenden Niederlage, wurde völlig unverhofft ein ungeahnter, großartiger Erfolg. Ohne dass es zu größeren Kampfhandlungen gekommen wäre, war der Krieg damit schon entschieden, indem beide hohen Fürsten, Vater und Sohn in die Hände ihrer Feinde gerieten. Sie wurden unter strenger Bewachung nach Nordwesten gebracht, in die altmärkische Elbfestung von Tangermünde, wo man sie und ihre Begleiter festsetzte.
Waldemar stellte zur Freilassung schwere Forderungen. Es kam zuerst zu keiner Einigung, doch die Lage ließ dem gefangenen Friedrich dauerhaft kein Optionen. Am 14. April 1312 kam es zum Vertrag von Tangermünde. Die Meißner Markgrafen mußten 32.000 Mark Silber entrichten, zu zahlen in drei Raten, davon die erste fällig am 11.11.1312 zu Martini, die beiden restlichen Drittel jeweils 12 Monate später. Mit jeder beglichenen Teilsumme wurden die damit verbundenen Pfandstädte zurückgegeben. Markgraf Friedrich musste ferne alle erhobenen Ansprüche auf die Marken Landsberg und Lausitz, sowie dem Elbe-Elster-Land aufgeben. Weiter die Städte und Gebiete Torgau und Hayn abtreten. Zu den als Pfand, bis zur Begleichung der Schuldsumme einbehaltenen Städten gehörte neben Oschatz, Grimma, Geithan, nebst weiteren, als Kernstück das reiche Leipzig. Alle geleisteten Garantien und Zahlungen Waldemar und seinen Nachfolgern, sollte er denn vor Vertragserfüllung sterben. Der brandenburgische Markgraf ging bei allem mit großer Vorsicht vor, ließ vorerst nur des alten Markgrafen Sohn frei, der unter den Meißner Ständen die Bedingungen verkündete. Der Krieg flackerte währenddessen immer wieder regional auf. Örtliche Adelige leisteten Widerstand, sie glaubten damit ihrem gefangenen Herren mehr zu dienen. Dauerhaft ebbten die Aufstände schließlich ab, besonders nachdem auch Friedrich der Freidige auf freien Fuß kam. Der Konflikt war offiziell beigelegt, noch bevor Waldemar wieder nach Mecklenburg zog, um vor Warnemünde die Verbündeten bei der Belagerung der dort von Rostock errichteten Festung zu unterstützen.
Königswahl
Auf den bedauernswerten Tod Kaiser Heinrichs VII. im italienischen Heerlager, folgte eine 14-monatige Thronvakanz. Im Reich tat man sich noch schwerer als sonst, einen allgemein anerkannten Nachfolger zu finden. Die Lage nutzend, warf Frankreich abermals einen Bewerber ins Rennen, doch von Beginn an ohne Chance. Größte Aussichten hatte der Habsburger Friedrich, den man seiner anmutigen und ritterlichen Erscheinung wegen den Schönen nannte. Frühzeitig konnte er die Stimmen des Wittelsbacher Pfalzgrafen Rudolf, sowie Brandenburgs für sich gewinnen. Die Brandenburger Stimme wurde sowohl von Waldemar, wie von seinem Halbonkel Heinrich beansprucht, ohne dass beide darüber in Streit zerfielen. Wir kommen darauf zurück. Herzog Rudolf, der askanische Verwandte aus Sachsen-Wittenberg, gehörte ebenso zur Habsburger Partei wie der Kölner Erzbischof Heinrich von Virneburg, dessen Stimme besonderes Gewicht hatte.
Allein der verstorbene Kaiser war ein Luxemburger, sein Sohn Johann war als König von Böhmen stimmberechtigt, und Erzbischof Balduin von Trier gehörte, wir wir wissen, ebenfalls dem Luxemburger Hause an. Kam der Habsburger Friedrich auf den Thron, würde er zweifelsohne Böhmen als ein ihm entzogenes Erbstück einfordern. Dies mußte aus Sicht der Luxemburger Partei verhindert. Johann von Böhmen konnte sich selbst nur wenig Hoffnung auf eine Wahl machen, er galt als zu jung und war mit Böhmen und der vortrefflich verwalteten Grafschaft Luxemburg aus Sicht der Wahlfürsten wohl auch zu mächtig. Die Kurfürsten blieben ihrem alten, seit dem Ende der Staufer praktizierten System treu, und präferierten ein Oberhaupt mit möglichst bescheidener Hausmacht, es sei denn, es entstünde ihnen persönlicher Nutzen. Ihr selbstverständlicher Anspruch an den Reichsgeschäften einen Anteil zu haben, hatte sich zwischenzeitlich verfestigt. Ein starker Monarch widerstünde derartigen Bestrebungen allzu leicht und könnte die seit Friedrich II. erlangten Privilegien möglicherweise unterlaufen, schlimmstenfalls revidieren.
Kopf der Luxemburger Partei war Balduin von Trier, ihm gelang es den Erzbischof von Mainz zu gewinnen, wodurch sich mit drei gewichtigen Stimmen eine starke Opposition formiert hatte. Die Hauptsache war, Friedrichs Wahl unter allen Umständen zu verhindern, und wenn möglich einen länderarmen Fürsten stattdessen zu wählen. Es wurden alle Mittel in Bewegung gesetzt noch mehr Stimmen zu verschaffen.
Zunächst wanden sie sich an Herzog Johann von Sachsen-Lauenburg. Zwar war es streitig ob er, statt Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg, die sächsische Kurstimme inne hatte, doch war er gerade deswegen umso leichter für die proluxemburgische Seite zu gewinnen und gleichzeitig der Habsburger Gegenseite eine Stimme zu entziehen, wodurch die Waage zugunsten der antihabsburgischen Opposition ausschlüge. Die Frage wer nun die sächsische Stimme rechtmäßig hielt, gilt es zu erörtern. Der im Jahre 1260 verstorbene Herzog Albert I. von Sachsen führte als solcher eine Kurstimme. Seine zwei Söhne teilten die sächsischen Lande. Herzog Johann I. erhielt die niedersächsischen Gebiete, nämlich Sachsen-Lauenburg, während Herzog Albert II. die obersächsischen Länder bekam, und die Linie Sachsen-Wittenberg gründete. Albert II. hatte sich die Kurstimme mehr angeeignet, als dass sie ihm übertragen worden wäre. Die ältere Linie Sachsen-Lauenburg hatte nicht darauf verzichtet und seither schwelte der Streit. Mit dem Tod Alberts II. 1308, führte der oben erwähnte Rudolf als Erbe die Kurstimme fort, was Johann von Sachsen-Lauenburg beharrlich nicht anerkannte. Herzog Johann wurde eingeladen, sich zur Wahl an den Rhein zu begeben, doch schrieb er am 16. Oktober 1313, dass sein Gesundheitszustand es ihm nicht ermögliche zur Königswahl persönlich zunerscheinen und daher sein Bruder Herzog Erich von ihm bevollmächtigt sei. Wenn auch Erichs Haltung ungewiss war, stritt man durch seine Anerkennung die Stimme Rudolfs von Sachsen-Wittenberg an, der als fester Parteimann Friedrichs des Schönen bekannt war. Man konnte erwarten, dass keine Partei die sächsische Stimme der jeweils anderen Seite anerkennen würde, und so hatte die Luxemburger Partei drei unangefochtene Stimmen, ebenso wie der Habsburger Friedrich. Pfalzgraf Rudolf war habsburgisch, ebenso der Kölner Erzbischof, die beide weitläufig mit Friedrich dem Schönen verwandt waren. Es war nicht daran zu denken, sie ohne weiteres abspenstig zu machen, zumal die Luxemburger Opposition bislang selbst noch keinen Königskandidaten hatte, und nur bestrebt war, die Wahl Friedrichs aus den genannten Gründen zu verhüten. Alles hing jetzt an Brandenburg, deren Markgrafen Waldemar und Heinrich jeder für sich vorläufig das Recht zur Wahl beanspruchten. Um erstens Brandenburg für die Luxemburger Interessen zu gewinnen, zweitens den bisherigen Mangel eines eigenen Kandidaten zu beseitigen und drittens einen möglichen brandenburgischen Stimmstreit elegant zu umgehen, einigte man sich auf Waldemars Halbonkel Heinrich, dessen fortgeschrittenes Alter Anlass zu Hoffnung gab, kein übermäßig rühriges Haupt zu erhalten. Doch glaubt man dies bei der Wahl Rudolfs von Habsburg einst auch und war von dessen Energie dann doch überrascht worden. Unter veränderten Rahmenbedingungen wechselte Markgraf Waldemar in aller Heimlichkeit die Partei, ohne dass die Habsburger Seite darüber Kenntnis erhielt. Der Oktober war noch nicht vorüber und es kam Bewegung ins Spiel. Scheinbar beflügelt von der Aussicht den bald 60-jährigen Halbonkel an der Spitze des Reiches zu sehen, begann Waldemar in Wahlangelegenheiten eine Eigendynamik. Er bemühte sich um die Sachsen-Lauenburger Verwandten und deren Stimme. Am 31. Oktober kam es im neumärkischen Königsberg zum Treffen zwischen den Herzögen Johann und Erich, sowie dem Markgrafen Waldemar. Dem Treffen gingen Vorverhandlungen voraus, so dass man sich an besagtem Tag auf eine Reihe von Punkten verständigte. Brandenburg erkannte die Kurstimme Sachsen-Lauenburgs an und war bereit dieses Vorrecht gegen jedermann zu verteidigen. Herzog Erich, sollte er an der Wahl teilnehmen, wird die Stimme Brandenburgs vertreten aber nur so abstimmen, wie es von den Markgrafen vorgegeben wurde. Sollten die brandenburgischen Markgrafen selbst zur Wahl erscheinen, künden sie dies mit vierwöchigem Vorlauf an, holen Herzog Erich ab, geleiten ihn sicher vor Ort und sorgen sich auf eigene Kasse um Verköstigung und Gewandung für ihn und seine Begleiter. Für den Fall, Herzog Erich erschiene selbst nicht zur Wahl, würden statt seiner zwei bevollmächtigte Gesandte zur Wahl reisen, die im Sinne Brandenburgs an der Wahl teilnähmen. Über einen zu wählenden Kandidaten verliert der Vertrag kein Wort. Dergleichen Dinge wurden gewöhnlich in aller Stille untereinander mündlich vereinbart und unter Zeugen beeidigt, jedoch nicht schriftlich überliefert. Spätestens jetzt war der Parteiwechsel Waldemars offenbar geworden. Hätte er weiterhin dem Habsburger Friedrich angehangen, wäre eine Übereinkunft mit Sachsen-Lauenburg unnötig gewesen, denn Sachsen-Wittenberg verharrte unbeirrt bei der österreichischen Partei. Es scheint, dass er auch nicht mehr der Luxemburger Opposition unverbrüchlich verbunden war, und nun selbst eine Partei mit seinem Halbonkel als vorgesehenen Kandidaten geplant zu haben. Würde er den Luxemburgern oder den Habsburgern eine Stimme abspenstig machen können, käme er mit drei der Sieben Stimmen in den Bereich der Mehrheit. Er setzte, so schien es, den Hebel bei Friedrichs Stimmanhängern an und schloss mit dem Erzbischof von Köln am 18. November 1313 eine Vertrag, wonach beide einmütig den gleichen Kandidaten wählen würden. Es war die Wiederholung eines 1308 bereits einmal geschlossenen, gleichlautenden Vertrags anlässlich der damals stattfindenden Wahl zum römisch-deutschen König, die seinerzeit bekanntermaßen der Mitte des Jahres verstorbene Heinrich VII. gewann. Der Erzbischof war augenscheinlich nicht unter allen Umständen unverbrüchlich an der Seite Friedrichs des Schönen, denn noch Ende September hatte er sich mit seinen beiden rheinischen Bischofskollegen zu Rhense getroffen, um über einen gemeinsamen Kandidaten zu verhandeln. Es kam zu keiner Übereinkunft und man trennte sich ergebnislos. Es war eine verfahrene Situation. Die Habsburger Partei beanspruchte dreimder sieben Kurstimmen, von denen aber nur jene des Pfalzgrafen Rudolf von Wittelsbach sicher war, während die Rudolfs von Sachsen-Wittenberg von den Vettern aus Sachsen-Lauenburg mit Hilfe Brandenburgs und der Luxemburger Partei angefochten wurde. Die Luxemburger Opposition glaubte bislang vier Stimmen sicher zu vereinen, und mit Sachsen-Lauenburg wenn nicht ein fünfte Stimme zu besitzen, so doch immerhin eine, welche die sachsen-wittenbergische neutralisierte. Trotz Stimmenmehrheit, war der bisherige Mangel eines tragbaren Kandidaten fatal, denn neben der schon erwähnten Jugend Johanns von Böhmen, dem Sohn des verstorbenen Kaisers, wäre bei seiner Wahl die offene Ablehnung der habsburgisch regierten Territorien vorprogrammiert. Ein blutiger Thronstreit unvermeidlich.
Von Waldemars neuerlichem Systemwechsel und dessen eigener Parteienbildung erhielt man wohl erst im Laufe der zweiten Hälfte des Novembers ausreichend Kenntnis ohne jedoch völlige Gewissheit zu erlangen. Der Luxemburger Vorsprung schmolz unter der Annahme des brandenburgischen Stimmenverlusts zwar zusammen, aber durch die auch in der neuen Konstellation vorhandenen sächsischen Rivalität um das Kurprivileg, ging in der Summe die Mehrheit nicht verloren. Ein Kandidat musste her, der das Reich nicht der Gefahr eines Thronkriegs aussetzte. Mit dem Wittelsbacher Herzog Ludwig von Oberbayern brachte sich im November 1313 ein Fürst ins Spiel, der die Voraussetzungen erfüllte. Dieser stand seit Ende 1310 mit seinem Bruder Rudolf im Streit um die Vormundschaft im Herzogtum Niederbayern, wo Ludwig zunächst mit Vetter Otto III. über die unmündigen Knaben Otto und Heinrich, Söhne des im Dezember 1310 verstorbenen Herzog Stephan I., verfügte. Als auch Otto III. am 9. September 1312 in Landshut starb, übernahm Ludwig alleine die Regenschaft in Niederbayern. Die Witwen Stephans I. und Ottos III. fürchteten um ihre Vorrechte, scharten den niederbayrischen Lehnsadel um sich und riefen die benachbarten Habsburger um Hilfe. Herzog Rudolf, der sich in der niederbayrischen Angelegenheit unberücksichtigt übergangen sah, ließ zwar das Schwert gegen den jüngeren Ludwig ruhen, stand aber seit dem Tod des Kaisers mit seiner pfalzgräfischen Kurstimme, die ihm als dem älteren zustand, fest im habsburgischen Lager. Am 21. Juni 1313 verglichen sich beide Brüder im Münchner Frieden. Der Friede indes hielt nicht lange, doch lange genug, damit Ludwig den Rücken frei hatte, um gegen die niederbayrische Adelsopposition und ihre Habsburger Unterstützer offen zu Felde zu ziehen. Unterstützung fand er bei den wichtigen niederbayrischen Städten Landshut und Straubing. Am 9. November 1313 kam es beim oberbayrischen Gammelsdorf zur Schlacht, die Ludwig überraschend deutlich für sich entscheiden konnte. Der Herzog zog mit seinem Sieg die Aufmerksamkeit der antihabsburgischen Partei der Luxemburger auf sich. Eigentlich waren Ludwig und Friedrich enge Jugendfreunde. Beide wuchsen gemeinsam auf, doch gegensätzliche Interessen machten sie zu Gegnern. Trotzdem kam es nicht zum völligen Bruch. Unter Vermittlung des Salzburger Erzbischofs Weichart von Pohlheim wurde im Dezember ein Treffen Friedrichs mit Ludwig erwirkt, dem am 17. April 1314 zu Salzburg eine endgültige Aussöhnung folgte. Die unbedingte Ernsthaftigkeit des Friedens wurde durch allerlei symbolische Handlungen ausdrücklich betont.
Am 21. Dezember trafen sich die Räte des Erzbischofs von Mainz mit jenen Herzog Rudolfs, des Bruders Ludwigs zu Vorverhandlungen. Noch hielt der Frieden von München zwischen den Brüdern und es hatte den Eindruck, als ob Rudolf zu dieser Zeit die Partei Friedrich von Habsburgs verlassen habe. Sowohl er wie der jüngere Ludwig wurden als mögliche Königskandidaten diskutiert. Schon sicherte sich der Erzbischof für seine Stimme umfangreiche Wahlzugeständnisse, so Burg und Stadt Weinsheim, die Burg Reichenstein und zusätzlich stolze 10.000 Mark in Silber. Bei Summen dieser Größenordnungen, wird man leicht erahnen können, das der meistens klamme Waldemar und nicht besser sein Halbonkel Heinrich, der brandenburgische Kandidat, kaum in der Lage waren Zugeständnisse zu machen. Zum Jahreswechsel schwanden die Chancen für Brandenburg. Auch im dritten Anlauf der Askanier, nach Otto III. 1257, Otto IV. 1308, zeichnete sich 1314 ab, dass auch Markgraf Heinrich nicht die Krone erlangen würde. Es wurden noch mancherlei Verhandlungen und Gegenverhandlungen vollführt, auf die hier nicht eingegangen wird. Es sollte noch einmal 10 Monate dauern, bis es im Oktober 1314 endlich zur Königswahl kam. In der Zwischenzeit hatten sich die Wittelsbacher Brüder wieder miteinander überworfen und Herzog Rudolf war mit seiner pfalzgräfischen Kurstimme ins habsburgische Lager Friedrichs des Schönen zurückgekehrt. Am 19. Oktober 1314 wählten der Erzbischof von Köln, Rudolf von Wittelsbach, der oberbayrische Herzog und gleichzeitige Pfalzgraf bei Rhein, sowie Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg in Sachsenhausen den Habsburger Friedrich zum König.
 Nur einen Tag später gaben die vier restlichen Kurfürsten, die Erzbischöfe Peter von Mainz und Balduin von Trier, König Johann von Böhmen und Markgraf Waldemar von Brandenburg in Frankfurt ihre Stimme dem bayrischen Kandidaten Ludwig von Wittelsbach und kürten ihn zu ihrem König. Das Reich war also in die Lager zweier Könige gespalten. Der schleichende Niedergang des Reiches, seit dem Tod Friedrichs II. im Jahre 1250, der unter Rudolf I. und Heinrich VII. kurzzeitig gestoppt aber nur begrenzt revidiert werden konnte, drohte sich nun wieder fortzusetzen. Die Haltung und die partikularen Interessen der Kurfürsten schadeten zunehmend dem gesamten Reichskörper. Der beklagenswerte Umstand dass zwei Kandidaten in den Königsstand erhoben wurden, bewies eine beklagenswerte Missachtung der Stellung des Königs als Oberhaupt des Reiches und war bezeichnend für die selbstherrliche Art einzelner Kurfürsten, allen voran und wiederholt der Erzbischöfe von Mainz und Köln.
Nur einen Tag später gaben die vier restlichen Kurfürsten, die Erzbischöfe Peter von Mainz und Balduin von Trier, König Johann von Böhmen und Markgraf Waldemar von Brandenburg in Frankfurt ihre Stimme dem bayrischen Kandidaten Ludwig von Wittelsbach und kürten ihn zu ihrem König. Das Reich war also in die Lager zweier Könige gespalten. Der schleichende Niedergang des Reiches, seit dem Tod Friedrichs II. im Jahre 1250, der unter Rudolf I. und Heinrich VII. kurzzeitig gestoppt aber nur begrenzt revidiert werden konnte, drohte sich nun wieder fortzusetzen. Die Haltung und die partikularen Interessen der Kurfürsten schadeten zunehmend dem gesamten Reichskörper. Der beklagenswerte Umstand dass zwei Kandidaten in den Königsstand erhoben wurden, bewies eine beklagenswerte Missachtung der Stellung des Königs als Oberhaupt des Reiches und war bezeichnend für die selbstherrliche Art einzelner Kurfürsten, allen voran und wiederholt der Erzbischöfe von Mainz und Köln.
