Die Mark zu Beginn des 14. Jahrhunderts
Als Markgraf Otto IV. im Januar 1309 starb, der genaue Todestag ist selbst bei einem so bedeutenden Fürsten nicht überliefert, hatte er vier Jahrzehnte, davon den größeren Teil in kooperativer Weise mit seinen Brüdern, den Johanneischen Nachlass des Vaters regiert. Mitnichten war er darin tonangebend, weder unter seinen Brüdern, und noch weniger im anderen Landesteil in der zweigeteilten Mark, wie es bis heute in den meisten aktuellen Darstellungen über ihn heißt. Eine quellenkritische Studie der brandenburgischen Regesten zeigt ihn mitwirkend an der Seite seiner Brüder Johann und Konrad, ohne dass bei ihm dominante Regierungshandlungen deutlich zu erkennen wären. Zweifelsfrei war er durch sein vielfältiges Wirken im Mittelpunkt der Wahrnehmung der Zeit, doch bedeutet dies nichts in Bezug auf die Regierungsgeschäfte. Erst nach dem Tod Johanns II., seinem älteren Bruder, übernahm er eine führendere Rolle ein, allerdings nur innerhalb jener märkischen Teile, die zum Johanneischen Erbe gehörten. In den Landschaften des Ottonischen Zweigs hatte weder er, noch einer seiner Brüder, oder deren Nachkommen, auch nur das Geringste zu sagen, so lange dort ein mündiger Nachfahre des Zweiggründers lebte. Zum Ende des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts änderten sich in rascher Folge die Verhältnisse an der Spitze der Markgrafschaft grundlegend. Auch das Reich, ja selbst ganz Europa erlebte in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts weitreichende Veränderungen, darunter einschneidende klimatische Umwälzungen, die große Auswirkungen auf die damalige Gesellschaft hatten, worauf wir im nächsten Kapitel aber auch in Buch 2 näher eingehen werden.
Im Schlussteil des letzten Kapitels lasen wir von vormals 19 brandenburgischen Markgrafen, die noch im Jahre 1290 lebten. Sie stammten aus den zwei märkischen Linien, worin auch schon eine Kindergeneration eingerechnet war. Diese komfortable Zahl war am Ende der Regentschaft Ottos IV. auf nur noch eine Handvoll zusammengeschmolzen. An männlichen Gliedern lebte aus der Ottonischen Linie nur noch Johann V., der Sohn Hermanns II. des Langen, Enkel Ottos V. des Langen. Im jüngeren Zweig der Johanneischen Linie gab es Heinrich II., den man das Kind nannte, sowie dessen Vater Heinrich I., der den Beinamen ohne Land trug. Er war der Halbbruder des gerade verstorbenen Markgrafen Otto IV mit dem Pfeil. Schließlich noch Waldemar I., aus dem ältesten Zweig der Johanneischen Linie. 1309 übernahm er federführend in der gesamten Mark die Regierungsgeschäfte, an denen er noch zu Lebzeiten des alten Markgrafen Otto für den Johanneischen Teil, seit spätestens April 1303 beteiligt war. Für den minderjährigen Johann, dessen Vater Hermann II. Februar 1308 auf einem Feldzug in Mecklenburg erkrankte und noch relativ jung verstarb, wurde er zum Vormund, wir kommen darauf zurück.
Der erwähnte Waldemar wurde als jüngster Sohn Konrads I. wahrscheinlich im Frühjahr 1291 geboren. Weiter unten werden wir näher auf diese Annahme eingehen, sie ist von Bedeutung, denn bisher galt Konstanze von Polen als seine Mutter, was wir glauben mit gutem Grund bezweifeln zu dürfen. In erster Ehe war Konrad tatsächlich mit jener Konstanze verheiratet. Sie war erstgeborenes Kind Herzog Przemysłs I., aus der großpolnischen Linie der Piasten. Von dieser Ehe stammen verbindlich die Söhne Johann und Otto ab. Die 1260 vollzogene Heirat war dem Wesen der Zeit folgend, von den Eltern vereinbart und sollte den brandenburgischen Besitz der weit nach Nordosten reichenden, noch immer expandierenden Neumark gegen das mächtige polnische Herzogtum dynastisch absichern. Das Land jenseits der Oder war nach väterlicher Disposition als zukünftiges Refugium Konrads vorgesehen. Es ging 1266 auch tatsächlich auf ihn über. Weitere Gebiete der Neumark waren im Teilungsvertrag von 1266 der Ottonischen Linie zugefallen, so an Albrecht III. Trotz Verschwägerung mit dem großpolnischen Hof, blieben in der Folgezeit blutige Zusammenstöße mit dem einzigen Sohn und späteren Nachfolger des alten Herzogs nicht aus. Przemysł II., der neue Herzog, war als Bruder von Konstanze, der Schwager Markgrad Konrads. Der gleiche Herzog war später ebenso mit der Ottonischen Linie verschwägert, indem er 1291 in dritter Ehe Margarete, eine Tochter Markgraf Albrechts III. heiratete, welcher wie schon erwähnt, ebenfalls in der Neumark Ländereien hielt. Przemysł II. wurde im Herbst 1257 geboren und war rund 12 Jahre jünger, als seine Schwester Konstanze. Er kam erst 1279 in Großpolen an die Regierung, wo zuvor, seit dem 1257 erfolgten Tod des Vaters, Bolesław VI. der Fromme, ein jünger Bruder des verstorbenen Przemysł I., die Regentschaft derweil ausübte.
Wir kehren zunächst wieder ins Schlussjahrzehnt des 13. Jahrhunderts zurück, beleuchten die Herrschaftsverhältnisse an der Spitze des Reichs nochmals näher, sowie die letzten rund 10 Regierungsjahre Markgraf Ottos IV., die im letzten Kapitel nur stark verkürzt wurden. Die Übergänge bei der brandenburgischen Regierung, besonders was die Johanneische Linie betraf, waren fließend und nicht relativ hart, wie beim Tod Johanns I. und Ottos III. oder deren Vorgängern.
Situation im Reich – Thronwechsel
Albrecht von Habsburg war 1298 zum neuen römisch-deutschen König gewählt worden. Adolf von Nassau wurde zuvor in einer bisher einmaligen Weise von den Kurfürsten seines Königtums enthoben. Wie wir sahen, hatte ihn seine Politik im thüringischen Raum in Widerstreit zu gleich drei weltlichen Kurfürsten gebracht, die sich in ihren eigenen Territorialinteressen übergangen fühlten. Zu ihnen gesellte sich mit dem Mainzer Erzbischof noch der vielleicht mächtigste unter den geistlichen Wahlfürsten hinzu, auch wenn zu dieser Zeit die Rivalität zwischen den Metropoliten aus Mainz und Köln noch nicht endgültig entschieden war.

Am 23. Juni 1298 proklamierten die Kurfürsten Albrecht zu ihrem neuen König. Jenen Sohn Rudolfs I., den sie sechs Jahre zuvor die Wahl verweigerten und sich stattdessen für Adolf von Nassau entschieden. Seiner Erhebung ging zunächst kein förmlicher Wahlvorgang voraus. Man einigte sich auf Albrecht und ernannte ihn in aller Schlichtheit, ohne die üblichen Formalitäten. Ein Bruch aller überlieferten Traditionen. Die Absetzung eines an Geist und Körper gesunden Reichsoberhaupt, war ein weiteres Novum in der Reichsgeschichte. Auch wenn unter den beteiligten Fürsten bei der Abwahl Adolfs mehrheitlicher Konsens herrschte, nur der Wittelsbacher Pfalzgraf bei Rhein war dagegen, hatte der abgesetzte König noch immer Anhänger und Mittel im Reich. Adolf von Nassau sammelte seine ihm loyal gebliebenen Anhänger und rüstete sich zum Kampf gegen den habsburgischen Usurpator. Er stand bereits mit einem Heer im Feld gegen Albrecht, der kurz vor den umstürzlerischen Ereignissen die Waffen gegen den schwankenden König erhoben hatte. Aus einem geplanten Prozess gegen den Habsburger Aufrührer und Friedensstörer, wurde letztlich Absetzungskonvent. Die Kurfürsten, obwohl Auslöser des aufziehenden Konflikts, blieben neutral und ließen der Sache ihren Lauf. Es mag ein bezeichnendes Licht auf die zunehmend autonom agierenden Wahlfürsten und ihren wachsenden Anspruch auf Teilhabe an der Regentschaft des Reichs werfen. Während sie im Zuge anstehender Wahlen ihre Stimmen gegen allerlei Zugeständnisse hergaben, und damit die eigene Machtstellung fortlaufend ausbauten, insbesondere was die vier weltlichen Fürsten betraf, verhielten sie sich bei inneren Auseinandersetzungen zurückhaltend, zumal bei Thronstreitigkeiten. Ausnahmen gab es immer dann, wenn persönliche Interessen eine Intervention rechtfertigten. Durch die Neutralität der Kurfürsten war die Gefahr eines lang anhaltenden, innerdeutschen Krieges, der zu reichsweiten Flächenbrandes ausarten konnte, zumindest gemindert. Die Konflikte blieben in der Mehrzahl lokal und meistens zeitlich begrenzt. Der Autonomieanspruch der Kurfürsten bildete ein Gegengewicht zum regierenden Herrscherhaus an der Spitze des Reichs, wodurch sich ein Instrument der Machtbalance herausbildete, das einer wirksamen königlichen Zentralgewalt entgegenwirkte. Wir werden auf die besonderen Privilegien der Kurfürsten, zu denen als wichtigstes Recht, jenes zur Königswahl gehörte, im nächsten Buch ausführlicher eingehen. An dieser Stelle würde es zu weit in die Zukunft vorgreifen.

Adolf suchte zum Erhalt seiner Krone die Entscheidung auf dem Schlachtfeld. Auf einen langen Krieg konnte er sich nicht einlassen. Im direkten Vergleich war der Nassauer dem Habsburger auf Dauer weit unterlegen. Albrecht verfügte über die weit größeren Machtmittel. Noch konnte Adolf als gerade erst entmachteter Monarch auf eine Reihe Verbündeter zurückgreifen und das mobilisierte Heer in einem schnellen Feldzug gegen den rebellischen Thronräuber führen. Schnelles und erfolgreiches Handeln war in seiner Situation unerlässlich. Je länger wirksame Gegenmaßnahmen aufgeschoben wurden, umso deutlicher hätten sich die Kräfteverschiebungen zu seinen Ungunsten bemerkbar gemacht. Ein schneller und erfolgreicher Schlag gegen die süddeutschen Besitzungen Albrechts war dazu geeignet, das Übergewicht der habsburgischen Hausmacht zu relativieren. Sollte er in der Schlacht erfolgreich gegen den Usurpator bleiben, köme es in der Wahrnehmung der Zeit einem Gottesurteil gleich. Unter diesen veränderten Voraussetzungen hätte sich unter den Kurfürsten das Kräfteverhältnis gegebenenfalls wieder zu seinen Gunsten umverteilt. Der Kurfürst und Pfalzgraf zu Rhein stand ohnehin an seiner Seite. Ein erstaunlicher Umstand, immerhin war es jener Pfalzgraf, der vor der Wahl Adolfs zum König, im Mai 1292, als Schwager Albrechts zu dessen engsten Anhängern gehörte, und der Wahl Adolfs nur unter dem Druck der anderen Fürsten nachgab.
Wie sah es am Vorabend des Thronkriegs mit den anderen Kurfürsten aus, behielten sie tatsächlich eine neutrale Haltung bei? Ja, nur der Pfalzgraf stand wie mit seinen Kontingenten im Heer Adolfs, sonst überließen die anderen den Ausgang des Waffengangs ganz den streitenden Kontrahenten. Der brandenburgische Kurfürst Otto IV. war ohnehin viel zu sehr in den Erbfolgekrieg um das Herzogtum Pommerellen verwickelt, als dass er eine aktive Rolle spielen wollte oder konnte und es tat sich ein weiterer Kriegsschauplatz auf, doch dazu später mehr. Seit Generationen war er wieder der erste brandenburgische Regent, der den Reichsangelegenheiten vermehrt seine Aufmerksamkeit schenkte. Der Herzog von Sachsen-Wittenberg, askanischer Verwandter Ottos, verhielt sich ganz so, wie es der böhmische König Wenzel II. vorgab, dem er sich vertraglich verpflichtet hatte. Wenzel konzentrierte sich zu der Zeit weiestgehend auf den Osten, auf Polen, wo er um das Herzogtum Kleinpolen stritt. Die Vorgänge im Reich beachtete er nicht unbedingt aus der Distanz, so doch aber nicht mit voller Aufmerksamkeit. Wenn sich der Habsburger Rivale mit dem alten König schlug, konnte ihm das im Grunde nur recht sein. Für Adolf hing also alles von einem durchschlagenden Erfolg seiner Waffen ab. Als Sieger über Albrecht konnte er wenigstens hoffen den böhmischen König wieder für sich gewinnen. Bei einer erfolgreichen Restauration seines Throns, war es immerhin denkbar, sogar wahrscheinlich, dass er dem habsburgischen Rebellen die Reichslehen in Österreich und der Steiermark entzog, zumindest formell und sie stattdessen Wenzel in Aussicht stellte, der sich diese dann freilich erst gegen Albrecht militärisch erstreiten müsste, wodurch Adolf zwei Fliegen mit einer Klappe schlüge. Ob der böhmische König sich abermals ködern lies, war höchst unsicher, immerhin waren die erwähnten Lehen bereits einmal Teil seines Wahlversprechens anlässlich der eigenen Königswahl vor sechs Jahren. Würde er anderseits den mächtigsten der Kurfürsten und Kopf der Kurfürstenopposition für sich gewinnen können, wäre schnell mit einem Stimmungsumschwung zu rechnen. Die österreichischen Lehen wären unter diesen Bedingungen ein akzeptabler Preis. Die Chancen dass Wenzel einwilligte, standen offen gesagt schlecht, denn Wenzel hatte nicht vergessen, wie wenig das Wort des abgesetzten Königs in der Vergangenheit wert war. Adolf hatte aber keine Optionen, alles hing von einer frühen und entscheidenden Begegnung auf dem Schlachtfeld ab.
Herzog Albrecht war militärisch keineswegs unvorbereitet, wir deuteten es an. Schon vor seiner Proklamation zum König drängte ihn der Erzbischof von Mainz Adolf entgegen zu treten, worauf Albrecht die Waffen gegen den zu dieser Zeit noch amtierenden König erhob. Als Adolf von den Vorgängen rund um seine Absetzung erfuhr, stand er mit seinen Truppen am Oberrhein, wo es zu einzelnen Scharmützeln mit Albrechts Truppen gekommen war, ohne dass diese die Waage auf die eine oder andere Seite zum Ausschlag brachten. Nach einigen Tagen des Taktierens, Albrecht operierte sehr vorsichtig und ging zunächst einer Schlacht aus dem Weg, trafen sich beide Heere bei Göllheim, rund 20 Kilometer südlich von Alzey, das er zuvor erfolglos belagerte.
In den Morgenstunden des 2. Juli 1298 begann die unvermeidliche Schlacht, die sich über Stunden, bis in den frühen Nachmittag äußerst blutig hinzog. In drei Wellen, sogenannten Treffen, prallten die Schlachtreihen nacheinander zusammen, ohne eine absehbare Entscheidung herbeizuführen. Albrecht hatte auf einem Hügel, dem Hasenbühl, eine vorteilhafte Stellung eingenommen, den die Adolfs Kräfte, verstärkt mit Kontingenten aus Franken, der Rheinpfalz, Bayern und dem Elsass mit größter Erbitterung berannten. In der dritten Welle griff Adolf persönlich in das Geschehen ein. Ungestüm in die dichten Reihen preschend, wurde er im Nahkampf vom Pferd gestoßen und von einer Gruppe Angreifer getötet. Sein Tod leitete die Niederlage ein. Teile seines Heeres begannen sich abzusetzen und aufzulösen, während andere Teile, in Unkenntnis der Lage, zunächst mit aller Zähigkeit weiterkämpften. Der Ausgang der Schlacht, allem voran der Tod Adolfs, wurde allgemeinhin als das erwähnte Gottesurteil betrachtet. In dieser Hinsicht behielt der gefallene König recht. Die Partei des alten Königs brach im Reich unmittelbar zusammen, Albrecht war jetzt unangefochten.
Am 27. Juli 1298 fand seine offizielle Wahl in Frankfurt statt, gefolgt von der feierlichen Krönung in Aachen am 24. August 1298. Erst die Beachtung der überlieferten Formalismen, der heiligen Riten, machten Albrecht zum König. Davor war er trotz aller politischen Rückendeckung der Kurfürsten, nur ein Thronusurpator. Trotz einvernehmlicher Wahl, blieben die rheinischen Kurfürsten dem Habsburger gegenüber reserviert, telweise gegnerisch eingestellt und das Verhältnis zum böhmischen König verfinsterte sich ebenfalls bald wieder. Der Gegensatz von Přemysliden und Habsburgern blieb dauerhaft gesehen unüberwindlich. Auslöser war Albrechts erster Reichstag am 11. November 1298, der traditionell in Nürnberg abgehalten wurde. Seit Kaiser Friedrich II. sah das Reich keinen prächtigeren, keinen besser besuchten Hoftag. Alle sieben Kurfürsten waren versammelt, darunter Markgraf Otto IV. von Brandenburg, und auch Hermann, der Sohn seines Vetters Ottos V., dem langjährigen Rivalen aus der Ottonischen Linie. Daneben waren mehr als 70 weitere hohe weltliche wie geistliche Reichsfürsten zugegen, 300 Grafen und Herren sowie rund 5.000 Vertreter des niederen Adels. Ein allgemeiner Landfriede wurde beschworen. Daneben war die Krönung seiner Frau Elisabeth am 16. November einer der festlichen Höhepunkte. Am Folgetag fand ein großes Königsmahl nach alter Sitte statt, anlässlich dessen die Kurfürsten ihre Hochämter auszuüben hatten. Nacheinander ritten mit großem Zeremoniell der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf bei Rhein und der Herzog von Sachsen ein, um ihre Erzämter zu verrichten. Allein, es blieb der böhmische König als der vornehmste unter den weltlichen Amtsinhabern aus. Er schickte stattdessen vier Abgeordnete den Dienst zu verrichten. Eine Missachtung der Majestät des neuen Königs, der gekrönt an der Tafel saß. Albrecht ließ ungehalten nach ihm schicken, worauf ein Bote die Nachricht überbrachte, der König sei in der Nacht erkrankt und unpässlich, er wolle ihm stattdessen seinen Sohn schicken. Albrecht drohte mit Entzug seiner Reichslehen, sollte er nicht unverzüglich persönlich erscheinen und ihm, dem Haupt des Reichs, den symbolischen Dienst an der Tafel leisten. Nun kam der König Böhmes in all seiner Pracht, die Krone Böhmens auf dem Haupt und in Begleitung einer großen Zahl seiner Vasallen. Der ganze bisherige Akt des Ausbleibens einerseits, und der Härte Albrechts, in dem er auf Erscheinen Wenzels bestand, war eine Machtprobe. Erschreckende Parallelen zu den Vorkommnissen der Väter, als Ottokar II. von Böhmen schon einmal die Macht eines römisch-deutschen Königs auf die Probe stellte. Rudolf von Habsburg demütigte ihn damals vor den Großen des Reichs. Sollte es auch in dieser Generation ein weiteres Mal zu einem Dürnkrut kommen?
Wenzel II. fügte sich und verrichtete nach der überlieferten Weise den Dienst des Erzschenks. Markgraf Otto reichte ihm dazu als Erzkämmerer einen goldenen Pokal, den der König von Böhmen mit Wein gefüllt dem römisch-deutschen König in zeremonieller Weise reichte. Das Verhältnis beider Fürsten war seit Nürnberg, wenn nicht zerrüttet, so doch erheblich gereizt und der Gegensatz beider Häuser ging in eine neue Runde.
Krieg in Mecklenburg, Pommern und Pommerellen
Der Kampf um das verwaiste Herzogtum Pommerellen mit dem Herzogtum Großpolen lief schon seit dem Jahr 1295. Der gewaltsame Tod Przemysłs II. Februar 1296 und das entstandene Machtvakuum, stiftn in Großpolen einige Zeit Chaos, den die Markgrafen Otto IV., Konrad I. und Albrecht III. zu ihren Gunsten ausnutzen konnten um verheerend in Posen und Pommerellen einzufallen und wichtige Grenzburgen einzunehmen. Przemysłs Nachfolger Bolesław II., genannt der Kühne, gleichzeitiger Herzog von Kujawien, führte den Konflikt fort, war aber gleichzeitig im Krieg mit König Wenzel II. von Böhmen um das Herzogtum Kleinpolen. Es ging um die Krone Polens. Um gegenüber den Brandenburgern eine Entlastung zu erreichen, gewann er durch geschickte Diplomatie Herzog Bogislaw IV. von Pommern-Wolgast, Halbbruder des jungen Herzog Otto I. von Pommern-Stettin, mit dem Brandenburg immer wieder in Grenzkonflikten verwickelt war. Bogislaw war ebenfalls am Erbfolgekrieg um Pommerellen beteiligt und wollte ein Stück des Kuchens für sich erhaschen. Er schwenkte jetzt ganz auf die Linie Polens ein, von wo er Zusagen bezüglich etwaiger Eroberungen in Hinterpommern erhielt. Er fiel 1298 sengend und raubend in die angrenzende Neumark und die Uckermark ein. Es war sie Zeit wo Otto IV. stark in die Reichsangelegenheiten verwickelt war. Wir erinnern uns, im Juni wurde König Adolf von Nassau in Mainz abgesetzt und stattdessen Albrecht von Habsburg zum Nachfolger ernannt. Fast das ganze Jahr war Markgraf Otto IV. eingebunden. Polen sowie Pommern-Wolgast wüteten derweil fast ungebremst. Vor allem die neumärkischen Landschaften Arnswalde und Bernstein waren davon betroffen, sie kurz davor durch Kauf von der Ottonischen Line zum Johanneischen Zweig übergegangen waren. Viele Bewohner des Landes wurden weggeführt und teilweise bis nach Zentralpolen verschleppt, wo sie als Leibeigene auf den Landgütern des Adels gehalten wurden. Zum Winter hin ebbten die Übergriffe ab und es kehrte eine trügerische Ruhe in diesen Kriegsschauplatz ein. Doch schon tat sich in Mecklenburg ein neuer Konflikt auf.
Das alte Mecklenburg war wie die Gegenden der späteren Mark Brandenburg, seit dem Frühmittelalter slawisch besiedelt. Rund vier Jahrzehnte nachdem in Brandenburg die Kolonisierung einsetzte, begannen auch in diesen Gegenden mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts deutsche Siedler einzuwandern. Sie kamen aus den gleichen Gegenden, aus denen auch die Markgrafen von Brandenburg ihre Siedler rekrutierten, aus Holland, Friesland, West- und Ostfalen, dem heutigen Niedersachsen, aus Flandern und teilweise auch aus dem benachbarten Holstein, das seinerseits noch Kolonialland war. Mecklenburg war seit dem Tod Heinrich Borwins II. im Jahre 1226 in vier unabhängige Herrschaften geteilt. Heinrich Borwin II. war ein Urenkel des berühmten heidnischen Abodritenfürsten Niklot, über den wir in Kapitel II. berichteten. In der sogenannten Mecklenburgischen Hauptlandesteilung entstanden neben der Teilherrschaft Mecklenburg, die Herrschaften Werle, Parchim und Rostock, die von je einem der Söhne Borwins regiert wurden. In Rostock herrschte seit 1284 Nikolaus, der den Beinamen das Kind trug, da er in unmündigem Alter das Fürstentum erbte. Auf Betreiben seines Vaters Waldemar, wanderten aus der Herrschaft Mecklenburg mehrere Adelsfamilien ein, die seither zunehmenden Einfluss am Hof bekamen, darunter zuvorderst die Familie Moltke. Nikolaus stand stark unter dem Einfluss dieser Familie, die nach und nach verschiedene strategische Hofämter besetzte und wo Johann Moltke die Regierung während seiner Unmündigkeit führte und selbst darüber hinaus. Unter dem alteingesessenen Adel regte sich wegen der Dominanz fremder Adelshäuser der Unwille, so dass sich eine starke Opposition bildete. Zwei Parteien entstanden, jene um Johann Moltke, die andere um das Geschlecht derer von Schnakenburg. Nikolaus nicht Herr im eigenen Haus, lavierend und getrieben, stand zwischen den Stühlen, versuchte zu vermitteln und war doch Spielball der konkurrierenden Fraktionen. Beide Seiten suchten Verbündete außerhalb des Landes, die Schnakenburgs bei den Brandenburgen der Ottonischen Linie, die Moltkes in Dänemark, bei König Erich VI. Menved. Die Schnakenburgs machten einen Vorstoß, indem sie den noch unvermählten, jetzt schon Ende 30-Jährigen, mit dem Brandenburger Haus verbinden wollten. Dort tat sich eine Gelegenheit auf, indem sie ihm Margarete vorstellten, die kinderlose askanische Witwe des im Februar 1296 verstorbenen, kurzzeitigen polnischen Königs Przemysł II., die tatsächlich sein Interesse weckte, denn 1298 erfolgte wohl die Verlobung. Ein schriftliches Zeugnis liegt nicht vor, doch nennt ihn Markgraf Albrecht III. in einer noch erhaltenen Urkunde vom 15. Mai 1298, ausgestellt in zu Soldin in der Neumark, seinen Schwiegersohn. Zur Auffrischung der Erinnerung, Margarete war eine Tochter Markgraf Albrechts III. aus der Ottonischen Linie Brandenburgs. Bereits Albrechts erste Tochter Beatrix war seit 1292 mit Heinrich II. verheiratet, dem Herrn zu Mecklenburg. Die sich jetzt anbahnende Doppelverbindung ins Mecklenburgische passte in das seit Generationen existierenden brandenburgische Bestreben nach einem Zugang zur Ostsee. Ein Wermutstropfen blieb, der augenscheinlich charakterlich unfeste Nikolaus war bereits mit der Tochter des Grafen Günther von Lindow-Ruppin verlobt, die er nun ohne Nennung von Gründen sitzen ließ. Die Herrschaft Ruppin hatte der zu einer Nebenlinie der Arnsteiner Grafen gehörende Günther von Markgraf Johann II. als brandenburgisches Lehen erhalten. Weil es mit Verlobungen noch nicht genug war, verband er sich bald auf Vermittlung Wizlaws III., des Fürsten von Rügen, mit der Tochter Herzog Bogislaws IV. von Pommern-Wolgast, dem Verbündeten Polens und Feind Brandenburgs. Bogislaw selbst war mit einer Schwester des Herren von Rügen verheiratet. Diese dritte Verlobte ehelichte Nikolaus dann tatsächlich. Brandenburg, hier beide Linien gleichermaßen, nahmen die erlittene Kränkung zum willkommenen Anlass, dem wortbrüchigen Nikolaus zu Leibe zu rücken. Behalten wir im Sinn, die Markgrafen suchten mit allen Mitteln den Zugang zur Ostsee, ein Feldzug gegen den ehrlosen Herren von Rostock schien ein probates Mittel diesem Ziel näher zu kommen, zumal sich mit Heinrich II. von Mecklenburg, der Schwiegersohn Markgraf Albrechts III., ebenso anschloss, wie das Haus Werle. Nikolaus von Rostock war gegen die noch im Herbst 1299 einfallenden Scharen seiner Gegner völlig unvorbereitet. Vom Schwiegervater aus Pommern kam keine wirksame Unterstützung. Man staunt über sein mangelndes Feingefühl und fehlende politische Weitsicht. Kurz vor Einbruch der Frostperiode, der Winter kam in jenem Jahr früh über das Land, ersuchte die Stadt Rostock ohne Abstimmung mit ihrem Landesherren um Frieden. Unter Verhandlungsleitung Alverichs von Schnakenburg und Cord Rensow, wurde ein Separatfrieden vereinbart, wofür die Stadt 5.000 Mark Silber Entschädigung leisten musste. Und auch das umliegende Land konnte sich mit fünf Mark pro bebauter Hufe freikaufen. Lange nicht befriedigt, gingen die Angreifer weiter nach Silz, hart an der Grenze zur brandenburgischen Prignitz, wo das ganze Land bis zur Höhe Gnoien verwüstet wurde. Der Winter brach nun mit starker Kälte herein, ganz im Sinne der Markgrafen, denn sie hatten auch mit dem Herrn zu Rügen, mit Wizlaw III., der das brandenburgische Eheprojekt erfolgreich hintertrieb, eine Rechnung zu begleichen. Über die sonst unwegsamen, mittlerweile gefrorenen Sumpflandschaften im nördlichen Mecklenburg, kamen die Reitertrupps mit Leichtigkeit voran. Die gesicherten, wenigen guten Wege im Rügener Vorland, das keineswegs nur auf die Insel Rügen selbst beschränkt war, wurden umgangen und der Rügener Festlandsteil nach Belieben heimgesucht. Die Zeche zahlten wieder die kleinen Leute. Es wurde mitgenommen, was wegzuschaffen war, alles andere niedergebrannt. Wer dem entgehen wollte, musste Brandschatzung zahlen. Wer bezahlte, wurde verschont. Den Plündertrupps war das lieb, es sparte Zeit, umso schneller konnten sie weiterziehen und andernorts ihr Werk fortsetzen, auch liefen sie weniger Gefahr von gegnerischen Einheiten gestellt und beim plündern niedergemacht zu werden. Im Gegensatz zu Nikolaus von Rostock, stellte Wizlaw von Rügen eine Truppe unter dem Kommando Bogislaws von Dewitz auf. Sie konnte den zahlenmäßig weit überlegenen Brandenburgern zwar nicht gefährlich werden, waren den einzel operierenden Trupps doch aber immerhin so lästig, das man genötigt war Bogislaw zu stellen. Die hoffnungslos unterlegenen Rügener verkauften ihre Haut teuer, doch es nützte am Ende nichts, sie wurden alle niedergemacht. Auf die Insel Rügen selber wagten sich die Brandenburger nicht, sie hätten hierzu auch nicht die Mittel, das heißt den notwendigen Schiffsraum besessen und sowieso keinen Hafen. Im Konzert der zu Bestrafenden fehlte der Herzog aus Pommern-Wolgast. Nicht genug, dass dieser sich im Erbstreit um Pommerellen auf die Seite Polens geschlagen hatte, seine Tochter war wie wir sahen, nach der Einmischung Wizlaws III. von Rügen nun mit Fürst Nikolaus von Rostock verheiratet. Das ereignisreiche Jahr 1298 war noch während des Feldzugs gegen Rügen zu Ende gegangen. Für den Moment befriedigt, ging man zur Waffenruhe über, die Vasallen wurden nach Hause entlassen, das Kriegsvolk aufgelöst. 1299 wurde gegen das noch ausstehende Pommern-Wolgast gerüstet. Was bei Licht betrachtet den größten Ausschlag zum Feldzug gab, ob es die gekränkten brandenburgischen Heiratsabsichten waren, die Fortführung der seit Generationen andauernden Frage nach der Brandenburger Lehnsoberhoheit, oder doch die Parteinahme Herzog Bogislaws IV. für den polnischen König Władysław I. Ellenlang, dem vormaligen Herzog von Kujawien und Nachfolger des getöteten Przemysl II. in Großpolen, um das Herzogtum Pommerellen, sei dahingestellt. Gründe gab es aus Sicht Brandenburgs genug. Bogislaw stellte sich den Angreifern mit seinen Truppen entgegen, es kam zur offenen Feldschlacht, bei der der Herzog verwundet in brandenburgische Hände fiel und erst gegen Zahlung eines hohen Lösegelds wieder auf freien Fuß kam. Die Niederlage warf Pommern-Wolgast im Erbstreit um das östlich angrenzende Herzogtum für den Moment aus dem Rennen. Brandenburg konnte aus der Konfliktserie, an deren Anfang ein nichterfülltes Rostocker Eheversprechen stand, glänzend Profit schlagen und seine Kassen füllen. Wahrscheinlich wurde der sukzessive Ankauf der Niederlausitz aus den Erlösen des bisherigen Krieges bestritten worden.
Am 24. November 1299 wurde mit der Herrschaft Rostock Frieden geschlossen. Die Bürger der Stadt Rostock lehnten sich jedoch gegen die harten Bedingungen, zu denen jene oben genannten Zahlungen gehörten, die nun fällig wurden, gegen den Rat der Stadt auf und nahmen die Bürgermeister fest. Fürst Nikolaus, er wird in älteren Chroniken auch Niclot genannt, gab dem Drängen des aufgebrachten Pöbels nach und Widerrief die beurkundeten Zusagen gegenüber Brandenburg. Da er den Zorn der Markgrafen fürchten musste, warf er sich Dänemark in die Arme, gab sein Land König Erik VI. und nahm es von ihm als Lehen wieder entgegen. Der wort- und vertragsbrüchige Herr von Rostock bewies abermals einen beklagenswerten Mangel an Weitsicht, denn Erik von Dänemark verfolgte eigenen Ziele. Er landete an der Spitze eines Heeres in Warnemünde, das er umgehend befestigen ließ. Östlich von Rostock, das dem König den Zugang erfolgreich verweigerte und seine Tore verschlossen hielt, gründete er einen neuen Ort. Erik begann sofort, zum Verdruss der Bewohner des Landes, die den Unterhalt seiner Truppen zu bestreiten hatten, hoheitliche Rechte auszuüben. Nikolaus war durch eigene Schuld zur Marionette heruntergekommen. Die Anwesenheit der Dänen auf dem Festland, war ein Alarmsignal für die gesamte mecklenburgische Region. Es formte sich eine antidänische Koalition aus dem Herzog von Pommern-Stettin, den brandenburgischen Markgrafen, des Weiteren aus Heinrich II. von Mecklenburg, den Herren zu Werle, dem Bischof und den Grafen von Schwerin, sowie dem Herzog von Sachsen-Lauenburg. Aus der Gegend von Gnoien wurden die Feindseligkeiten der Allianz begonnen. Ziel war die dänische Besatzungsmacht an einer weiteren Entfaltung und Annexion des Landes zu hindern. Den halbherzigen Versuchen war kein Erfolg beschieden, die Übermacht der erlesen ausgesuchten dänischen Kriegsleute war zu groß. Dänen und Koalitionstruppen plünderten in der Folgezeit das Land gleichermaßen aus, unwillig die jeweilige Gegenseite ernsthaft militärisch anzugehen. Der Krieg, der keiner war, dümpelte auf diese Weise dahin. Ende des Jahres 1300 kehrte König Erik VI. unter Zurücklassung starker Garnisonen nach Dänemark zurück, um von dort eine passende Gelegenheit abzuwarten, die Stadt Rostock doch noch zu unterwerfen. Die gegen Erik VI. von Dänemark gerichtete Allianz löste sich nach seiner Abreise auf, doch war der Konflikt deswegen nicht beigelegt.
Verlassen wir vorerst diese Episode aus der langen Reihe brandenburgischer Fehden und Kriege während der Regentschaft Markgraf Ottos IV. und seiner Brüder und Neffen. Dabei wurden im zurückliegenden Abschnitt nicht einmal alle erwähnt.
Otto IV., Konrad I. & Heinrich I.
Kehren wir in die Mark zurück. Schon nach dem Tod des ältesten Bruders Johann II., war Konrads Status als mitregierender Landesfürst weiter gestiegen. Auch davor fristete er kein Schattendasein, wie wir in den zurückliegenden beiden Kapiteln gelesen haben. Bruder Otto IV. war als ältester noch lebender Erbe ihres Vaters in Brandenburg mittlerweile als eine Art Seniorregent tätig. Die dominante Rolle nahm noch zu, seit in der Ottonischen Linie Vetter Otto V., sein langjähriger Rivale, ebenfalls dahingeschieden war. Sein verändertes Rollenverständnis tat dem Verhältnis zu Konrad keinen Abbruch, beide standen sich politisch und, so schien es, auch sonst sehr nahe. Sie unterhielten eine gemeinsame Hofhaltung, so dass Konrads Kinder zum Onkel, dem geübten Turnierkämpfer, Haudegen zahlreicher Schlachten und bekannten Minnesänger, von kleinauf engen Kontakt hatten. Gemeinsame Hofhaltung bedeutete freilich nicht, dass die Markgrafen samt ihren Familien fest und dauerhaft an einem Ort verbrachten. Noch war es üblich und notwendig, innerhalb des eigenen Herrschaftsgebiets von Burg zu Burg und Stadt zu Stadt zu reisen, dort eine Weile zu verbringen um die Angelegenheiten der Region zu regeln, um dann weiterzuziehen. Die Frauen und Kinder waren dabei nicht ständig mit den Männern unterwegs, selbst nicht in Friedenszeiten. Sofern sich der Hof länger an einem Ort aufhielt, kamen sie von ihrem bisherigen Aufenthaltsort nach, besonders zu den großen Feiertagen. Die Frauen hielten sich gewöhnlich in den größeren Burgen des Landes auf, welche über mehr Komfort verfügten, wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt davon sprechen darf, denn das Leben auf einer derartigen Anlage war selten genug besonders angenehm. Für den Burghauptmann oder Vogt und seine Familie, sofern diese mit auf der Burg wohnte, bedeutete der Besuch des markgräflichen Hofs, dass er seine Gemächer, die besten auf der Burg, zu räumen hatte, um sie den erlauchten Herrschaften für die Zeit ihrer Anwesenheit zu überlassen. Ein rollender Umzug der ganzen Burgbesatzung war die Folge. Ließen es die Witterungsbedingungen zu, lebte der Hof unter dem Schutz einer Wehranlage lieber in Zelten, als in den beengten Räumlichkeiten einer Festungsanlage. Zur mitunter zahlreichen Begleitung des fürstlichen Hofs gehörten neben einer unterschiedlich großen militärischen Begleitung, vor allem die engsten Hofbeamten, Truchsess, Schenk, Kämmerer, Kanzler, der Hofnotar sowie mehrere Schreiber, sofern sie nicht aus der näheren Umgebung herangezogen wurden, der Koch und seine Gehilfen und sonstige Funktionäre und Bedienstete. Man wird es sich vorstellen können, schnell wurde es eng und unglücklich war man selten, wenn der Landesherr weiterzog. Für die Versorgung hatte der Vogt zu sorgen, dem ansonsten die Einkünfte des ihm anvertrauten Gebiets anteilig zukam. In einzelnen Städten hatten die brandenburgischen Markgrafen eigene Besitzungen, oft schlicht Markgrafenhöfe genannt. Sie dienten auf den Reisen als Domizil in den Städten und waren beliebter als Burgaufenthalte. Existierte kein eigener Besitz in einer Stadt, wurde der Landesherr in den besten Bürgerhäusern einquartiert und sein Gefolge auf die Stadt verteilt. Die Versorgung des Hofs mit allem Notwendigen übernahm zunächst die Stadt, doch bezahlte der Landesherr die Ausgaben bevor er abreiste, was oft genug, wegen klammer Kassen, die Weiterreise mitunter erheblich verzögerte. In dieser und anderer Hinsicht war das Reiseleben eines Landesfürsten nicht anders, als das des königlichen oder kaiserlichen Hofs. Wenngleich bestimmte Städte und Burgen in der Mark bevorzugt und immer wieder von den jeweiligen Landesfürsten beider Hauptzweige besucht wurden, und sich hier eine gewisse Gewohnheit einstellte, bildete sich trotzdem kein ausgesprochener Verwaltungsschwerpunkt heraus. Stendal, Tangermünde, Salzwedel, Spandau, Frankfurt an der Oder, Prenzlau, natürlich Brandenburg an der Havel oder Berlin und andere Städte, waren zu dieser Zeit gleichauf. Gemessen an den Residenzen anderer Reichsfürsten, nahmen sie sich für gewöhnlich klein aus, von vielen Reichsstädten, darunter Nürnberg oder Lübeck, ganz zu schweigen. Die schiere Ausdehnung der Mark, die relativ kurze Existenz vieler Landesteile, je weiter nach Osten, je jünger, förderte keine Entstehung einer zentralen Metropole und die Markgrafen legten, genötigt von der Natur der Landesteilung, und den notwendigen Reiseaufwendungen drauf kein Augenmerk. Am Hof lebte auch noch Halbbruder Heinrich, aus der jüngeren Johanneischen Linie stammend. Sein Vater Johann I. war in zweiter Ehe mit Jutta von Sachsen verheiratet, der Mutter Heinrichs. Wir hörten bislang wenig über ihn, sein Refugium lag ursprünglich im Havelland. Er heiratete 1303 erst sehr spät und wollte jetzt, nachdem sich der erste Nachwuchs ankündigte, eine eigene Hofhaltung. Seine Gattin Agnes kam aus Wittelsbacher Hause und war eine Tochter Ludwig II. des Strengen, dem Herzog von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein. Möglicherweise kamen Impulse zur Separierung des bisherigen Hofs von Agnes, wahrscheinlich waren aber fünf regierende Markgrafen, die Brüder Otto IV. und Konrad I., sowie dessen Söhne Johann V. und Waldemar I., dem Frieden einfach abträglich, zumal ganz profane Platznöte eine wichtige Rolle gespielt haben dürften. Es kam zur Neuverteilung der Johanneischen Besitzungen. Per Los fiel Heinrich die Mark Landsberg samt der Pfalzgrafschaft Sachsen zu. Heinrichs Beiname „ohne Land“ war spätestens jetzt unangemessen, und selbst davor unerklärlich, denn seine Halbbrüder hielten ihm keinen Anteil am väterlichen Erbe vor. Seither sehen wir ihn in Urkunden als einen Markgrafen von Landsberg siegeln und auch die Schriftstücke der königlichen Kanzlei bezeichnete ihn fortan als solchen.
Konrads Söhne
Sobald Konrads Söhne ins mündige Alter kamen, was nach sächsischem Recht mit 12 Jahren erfolgte, sahen wir auch sie auf Urkunden unterzeichnen und damit als Regenten mitwirken, wenn auch unter strenger Regie des Vaters und mehr noch, des Onkels. Wir konzentrieren uns im Anschluss auf Waldemar, den jüngsten der drei Söhne Konrads. Waldemars erste nachweisliche Handlung als mitregierender Markgraf fand am 23. April 1303 zu Liebenwalde statt. Gemeinsam mit seinem Onkel Otto IV., sowie Konrad seinem Vater und Johann, seinem älteren Bruder, war er bei der feierlichen Stadtgründung von Arnskrone beteiligt. Später war die Stadt als Deutsch Krone (polnisch: Wałcz) bekannt. Die Landschaft im nordöstlichen Grenzgebiet der Neumark war Ende des 13. Jahrhunderts im Rahmen des noch nicht entschiedenen Erbfolgestreits vom Herzogtum Großpolen an die Johanneische Linie gefallen. Teile der Landschaft gehörten seit 1249 dem Templerorden. Die Stadtgründung mit der die Ritter Ulrich von Schöning und Rudolf von Liebenthal beauftragt wurden, diente der Erschließung und Hebung der Gegend und der militärischen Absicherung gegen Polen, wozu das nahegelegene Schloss Doberiz den Kern bildete. Die zukünftige Stadt wurde großzügig mit 208 Hufen Land, rund 3.500 Hektar, zwei Mühlenstellen, sowie zwei Seen bedacht und auf 16 Jahre von allen Abgaben an die landesherrliche Regierung befreit.
Die Urkunde ist für uns von großem Interesse, denn wir glauben daraus das voraussichtliche Geburtsjahr des jungen Markgrafen herleiten zu können. Die vorgenannte Urkunde wurde unter großer Anteilnahme des neumärkischen Lehnsadel ausgestellt. Zahlreiche Ritter werden darin namentlich als Zeugen aufgeführt, weitere Anwesende nicht näher namentlich erwähnt. Der erstaunliche Umfang der Urkunde und Zahl der Zeugen und Teilnehmer gibt Anlass zur Annahme, dass der Akt gleichsam als offizielle Festivität anlässlich der Mündigwerdung des jungen Markgrafen Waldemar diente. Trifft dies zu, ist Waldemar mit einigermaßen großer Wahrscheinlichkeit in den ersten Monaten des Jahres 1291 geboren worden. Wäre dem so, kann Markgräfin Konstanze nicht die Mutter Waldemars gewesen sein, denn Sie starb im Oktober 1281 und ist im Kloster Chorin beigesetzt worden. Folglich müsste Waldemars Vater ein weiteres Mal geheiratet haben, andernfalls es Waldemar und eine jüngere Schwester Namens Agnes, nicht gegeben hätte. Wer war aber diese Ehefrau und Mutter? Es liegen keine Zeugnisse vor, die uns darüber Aufschluss geben könnten. Vielleicht gibt die Wahl von Waldemars Namen einen wichtigen Hinweis. Waldemar war keiner der traditionellen Namen die bei den brandenburgischen Askaniern Verwendung fanden, wo ein halbes Dutzend Johanns, noch mehr Ottos, drei Albrechts etc., die Spitzenreiter waren. Mit Erich, der jüngere Bruder von Waldemars Vater, kam erstmals ein Name aus der mütterlichen dänischen Linie in die Namensreihe der märkischen Markgrafensöhne. Neben Erich (dänisch Erik), war Waldemar ein traditioneller Name der dänischen Könige. Führt man sich darüber Hinaus Waldemars enges späteres Verhältnis zum dänischen König Erik VI. vor Augen, über das wir noch berichten werden, drängt es sich geradezu auf, dass Konrad in zweiter Ehe mit einer dänischen Prinzessin verheiratet war. Der Historiker Karl Friedrich von Klöden (1786 – 1856) führt in seinem ersten Band über Markgraf Waldemar Hinweise älterer Chronisten an, die eine väterliche Verbindung mit Dänemark erwähnten, geht aber nicht näher darauf ein. In dem von ihm im Jahre 1846 herausgegebenen Werk fehlt nach eigener Aussage die genaue Kenntnis des Sterbedatum Konstanzes. Er datierte es grob vor das Jahr 1298, um seiner eigenen Schlussfolgerung Rechnung zu tragen, die sich in dieser Hinsicht mit unserer deckt, dass Waldemar im Jahre seiner ersten urkundlichen Tätigkeit 12 Jahre war. Klöden bleibt bei der Annahme, dass Konstanze die Mutter Waldemars wäre, folglich auch der Agnes, berücksichtigt aber nicht, dass die um 1245 geborene Konstanze fast unmöglich im Jahre 1291 ein weiteres Kind gebären konnte. Auch wenn die heutige Medizin Geburten bei Müttern in fortgeschrittenem Alter ermöglichen, konnte man es im Mittelalter so gut wie ausschließen. Dass sie bei der Geburt von Agnes sogar noch älter gewesen wäre, nur noch am Rande erwähnt. Wer Waldemars tatsächliche Mutter war, wissen wir nicht, glauben aber wie schon geäußert, dass sie eine dänische Prinzessin war. Schon Waldemars Großmutter, die Mutter seines Vaters, war Sophie von Dänemark, die erste Frau Markgraf Johanns I. Der dänische König Erik V. war umgekehrt mit der Tante Waldemars verheiratet, seines Vaters Halbschwester Agnes. Heiratsverbindungen mit dem mächtigen Dänemark hatten bei den brandenburgischen Askaniern seit Johann I. eine gewisse Tradition. Eine weitaus längere Heiratstradition bestand daneben mit Polen.

Waldemars Halbbruder Johann, in der Reihe der brandenburgischen Johanns der vierte mit diesem Namen, war nach seinem Großvater Markgraf Johann I. benannt. Bleiben wir bei unserer Annahme und Waldemar wurde im Frühjahr 1291 geboren, dann war der um das Jahr 1261 geborene Johann IV. gut 30 Jahre älter und zum Zeitpunkt der beschriebenen Städtegründung Arnskrones somit etwa 42 Jahre alt. Wir wissen nicht ob er im Ehestand war, und selbst wenn, blieb er kinderlos. Er überlebte den 1304 verstorbenen Vater nur um ein Jahr. Ob Johann bislang als zukünftiger Erbe Ottos IV., des Onkels, gehandelt wurde, geht nicht aus den überlieferten Zeugnissen hervor. Bruder Otto, von den späteren Chronisten als der sechste diesen Namens geführt, erschien bis 1297 auf Urkunden, trat dann aber wie schon erwähnt in den Orden der Templer ein und verfolgte fortan ein Leben als Kleriker. Dass er diesen Weg des geistlichen Lebens wählte, statt Prälat in einem Kirchenstift zu werden, schien rationalen Gründen zu folgen. Die Templer waren in Ostbrandenburg, besonders in der Neumark mit einer Reihe von Besitzungen vertreten. Der Eintritt in den Orden konnte für das beiderseitige Verhältnis nur förderlich sein. Wir wissen nicht welchen Rang er dort einnahm. Der Berliner Stadtteil Tempelhof und geht auf eine frühe Komturei der Templer zurück, die dort schon um das Jahr 1200 eine Wehranlage inmitten der Spreeslawen errichteten, lange bevor das Gebiet von den Askaniern unterworfen wurde. Otto war wahrscheinlich hauptsächlich über der Oder in Zielenzig (polnisch Sulęcin) untergebracht. 1308 trat er nach einem Jahrzehnt aus dem Orden aus, um sich wieder einem weltlichen Leben zu widmen. Er heiratete noch im gleichen Jahr, starb aber bald darauf, so dass er in der kurzen Zeit die ihm blieb, als Mitregent keine erwähnenswerte Rolle spielte.
Brandenburgisches Interdikt
Im zurückliegenden Kapitel wurden in aller Kürze die Auseinandersetzungen der Markgrafen Otto IV. und Konrad I. mit den Bistümern Havelberg und Brandenburg angesprochen. Wesentlich ging es neben der wichtigen Frage hinsichtlich der Reichsunmittelbarkeit genannter Kirchensprengel, um Fragen finanzieller Natur, so um prinzipielle Vogteirechte der Markgrafen in den Bistümern. Während sich der König und das Reich in dieser Angelegenheit neutral verhielt, standen das Erzbistum Magdeburg, die Kurie und später das Erzbistum Bremen auf der Seite der Bischöfe. Im Bistum Brandenburg ging der Streit über zwei Bischofsgenerationen, von den sich vor allem der erste, Bischof Volrad von Krempa, als der energischste Widersacher erwies und kirchenseitig die Eskalationsspirale vorantrieb. Der aus Ostholstein stammende Volrad begleitet vor seiner Wahl und Approbation zum Brandenburger Bischof im August 1296, verschiedene Stellungen als Domherr und schließlich Probst in Lübeck und Schwerin. Er kam somit nicht aus der Mark und damit keinesfalls aus dem Dunstkreis der brandenburgischen Markgrafen, die immer bestrebt waren in den jeweiligen Domkapiteln ihre Parteigänger zu platzieren, vorzugsweise aus dem Umfeld der eigenen Familie oder treuer Vasallen. Im günstigsten Fall gelang es sogar das Amt des jeweiligen Bischofs zu stellen. Bischof Volrad von Brandenburg stand also nicht in Beziehung zu den märkischen Landesherren und betrieb von Anfang an eine Politik die auf mehr, auf totale Autonomie abzielte, wodurch er mit den Interessen der Markgrafen, hier besonders den johannischen Zweig betreffend, zwangsläufig kollidierte. Otto IV. und Bruder Konrad gingen jede Konfrontation mit, und griffen schnell zu Gewaltmaßnahmen, indem sie in die Besitzungen Havelbergs und Brandenburgs einfielen und wüteten. Die Ottonische Linie, übrig war nur noch Markgraf Herrmann, Sohn Ottos V., beteiligte sich nicht an den Gewaltakten und stand mit den Kirchenfürsten in gutem Einvernehmen. Bischof Vollrad konnte wegen des Konflikts praktisch nicht auf sein Kirchengut zurückgreifen und lebte überwiegend in Magdeburg, beim Erzbischof. Mit weltlichen, das heißt militärischen Mitteln war den Markgrafen nicht beizukommen, es blieb aber die schärfste kirchliche Waffe, die Exkommunikation. Der Ausschluss aus der römischen Kirche und der Gemeinschaft der Christenheit. Dass die beiden Markgrafen ein derartiger Schritt keine Seelennot bereiten würde, ahnte man wohl. Das Kirchendruckmittel gegen unliebsame Fürsten und Rivalen, hatte viel an Schärfe verloren, es war in den zurückliegenden 200 Jahren einfach zu häufig angewandt worden, als das es noch vermochte jene Schrecken zu erzeugen, als ehedem. Das Interdikt gegen die Landschaften Ottos und Konrads sollte die einfache und abergläubige Bevölkerung zermürben. Das nahmen die Markgrafen nicht auf die leichte Schulter. Sie übten Druck auf die Klöster und Mönchsorden in ihrem Machtbereich aus, scheuten nicht offen zu drohen, erwiesen sich gleichzeitig durch Zuwendungen aber auch großzügig. Das Interdikt zeigte nicht die schnelle und gewünschte Wirkung, worauf sich die Kurie in Rom einmischte, ebenso der Erzbistum Magdeburg und für die Gebiete in der Altmark, die in den Bereich des Erzbistums Bremen fielen, auch der dortige Metropolit. Den Geistlichen der gebannten brandenburgischen Landesteilen wurde ihrerseits mit Kirchenausschluss gedroht, würden sie fortfahren, trotz Interdikt, Messen zu lesen und die Sakramente zu spenden. Langsam zeigte der aufgebaute Druck jetzt Wirkung, tatsächlich nahmen die Kirchenhandlungen ab, trotz einer neuerlichen Drohwelle der Markgrafen. Der Tod Markgraf Konrads, des jüngeren Bruders Ottos und Vater Johanns IV. und Waldemars, im Jahre 1304, brachte wieder Bewegung in die verfahrene Situation, denn wir sehen Otto IV. und seine Neffen Johann und Waldemar am 15. September 1304 zu Brandenburg an der Havel zum Zusammentreffen mit den Bischöfen. Es kam in den strittigsten Punkten zu einer Einigung, während die Lösung noch offener Punkte vertagt wurde. Durch Vermittlung Markgraf Hermanns aus der Ottonischen Linie, der ebenfalls zugegen war, kam das Treffen überhaupt erst zustande, dessen gute Kontakte zum Bistum Brandenburg hierbei wertvolle Dienste leisteten. Eine endgültige vertragliche Lösung fand am 3. Januar 1305 bei Löwenberg statt. Es kam zum Vergleich, zuerst mit dem Bischof von Havelberg, wo fünfzehn Einzelpositionen beschlossen wurden, dann mit dem von Brandenburg, wo es derer zehn waren. Brandenburg, das heißt der Johanneische Teil, leistete für die vorgenommenen Verwüstungen einen Schadenersatz von insgesamt 1.600 Mark Silber, zu zahlen in zwei Raten. Davon erhielt Brandenburg 1.000 Mark und Havelberg 600 Mark.
Da uns keine genaueren Daten vorliegen, können wir nur annehmen, dass um diese Zeit der Kirchenbann von den Markgrafen genommen wurde. Erstaunlicherweise hielten sie es nicht für notwendig, dies im Vertrag festzulegen. Andererseits hätten es sich die beiden Kirchenfürsten wohl kaum erlaubt dahingehend säumig zu sein, wollten sie den gerade erreichten Frieden nicht aufs Spiel setzen, zumal eine neuerliche Kirchenacht schnell ausgesprochen war. Damit verbundenen war selbstverständlich auch die Aufhebung des Interdikts. Markgraf Waldemar, der jetzt im Teenageralter war, hatte sich den weitaus größten Teil seines bisherigen Lebens in der Kirchenacht befunden, man darf annehmen, dass er der römischen Kirche und ihren hohen Vertretern ebenso kritisch gegenüberstand, wie Onkel und auch Vater, der in der Acht gestorben war. Die Markgrafen machten daraus kaum ein Aufheben, woraus man die schon weit fortgeschrittene Abnutzung der Exkommunikation als kirchliches Druckmittel gegen die Fürsten ersehen kann.
Als die erste Rate, die erste Hälfte der Schadenersatzsumme zu Walburgis, das heißt zum 30. April fällig wurde, konnte man eben noch das Geld zusammenkratzen. Wie immer waren den landesherrlichen Kassen klamm. Zu Michaelis, dem 29. September, stand die zweite Hälfte an und man suchte schon jetzt nach Wegen das Geld beizubringen, wozu wie immer in solchen Fällen, die Städte ihren Beitrag leisten sollten. Die Bede war in der Vergangenheit das gängige Mittel in Fällen besonderer Verlegenheit, Geld von den Städten und Ständen zu erbitten. Wir hatten über die sich dahingehend veränderten Praktiken geschrieben. Die Städte wollten sich vor den unvorhersehbaren, aus ihrer Sicht natürlich zu häufigen Beden befreien, weswegen viele der größeren Städte mit den Landesherren eine feste, jährlich zu leistende Abgabe vereinbarten, die sogenannte Or- oder Urbede. Im Falle Stendals, der damals wirtschaftlich stärksten Stadt in der Altmark, waren es beispielsweise 100 Mark Silber im Jahr. Die Markgrafen traten auch jetzt wieder an die Ratsherren von Stendal mit der Bitte um finanzielle Unterstützung heran, woraus wir erkennen, dass trotz Urbede, in einzelnen Fällen die Landesfürsten eine Bede auf klassische Weise erbaten. Den Stadtherren schien die aktuelle Notlage der geeignete Zeitpunkt, ein für alle Mal eine vertragliche Regelung zu treffen, wonach sie neben der festen Summe im Jahr, zu leisten in zwei Raten, verbindlich keine weiteren Beden aufbringen mussten. Hierfür waren sie bereit als eine Art Handel in der Höhe von 700 Mark dieses Recht von den Markgrafen zu kaufen. Am 24. Juni 1305 kam man im altmärkischen Ort Uchtdorf, heute ein Stadtteil von Tangerhütte südlich von Stendal, zur Ratifizierung des Vertrags zusammen. Neben der Befreiung von weiteren Zahlungen auf alle Zeit, außer der erwähnten Urbede, mussten die Bürger der Stadt fortan keinen Heerdienst mehr außerhalb der Mark leisten. Aus dem letzten Punkt dürfen wir mit gewisser Wahrscheinlichkeit ableiten, dass die Städte durch die vielen Kriegszüge Ottos IV. arg belastet waren. Die Art und Weise wie sich Neffe Johann, der älteste Sohn des im Vorjahr verstorbenen Konrads, und neuerdings auch Waldemar, an der Regierung beteiligten, gab berechtigten Grund zur Annahme, dass die aggressive Politik von bisher, auch in Zukunft unverändert bliebe, wogen man sich so gut es eben ging absichern wollte.
Eine gleiche Regelung fand Ende August 1305 in Werbellin zugunsten der Stadt Prenzlau statt, die sich ebenfalls mit 700 Mark von allen weiteren Beden, außer der Urbede, loskauften. Die Jahreszahlungen erfolgten auch hier in zwei Raten zu Walburgis und Michaelis. Das Abkommen der Urbede wurde mit den Markgrafen Otto IV. und Konrad bereits 1282 mit der Stadt Prenzlau geschlossen. Es bestand damit auch mit dieser Stadt schon davor einen Vereinbarung hinsichtlich des Verzichts der Markgraden auf weitere Abgaben in Form von Kriegssteuern, Schatzungen etc., und doch hielt es auch Prenzlau für notwendig, in einem feierlich und vor vielen Zeugen geschlossenen Kaufvertrag den Sachverhalt eindeutig und verbindlich, auf alle Zeiten zu regeln. Die große Zahl der anwesenden Zeugen und Bürgen des Abkommens, lassen die Mutmaßung aufkommen, dass die gelebte Praxis seitens der Markgrafen, nämlich auf weitere Abgaben neben der Urbede zu verzichten, bisher eine andere war. Das Verfahren eine feste, für beide Seiten kalkulierbare Jahresabgabe, zu zahlen auf einmal oder in zwei Raten, war indes keine Sache, die nur in den Städten der Johanneischen Lande umgesetzt wurde. Beispielsweise stellte Markgraf Hermann, Alleinherrscher der Ottonischen Linie, schon am 19. Juni 1305 zu Arneburg, die Stadt Perleberg in der Prignitz betreffend, eine Urkunde mit gleichlautendem Inhalt aus, wie sie unter anderem Stendal und Prenzlau erhielten. Es scheint sich damals als gängiges Verfahren etabliert zu haben, und wir müssen wohl annehmen, dass die Markgrafen sich hier dem allgemeinen Druck der Zeit beugen mussten. Sehr wahrscheinlich spielte die wachsende städtische Vernetzung hierbei eine wesentliche Rolle, nicht zuletzt die Hanse, zu der alle drei beispielhaft genannten Städte gehörten.
Anlässlich des mit Prenzlau geschlossenen Abkommens, zu dessen Ratifizierung sich der ganze Rat der Stadt neben zahlreichen Zeugen und sonstigem Publikum in Werbellin einfanden, war seitens der Markgrafen nur Otto IV. und sein jugendlicher Neffe Waldemar anwesend, nicht aber Waldemars deutlich älterer Halbbruder Johann. Dieser schien zum Zeitpunkt des Prenzlauer Vertrags entweder schon tot, oder er lag damals im Sterben. Er war verbindlich zwischen dem 24. Juni, dem Tag des geschilderten Stendaler Vertrags, bei dem er letztmalig auf einer Urkunde erscheint, und dem 25. September 1305 verstorben. Am letztgenannten Datum urkundete Markgraf Waldemar zu Arnswalde und beschenkte die Zisterzienser Mönche des Klosters Marienwalde zugunsten des Seelenheils seines verstorbenen Bruders. Die Herrschaft in den Johanneischen Landschaften ruhte damit nur noch auf zwei Schultern. Auf dreien, wollen wir Markgraf Heinrich nicht vergessen, der aber wie schon geschildert, zu Lebzeiten seines Halbbruders Otto völlig in dessen Schatten stand und kaum aktiv war, am wenigsten anlässlich der vielfältigen Kriege in Mecklenburg, Pommern, Pommerellen und Polen.
Ein Jahr großer Umbrüche
Das Jahr 1308 brachte sowohl für die Mark Brandenburg, wie auch das Reich große Umbrüche. Wir wollen mit der Mark beginnen, bevor die Angelegenheiten an der Spitze des Reichs beleuchtet werden.
Durch altersgemäßes aber auch vorzeitiges wegsterben, war in beiden brandenburgischen Linien die einst große Zahl Markgrafen, die alle mehr oder weniger als Mitregenten wirkten, auf nur noch wenige Köpfe zurückgegangen. Die Ottonische Linie bestand nur noch aus Markgraf Hermann und dessen unmündigem Sohn Johann. In der Johanneischen Linie lebte noch der kinderlose alte Patriarch und Seniorregent Otto IV., dessen deutlich jüngerer Halbbruder Heinrich, sein erst in diesem Jahr geborener, gleichnamiger Sohn und designierte Nachfolger, sowie Ottos Neffe Waldemar, der als Erbe vorgesehen war. Genau genommen lebte zu Beginn des Jahres 1308 auch noch Waldemars älterer Halbbruder Otto. Jener zweite Sohn Konrads I., der um das Jahr 1197 zu den Templern ging, dort nach etwa 10 Jahren wieder ausschied, heiratete und noch im gleichen Jahr verschied.
Ende Januar oder gleich zu Anfang Februar starb Markgraf Hermann auf einem Feldzug gegen die Herren von Werle, im Mecklenburgischen. Er stand gemeinschaftlich an der Seite Ottos IV. und Waldemar, denen sich noch Herzog Otto von Lüneburg und Graf Nikolaus von Schwerin-Wittenburg anschloss. Am 26. Oktober 1307 brachen die Brandenburger vereint an der Spitze eines imposanten Heers von 4.000 gepanzerten Reitern und viel Fußvolk auf. Es war einer der vielen Konflikte mit den verschiedenen Linien des Hauses Mecklenburg, denen man brandenburgischerseits abwechselnd verbündet oder verfeindet gegenüber stand. Der Tod Hermanns im Heerlager von Lübz, traf ihn in den besten Jahren und kam völlig überraschend. Ein Fieber hatte ihn ereilt und nach wenigen Tagen aus dem Leben gerissen. Markgraf Hermann war mit der Tochter des römisch-deutschen Königs Albrecht verheiratet, mit der er neben einem Sohn, den damals fünfjährigen Johann, zwei ältere Töchter, Agnes und Mechthild, sowie Anna hinterließ, das jüngste der Kinder.
Der kleine Johann war zwar unbestritten zukünftiger Erbe des väterlichen Besitzes, zu denen die gewaltigen Ottonischen Ländereien, inklusive der thüringisch-fränkischen Gebiete rund um die Landpflege Coburg gehörten, welche der Mutter als Witwensitz verschrieben war, doch konnte er als Minderjähriger die Regentschaft darüber nach gängigem Gesetz nicht auszuüben. Das überlieferte Recht sah im ältesten männlichen Verwandten aus der Linie des Vaters den berechtigten Vormund des Knaben und entsprechend den einstweiligen Verwalter des Landes. Dies war zweifelsfrei Markgraf Otto IV., der hierin die unverhoffte Gelegenheit erblickte, alle brandenburgischen Landesteile unter seiner Gesamtführung zu vereinen, wenn auch nur so lange, bis der junge Johann das zwölfte Lebensjahr erreichte. Ottos IV. Verhältnis zum Ottonischen Zweig war nicht unbelastet gewesen, wie wir wissen, und wenn uns auch keine Konflikte mit Markgraf Hermann überliefert sind, muss man doch davon ausgehen, dass die Auseinandersetzungen mit Hermanns Vater Otto V. beim Sohn nicht spurlos blieb. Wir sahen beide Regentschaftsvertreter auch nur selten zusammen und wenn, so war es in den wenigen Fällen stets Hermann, der am Johanneischen Hof auftrat, nie umgekehrt. Auch ist keine Begebenheit überliefert, in der beide Zweige im gemeinschaftlich genutzten Werbelliner Jagdrevier gemeinsam gesehen wurden, obwohl dieser weitläufige Forst ein von beiden oft besuchter und genutzter Ort war. Vielleicht erklärt es, warum Markgraf Hermann für den Fall seines Ablebens eine andere Disposition in Bezug auf die Vormundschaft für Sohn und Fürstentum vorsah, als es das traditionelle Gesetz vorsah. Sehr wahrscheinlich wollte er bewusst jeden Einfluss Ottos IV., möglicherweise der ganzen Johanneischen Linie verhindern. Wenn es auch nicht althergebrachter Praxis und Rechtstradition im sächsischen Raum entsprach, gab es seit einiger Zeit wiederholte Beispiele, dass ein Vater für die unmündigen Erben statt des nächsten männlichen Verwandten, nach eigenem Ermessen einen oder mehrere andere Vormünder bestimmte. Besondere Anwendung fand dieses neue Verfahren in fürstlichen Kreisen oder bei deren Vasallen, somit bei allen, wo es um etwas ging und Missbrauch bestmöglich verhütet werden sollte.
Markgraf Hermann ordnete für Sohn Johann und die ihm einst zufallenden Ländereien ein zweigeteiltes Verfahren an. Den seit wenigen Jahren zur Ottonischen Linie gehörenden Teilen der Markgrafschaft Lausitz, stellte er Hermann von Barby, Bernhard von Plötzke und Konrad von Redern voran, drei anerkannte Ritter mit umfangreichen Gütern, die teilweise seit einem Jahrzehnt unausgesetzt am Ottonischen Hof zu finden waren. Sie sollten dort im Sinne seines Sohnes regieren und das Land verwalten, bis Johann ein regierungsfähiges Alter erreichte. Die sonstigen Landesteile, die innerhalb der märkischen Kerngebiete lagen und den größeren Teil ausmachten, erhielten gleich vier Verweser, die sich zusätzlich als Vormünder Johanns auch um das direkte Wohl des heranwachsenden Markgrafen zu kümmern hatten. Heinrich Schenk von Schenkendorf, Ludwig von Wanzleben, Droisecke von Kröcher sowie Friedrich von Alvensleben. Allesamt Nachkommen altmärkischer Ministerialfamilien, die im Dienst der brandenburgischen Markgrafen zu Amt und Würden kamen, in den Adelsstand erhoben wurden und zu beachtlichem Güterbesitz gekommen waren.
Otto IV. hielt sich zum Zeitpunkt des Todes Markgraf Hermanns vor Ort in Mecklenburg im Heerlager auf, vermutlich war er Augenzeuge der Erkrankung und des tragischen Verlaufs. Die Quellen schweigen sich hierzu aus, womit wir nur mutmaßen können. Er musste bald nach Tod des Ottonischen Familienoberhaupts Kenntnis erhalten haben, dass nicht er, sondern die aufgezählten Personen Vormundschaft und Regierung übernahmen. Nun war Otto nicht der Mann, der sich eine Gelegenheit, gar einen aus seiner Sicht eindeutigen Rechtsanspruch streitig machen ließ. Die Möglichkeit alle brandenburgischen Gebiete unter eine Hand zu bringen, und sollte es nur für begrenzte Zeit sein, musste seinen Ehrgeiz unweigerlich wecken. Otto pochte darauf, dass Hermanns Anordnung nach sächsischem Recht ungesetzlich wäre, er alleine rechtmäßiger Vormund Johanns und somit Landesverweser sei und eine anderslautende Verfügung in Form eines letzten Willens demgemäß ungültig. Er war klug genug die Sache nicht selbst anzugehen, sondern beauftragte Waldemar, seinen Neffen der in einem besonderen Verhältnis zum Ottonischen Hofe stand, von dem dieser möglicherweise selbst noch nichts wusste.
Wir müssen zur Erklärung etwas ausholen. Nach den inneren Spannungen beider brandenburgischen Linien, die sich maßgeblich zwischen Otto IV. und Otto V. abspielten und in den 1290‘er Jahren gefährliche Züge annahmen, wie das militärische Zusammentreffen bei Ziesar bewies, fürchte man in beiden Zweigen gleichermaßen, dass es zu einem Bruch und einer harten Teilung der Mark kommen könnte, was den ausdrücklichen Wünschen ihrer Väter eindeutig widersprochen hätte. Mit dem Tod Ottos V. entspannte sich die Situation etwas, so dass nach Wegen gesucht wurde, die Zweige wieder näher aneinander zu führen. Das allzeit beliebte, wenn auch nicht immer bewährte Mittel, war eine diplomatische Heirat. Otto IV. war kinderlos aber Bruder Konrad hatte bekanntlich drei Söhne, wovon der mit Abstand jüngste, nämlich Waldemar, für eine Verbindung in Frage käme, denn Markgraf Hermann, des verstorbenen Ottos V. Sohn, hatte seinerseits drei Töchter wovon die erstgeborene Agnes, sie war etwa sechs Jahre jünger als Waldemar, in Frage kam. In aller Heimlichkeit wurde zwischen Markgraf Konrad I. aus den Johanneischen – und Markgraf Hermann aus dem Ottonischen Zweig, eine zukünftige Heirat vereinbart. Die betroffenen Kinder, vom Alter waren sie es zu diesem Zeitpunkt noch buchstäblich, wurden darüber nicht in Kenntnis gesetzt, es ist sogar nicht auszuschließen, dass selbst Markgraf Otto IV. zunächst nicht eingeweiht wurde. Waldemar traf bei Markgräfin Witwe Anna ein, nahm vermutlich an der Beisetzung ihres verstorbenen Gatten teil und schien ihr Wohlwollen zu haben, wobei die vorerwähnte Rolle Waldemars als ihr Schwiegersohn in spe keine unerhebliche Rolle gespielt haben dürfte. Sie ließ sich von ihm überzeugen, so dass ihm der kleine Johann tatsächlich in seine Obhut übergeben wurde. Das Ziel alle brandenburgischen Gebiete unter eine Hand zu vereinen, klammern wir Markgraf Heinrich aus, der in der Mark Landsberg herrschte, war scheinbar erreicht. So lange Johann unmündig war, konnte Waldemar, vielmehr Otto IV., der über allem stand, zumindest theoretisch auch über die Ottonischen Herrschaftsgebiete verfügen. Dass hierbei gerade zu Beginn mit sorgsamen Fingerspitzengefühl vorzugehen wäre, benötigt kaum der Erklärung und doch wurden hier gleich kapitale Fehler begangen. Befeuert von den vier noch vom Vater bestellten Vormündern, regte sich fast augenblicklich der Widerstand gegen das Johanneische Regiment. Willkommener Auslöser war eine höchst unvorteilhafte Vereinbarung Waldemars hinsichtlich einer Beteiligung Johanns an den Kosten seiner nun gewachsenen Hofhaltung, wonach dieser die Hälfte der Kosten zu tragen hatte. Diser Hof Waldemars, demgemäß der Hof des Onkels Otto, war bekannt für seinen kostspieligen Prunk. Die Minnesänger der Zeit gaben sich dort die Hand, was Ausdruck der Popularität, gleichzeitig Ausdruck der finanziellen Aufwände war. Dass die Bedürfnisse des jungen Mündels selbstverständlich erhöhte Kosten verursachten, dass diese aus dem Vermögen des kindlichen Markgrafen getragen wurden, stand nicht zu Debatte, gleichwohl war die Regelung, wonach er die Hälfte tragen musste, ungehörig und musste als Gier aufgenommen werden. Es weckte in den Ottonischen Landen die ärgsten Befürchtungen und in kürzester Zeit kursierten die wildesten Gerüchte, wonach das Leben des Kindes in Gefahr sei, denn mit dem erlöschen auch seinen Lebens, würde alles an Otto IV. und da er kinderlos, an Waldemar fallen. Die vom verstorbenen Markgrafen Hermann bestimmten Vormünder drangen auf die Mutter ein, sie solle ihre Entscheidung rückgängig machen, was die bedauernswerte, augenscheinlich nicht willensstarke Witwe rasch tat. Da Verhandlungen mit Waldemar nichts brachten, er in dieser Hinsicht ohnehin nur ausführendes Organ des Onkels war, auch wenn wir annehmen dürfen, dass er sich schon jetzt darauf verstand, den eigenen Vorteil zu berücksichtigen, entschloss man sich zu dem ebenso kühnen Plan, den kindlichen Markgrafen zu entführen. Es sollte nochmal betont werden, bei den vier oben genannten altmärkischen Rittern, handelte es sich ausnahmslos um geachtete und ehrenwerte Männer. Ihre geplante und schließlich ausgeführte Tat sollte dem Wohl des zukünftigen Landesherren der Ottonischen Lande dienen. Wie es ihnen im Einzelnen glückte, ist nicht überliefert, wir wissen nur, dass der Junge auf die starke Festung Spandau gebracht wurde, wo bekanntlich eine der Ottonischen Hauptresidenzen lag. Waldemar reiste ein weiteres Mal zu Markgräfin Anna, der verwitweten Mutter Johanns. Die arme Frau, offenbar gänzlich eingeschüchtert, bestritt jede Teilhabe, selbst Mitwisserschaft, womit sie die vier Ritter ans Messer lieferte, denn damit waren deren Handlungen illegal geworden. Waldemar ließ keine Zeit verstreichen. Er handelte damit klug, denn es galt der oppositionellen Strömung schnell und in aller Entschlossenheit entgegenzutreten, bevor diese sich ernstlich formieren konnte. Mit einem schnell zusammengezogenen Aufgebot marschierte er vor die Festung, überwältigte die starke Besatzung und bemächtigte sich abermals des Kindes. Sicherlich wollte er sich keinesfalls vor seinem Onkel eine Blöße geben, der bekanntermaßen zur Durchsetzung seiner Forderungen und Ziele, wieder und wieder auf militärische Druckmittel setzte. Den Knaben in der Hand, war jedoch nichts wirklich erreicht den Städte und Adel verweigerten die Huldigung und so war ein Machtvakuum entstanden, dass die Ottonischen Städte zum Handeln zwangen. In der Mark des frühen 14. Jahrhunderts waren die Städte, analog zu vielen Städten im Reich, zu den eigentlichen Machtzentren geworden. Wenngleich die Markgrafen formell den Lehnsadel hofierten, waren es doch die Städte, die Triebfeder und Ressourcengeber der Landesherren waren. Den Städten gefiel die Rolle des ausgebeuteten Geldesels naturgemäß nicht, weswegen sie sich dem direkten Zugriff der Landesherren zu entziehen suchten. Während im Reich auf Grundlage dieser Bestrebungen in den zurückliegenden Jahrzehnten Freie Städte und daneben Reichsstädte entstanden, es bestand hierin ein feiner Unterschied, gab es in der Mark nie eine derartige Stadt, die sich erfolgreich dem Zugriff der Markgrafen entwinden konnte. An Ansätzen dazu mangelte es nicht und die Ereignisse des Februar 1308, rund um den kindlichen Markgrafen Johann, bildeten den Auftakt zu einer Reihe Autonomsierungsversuche, an deren Spitze sich die Doppelstadt Berlin-Cölln stellte. Die wohlbegründete Sorge Waldemar und sein in dieser Hinsicht berüchtigte Onkel Otto IV. würden zur Durchsetzung ihrer Huldigungsforderungen auf Waffengewalt zurückgreifen, ließ die miteinander lose vernetzten brandenburgischen Städte, gemeint sind hier zuvorderst jene des zur Zeit unregierten Ottonischen Herrschaftsbereichs, in engere Verbindung treten. Die größten unter ihnen waren alle Teil der Hanse, dem großen, fortlaufend mächtiger werdenden Handelsnetz, an dessen Spitze sich Lübeck deutlich hervorhob. Als handels- und gewerbetreibende Kommunen war man sich untereinander zwar Konkurrent und in dieser Hinsicht nicht immer freundlich gewogen, doch vor der jetzt heraufziehenden Gefahr, man unterstellte in völlig übertriebener Weise den beiden Johanneischen Markgrafen jede nur denkbare Maßregel, schmiedete es die Rivalen zusammen. Den Anfang machte ein Städtebündnis zwischen Berlin-Cölln mit der Neustadt Brandenburg an der Havel, in das schnell Salzwedel aufgenommen wurde. Die größeren Städte diktierten hierin die allgemeine Richtung und Strategie, denen sich die kleinen anschließen mussten, so sie denn wollten. Sollte es überhaupt je Absicht der im Ottonischen Land verrufenen Markgrafen Otto und Waldemar gewesen sein, mit Waffengewalt die Unterwerfung der Städte und des Feudaladels zu erzwingen, war ihnen mit diesem Städtebund die Spitze genommen. Eine befestigte Stadt einzunehmen, war kostspielig, oft langwierig und schlimmstenfalls mit schweren Verlusten verbunden. Mittlerweile war es den wohlhabenderen Städten, und dazu gehörten die märkischen Hansestädte zweifelsfrei, möglich geworden, statt des bisherigen Palisadenrings, eine steinerne Schutzmauer zu errichten, samt Türmen und stark befestigter Tore. Handelte es sich um keine feindliche Stadt, sondern um eine renitente landeseigene Kommune, die es mit Gewalt zu unterwerfen galt, verbot es sich selbstverständlich nach geglückter Eroberung am Besitz seiner Bürger zu befriedigen. Die Aussicht auf Beute, Plünderungen und Brandschatzungen waren stets Hauptmotivator, die die Masse eines Belagerungsheers Strapazen und Gefahren auf sich nehmen ließ. Gab es hierzu nur schwache oder überhaupt keine Chance, blieben die Anstrengungen aller weit hinter dem Notwendigen zurück. Je länger sich eine Belagerung zog, je unwilliger wurde Jedermann, zumal der Kriegsherr die Kosten der Versorgung tragen musste, was bei den notorisch leeren Kassen der meisten Landesherren, manch Belagerung ein vorzeitiges Ende bereitete. Otto IV. schien sich weitestgehend aus der ganzen Angelegenheit zu halten und gab allenfalls aus der Ferne Regieanweisungen, war sich wohl ansonsten völlig darüber im Klaren, dass ihm ein noch wesentlich schärferer Wind entgegen geweht hätte.
All die beschriebenen Ereignisse spielten sich im Februar ab. Der Frühling verstrich ebenso der Sommer und am passiven Widerstand änderte sich nichts. Auf die Adelsvasallen ging Waldemar hinsichtlich einer Huldigung erst gar nicht zu. Ohne die Städte im Rücken, wäre es vergebliche Liebesmühe gewesen. In dem Zusammenhang mag man erstaunt sein, aber viele des Adels standen auf die eine oder andere Weise in einem Vertragsverhältnis zu benachbarten Städten, die in einzelnen Fällen einem regelrechten Lehnsverhältnis gleichkamen. Umgekehrt wurde niemandem, weder Städten noch dem Lehnsadel die Privilegien bestätigt und so lag jede Regierungshandlung in den Ottonischen Landen danieder. Ein Sackgasse für beide Seiten, die dauerhaft zur gegenseitigen Annäherung mahnte.
Die verworrenen Verhältnisse in der Mark wurden im Mai 1308 von einem Ereignis im Schweizer Aargau überschattet, das schlagartig den Blick von den inneren Belangen auf die großen Reichsangelegenheiten lenkte.
Königsmorde
Albrecht von Habsburg hatte sich seit seiner Erhebung zum römisch-deutschen König Mitte Juni 1298, dem sich die offizielle Wahl Ende Juli und Krönung im August folgte, recht bald die offene Feindschaft der meisten Kurfürsten zugezogen. Angefangen bei den rheinischen Erzbischöfen, mit denen er in fortwährenden Streitigkeiten um die lukrativen Rheinzölle stand. Bis hin zum König von Böhmen. Wie schon Vater Rudolf mit dem Přemysliden Ottokar II. in blutigem Konflikt stand, hatte auch Sohn Albrecht mit Ottokars Nachkommen Wenzel II. von Böhmen einen mächtigen Dauerrivalen, wenn es auch zweiweise zu Phasen der Verständigung kam. Im Juni 1305 starb der böhmische König im 34. Lebensjahr, nachdem Albrecht zuvor zwei erfolglose, geradezu desaströse Feldzüge nach Böhmen gewagt hatte, an denen Brandenburg in gewohnter Weise mit eigenen Kontingenten dem befreundeten böhmischen Königshaus zu Hilfe eilte. Nun war der böhmische König also verstorben und das vorzeitig, in bestem Mannesalter. Jener Wenzel, der als Mündel Markgraf Ottos V. in Spandau und anderen brandenburgischen Gegenden der Ottonischen Linie, mehrere Jahre seiner Kindheit zubrachte. Er hinterließ Sohn Wenzel III., der gerade mal 16 Jahre alt, den Konflikt mit dem römisch-deutschen König Albrecht beilegte, sich seines jungen Lebens und Wohlstands erfreute, sonst aber kaum mehr Gelegenheit zu weiteren Akzenten hatte, denn schon August 1305 erlag er einem Giftattentat in Olmütz. Die Přemysliden, das alte böhmische Königsgeschlecht, war mit dem jugendlichen Wenzel III. auf tragische Weise im Mannesstamm ausgestorben.
Albrecht nutzte die Gunst der Stunde und vergab das erledigte böhmische Reichslehen an seinen ältesten Sohn Rudolf, der dafür auf das Herzogtum Österreich zugunsten seines jüngeren Bruders Friedrich des Schönen verzichten musste. Für Albrecht, der eine Heerschar Kinder hatte, kam das Aussterben des großen böhmischen Geschlechts wie ein Segen, doch bestand kein Anlass zu langer Freude. In Böhmen waren die Rivalitäten unter den Baronen in altbekannter Weise ausgebrochen und allgemeine Anarchie machte sich wie schon nach dem Tod Ottokars II. breit. Diesmal war Brandenburg nicht in das böhmische Drama verwickelt, schaute aber mit wachsender Besorgnis auf das Treiben des Habsburgers, den man sich zum Ende des vergangenen Jahrhunderts zum König erkor, und dafür zunächst seine Vorgänger Adolf von Nassau in ungehöriger Weise absetzte, welcher bald darauf in der Schlacht bei Göllheim sein Leben lassen musste. Vielerorts traf Albrecht jetzt auf offenen Widerstand, am eindrucksvollsten in den Schweizer Stammlanden, wo sich Eidgenossenschaften gegen die dort eingesetzten Habsburger Vögte bildeten. Spätestens Albrechts Vorgehen in Thüringen brachte auch die askanischen Kurfürsten aus Sachsen und Wittenberg gegen den König auf. Am 31. Mai 1307 erlitt Albrecht in der Schlacht bei Lucka eine vernichtende Niederlage gegen den Wettiner Friedrich dem Gebissenen, Markgraf von Meißen. Albrechts Heer wurde vom Nürnberger Burggrafen Friedrich IV. von Hohenzollern geführt. Die Nürnberger Hohenzollern gehörten schon in zweiter Generation zum engsten Verbündetenkreis der Habsburger. Bereits unter den Staufern dienten zollernsche Burggrafen als wichtige Reichsbeamte im Gebiet um das bedeutende Nürnberg. Wir werden über die Nürnberger Burggrafen aus diesem Geschlecht noch manches im Zusammenhang mit der Mark Brandenburg hören, doch nicht hier und in diesem Buch. Seit dieser Niederlage war das Prestige des römisch-deutschen Königs im Reich so schwer erschüttert, das ganze Territorien sich offen verweigerten. Das Unglück sollte nicht abreisen. In Böhmen rebellierten zahlreiche Adelsfamilien gegen den eingesetzten König Rudolf, dem ältesten Sohn Albrechts und es kam zum Bürgerkrieg. Um die Zeit Albrechts thüringischem Heerzug, stand auch in Böhmen eine Entscheidung an und es sah fast danach aus, als das Rudolf sich durchsetzen könnte, als er in der Nacht zum 4. Juli im Heerlager von Horažďovice (deutsch Horaschdowitz) an den Folgen eines schweren Magenleidens starb. Die großen Pläne Albrechts brachen in sich zusammen. Es misslang ihm einen weiteren seiner Söhne in Böhmen zu installieren, stattdessen wählten sich die böhmischen Stände mit dem Meinhardinger Heinrich von Kärnten selbst einen König.
 In den Schweizer Regionen der Habsburger braute sich ein ernstzunehmender Volksaufstand unter den Bergbauern zusammen. Albrecht suchte jetzt vermehrt den Aufenthalt im südwestdeutschen Raum. Dort ereilte ihn sein Schicksal. Am 1. Mai 1308 kam es nach genau 100 Jahren abermals zu einem Königsmord. Wir erinnern uns, im Jahre 1208 erschlug der Wittelsbacher Pflazgraf Otto mit Philipp von Schwaben schon einmal einen römisch-deutschen König. Albrecht I. wurde von seinem eigenen Neffen, Johann von Schwaben, Sohn seines verstorbenen Bruders, in Gemeinschaft mit drei Verschwörern unweit der Habsburg niedergestreckt. Die Hintergründe die zu dieser Tat führten, waren unbefriedigte Erbansprüche des Neffen.
In den Schweizer Regionen der Habsburger braute sich ein ernstzunehmender Volksaufstand unter den Bergbauern zusammen. Albrecht suchte jetzt vermehrt den Aufenthalt im südwestdeutschen Raum. Dort ereilte ihn sein Schicksal. Am 1. Mai 1308 kam es nach genau 100 Jahren abermals zu einem Königsmord. Wir erinnern uns, im Jahre 1208 erschlug der Wittelsbacher Pflazgraf Otto mit Philipp von Schwaben schon einmal einen römisch-deutschen König. Albrecht I. wurde von seinem eigenen Neffen, Johann von Schwaben, Sohn seines verstorbenen Bruders, in Gemeinschaft mit drei Verschwörern unweit der Habsburg niedergestreckt. Die Hintergründe die zu dieser Tat führten, waren unbefriedigte Erbansprüche des Neffen.
Nach nur 10 Jahren, in denen das Reich wenig inneren Frieden fand, nach außen aber immerhin leidlich abgesichert war, verlor es schon wieder seinen König. Auch Albrecht vermochte nicht die Kaiserkrone zu erwerben. Er war der sechste König in Folge, zählt man Heinrich Raspe hinzu, sogar der siebte, dem es nicht gelang, wodurch die Achtung des römisch-deutschen Königtums schwer erschüttert wurde.
Wir haben ein düsteres Bild der Regierung Albrechts I. gezeichnet, vielleicht zu düster, denn er hatte auch Erfolge, die vor allem in der Begrenzung der französischen Ostexpansion bestand. Im Westen saß mit Philipp IV. dem Schönen, ein unruhiger und machthungriger Monarch auf dem Thron Frankreichs. Philipp vermochte in seinen 29 Jahren Regentschaft Frankreichs Einfluss auf bisher ungekannte Höhe heben. Unter seinem Regiment wurde der Sitz des Papstes von Rom zunächst nach Poitiers, dann nach Avignon verlegt, wodurch die dort residierenden Päpste quasi zu einer französischen Marionette wurden. Die Vernichtung des Templerordens, auf die wir noch eingehen, wurde von ihm betrieben, um sich das enorme Vermögen des Ordens zu sichern. Argumente die zur Anklage, Verurteilung und letztendlich brutalen Auflösung führten, waren fingiert und schon zur Zeit der Anklage haltlos. Im Nordwesten trieb Philipp mit der Eroberung Flanderns die französische Ostexpansion mit großer Aggressivität voran. Flandern blieb aber ein ständiger Unruheherd und Stachel in seinem Fleisch. Konflikte mit der englischen Krone um die Lehnsoberhoheit in Aquitanien gehörten ebenfalls zu seiner Herrschaftszeit und markierten einen der Meilensteine, die später zum sogenannten Hundertjährigen Krieg führte. Zuletzt war das Verhältnis zum Reich, das seit dem Ende der Staufer über Jahrzehnte nach außen schwach und nach innen gespalten war, zunehmend belastet. Frankreich weitete in dieser Zeit seine Ostgrenzen bis zur Maas aus. Damit gerieten Landschaften, die teilweise schon seit der ostfränkischen Zeit zum Einflussbereich des späteren römisch-deutschen Reichs gehörten, in den direkten Einflussbereich und Zugriff der Krone Frankreichs. Uralte Gebiete wie die Markgrafschaft Bar, sowie oberlothringische und reichsburgundische Gebiete wurden dem Reichsverband entfremdet. Die Bistümer Verdun und Toul gingen verloren. Das Bestreben Albrechts als römisch-deutscher König bestand in Schadensbegrenzung und darin, weiteres Wegbrechen westlicher Provinzen zu stoppen. In dieser Angelegenheit folgte Albrecht der Politik seines Vaters Rudolf. Eine Heiratsverbindung mit Frankreich erschien hierzu das geeignete Instrument der Expansionslust Philipps ein wenigstens vorläufiges Ende zu setzen. Im Jahre 1300 heiratet Rudolf III. von Habsburg, jener älteste Sohn Albrechts, der einige Jahre später die Krone Böhmens für kurze Zeit tragen sollte, Blanka von Frankreich (um 1282 – 1305), die Tochter des französischen Königs. Der Grenzverlauf im Westen war für den Moment gesichert und es kehrte zumindest an dieser Stelle vorläufig Ruhe ein.
Ein neuer König
Die Ermordung Albrechts wurde im Reich von allen Ständen pflichtgetreu mit Bestürzung aufgenommen, vielfach verflucht und beklagt, doch schaut man genau hin, gab es zahlreiche Gegner, voran die rheinischen Kurfürsten, die insgeheim doch erleichtert. Es darf uns nicht wundern, wenn sie darin eine schicksalslenkende Hand, gar ein Urteil Gottes sahen. Die Mörder traf der Zorn und die Rache der Söhne Albrechts, doch wollen wir darauf nicht eingehen.
Wer sollte Albrecht auf den Thron folgen? Wieder ein Grafenkönig, ein vermeintlich schwacher und beeinflussbarer Kandidat? Die Erfahrungen mit Wilhelm von Holland, Rudolf von Habsburg und Adolf von Nassau hatten gelehrt, dass alle, kaum trugen sie die Krone auf dem Haupt, selbstständige Politik machten und wenig geneigt waren, ihren Parteigängern nach dem Sinn zu regieren. Sie emanzipierten sich, trotz Schwächen in der eigenen Hausmacht, in kürzester Zeit.
Welche in Frage kommenden Kandidaten gab es im Reich überhaupt? Einen Habsburger, hier herrschte Einigkeit, wollte niemand, entsprechend hatte die Kandidatur Friedrichs des Schönen wenig Aussicht auf Erfolg. Die Přemysliden waren im Mannesstamm ausgestorben. Wer weiß ob Wenzel II., würde er noch leben, nicht gute Aussichten gehabt hätte. Die Welfen hatten keinen wirklichen Einfluss mehr im Reich, sie zogen eine Kandidatur überhaupt nicht erst in Betracht. Die Wettiner standen sich zu dieser Zeit durch interne Querelen im Weg. Es blieben die Wittelsbacher, die Askanier und neuerdings vom Erzbischof Triers ins Spiel gebracht, das Haus Luxemburg, zu dem der hohe Kirchenfürst gehörte. Graf Heinrich von Luxemburg trat also in die Schranken, unterstützt von seinem Bruder Balduin, dem Erzbischof von Trier, sowie dem Mainzer Erzbischof. Die Wittelsbacher, seit der ersten bayrischen Landesteilung von 1255 gespalten in eine oberbayrische Linie, die in Personalunion die Pfalzgrafschaft bei Rhein inne hatte, und in eine niederbayrische. Beide Zweige waren wegen allerlei Erbschaftsfragen bisweilen untereinander verfeindet und stellten zusammen alleine insgesamt vier Kandidaten auf, die Herzöge Rudolf, Ludwig, Otto und Stephan. Bei den Askaniern trat Graf Albrecht I. von Anhalt-Köthen an, dieser hatte 1306 Waldemars jüngere Schwester Agnes geheiratet und stand mit der Johanneischen Linie Brandenburgs in engem Einvernehmen. Weiter kandidierte mit Herzog Rudolf I. erstmals ein Vertreter aus dem Hause Sachsen-Wittenberg. Schließlich Markgraf Otto IV. selbst, der mittlerweile greise Senior Brandenburgs. Schlussendlich aus dem Kreis deutscher Bewerber noch Graf Eberhard I. von Württemberg, ein unruhiger Zeitgenosse, der noch von sich reden machte. Bei der großen Zahl Kandidaten, glaubte auch der französische König Philipp der Schöne mitmischen zu müssen, der vom Kölner Erzbischof unterstützt wurde. Tatsächlich brachte Philipp ganz ungewollt Dynamik in die dahinplätschernden Verhandlungen. Vordergründig von Papst Clemens V. unterstützt, hintertrieb der in Avignon residierende Pontifex die Bemühungen Philipps, welchem das päpstliche Doppelspiel nicht verborgen blieb, weshalb er sich anschickte diesen zu belagern und gänzlich unter seine Kontrolle zu bringen. Wie so häufig in der Vergangenheit, wenn ein Papst in der Bredouille war, besann man sich der römisch-deutschen Könige oder Kaiser, rief sie zur Hilfe gegen diesen oder jenen Feind der Kirche und gab sich derweil als mildes und gewogenes Kirchenoberhaupt. Clemens sandte Eilboten nach Deutschland, mit der dringenden Aufforderung zur zügigen Wahl eines Königs, wozu er den Grafen Heinrich von Luxemburg empfehle, den Bruder Erzbischof Balduins von Trier. Im fernen Brandenburg, allgemein im abseits gelegenen sächsischen und ostsächsischen Raum, wusste man wenig über die Inhalte der Geheimgespräche, die am Rhein in dieser Zeit geführt wurden. Zwischen den askanischen Linien Sachsen-Wittenberg, die das Kurland besaßen und Sachsen-Lauenburg, welche aus der älteren Linie bestand, bestand Streit um das Vorrecht zur Königswahl. Letzterer Zweig übertrug als Winkelzug Brandenburg seine Wahlstimme.
Im Hochsommer wurde die Reichsgeschäfte von noch wichtigeren Ereignissen überschattet. Eine Entscheidung beim Erbstreit um das seit Jahren verwaiste Herzogtum Pommerellen war bislang nicht in Aussicht, doch kam Bewegung in die verfahrene Lage. Waldemar und auch Otto IV. widmeten sich in den folgenden Wochen mit aller Energie diesen für Brandenburg ungemein wichtigen Belangen. Wir stellen den Bericht über diese Episode vorerst zurück und kommen an späterer Stelle wieder darauf zurück. Nach Rückkehr der Markgrafen kam es im Krieg mit der Herrschaft Werle am 6. September 1308 zur Aussöhnung. Die von den Brandenburgern beider Linien gemeinschaftlich errichtete Eldenburg blieb in ihrem Besitz, ein wichtiger fester Punkt im Mecklenburgischen.
Die Septemberwochen verbrachten Otto und Waldemar mit Unterbrechungen auf dem Jagdschloss zu Werbellin, wo sie über die einlaufenden Nachrichten vom Rhein beratschlagten und die eigenen Wahlchancen bzw. Alternativen abwogen. Der alte Markgraf Otto IV. erkannte, dass die entscheidende Phase begonnen hatte und die Zeit zur Präsenz vor Ort gekommen war. Er wollte sich die beschwerliche Reise nicht mehr selbst zumuten und beauftragte stattdessen seinen Neffen Waldemar, der bald mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet nach Boppard reiste, wo die finalen Beratungen erwartet wurden. Wie es schien, war den Brandenburgern aber auch den anderen weltlichen Kurfürsten die zwischenzeitliche Favoritenrolle des Luxemburgers völlig verborgen geblieben. In keinem Schreiben erwähnen sie auch nur seinen Namen, weder bezüglich zu unterstützender Kandidaten, noch was die Gegenkandidaten betraf. Die rheinischen Erzbischöfe machten die Wahl fast unter sich aus. Nachdem am 20. September der Kölner Erzbischof endgültig die französische Partei verließ und sich Heinrich von Luxemburg verpflichtete, war eine Vorentscheidung gefallen. Zur Vorbereitung sandten die brandenburgischen Markgrafen zwei bevollmächtigte Prokuratoren, Graf Berthold von Henneburg und Ritter Konrad von Redern. Am 22. November, zu fortgeschrittener Jahreszeit, begannen die mehrtägigen Wahlberatschlagungen auf dem Königstein zu Rhense. Drei Tage lang stießen die gegensinnigen Interessen mit großer Emotionalität aufeinander. Friedrich von Habsburg, Eberhard von Württemberg und Karl von Valois, des Königs von Frankreich jüngerer Bruder, waren früh aus dem Rennen, gefolgt vom niederbayrischen Kandidaten und Albrecht von Anhalt, Waldemars Schwager. Auch für Brandenburgs Markgraf Otto IV. fand sich bei den Wortgefechten keine Mehrheit. Der 25. November brach an, jetzt schritt man endlich zur Abstimmung. Das Stimmenschwergewicht der Erzbischöfe, eingeleitet von Trier, gefolgt von Mainz, schließlich Köln, wog schwer und als sich schließlich Pfalzgraf Rudolf diesen anschloss, war die Entscheidung gefallen.

Dem formalen Akt, folgte der feierliche zu Frankfurt am Main. Dort fanden sich am 27. November, außer Böhmen, alle privilegierten Wahlfürsten oder deren Vertreter ein und wählten Graf Heinrich von Luxemburg mit den Stimmen Triers, Mainz, Kölns, der Pfalzgrafschaft bei Rhein, Sachsen-Wittenbergs und Brandenburgs, einstimmig zum neuen römischen-deutschen König. Pfalzgraf Ludwig verkündete nach erfolgter Wahl Heinrich von Luxemburg offiziell zum gekürten Reichsoberhaupt, worauf die Anwesenden das Te Deum anstimmten. Er war der siebte Heinrich auf dem Thron des Reichs, sofern man jenen Heinrich, den ältesten Sohn Kaiser Friedrichs II. nicht berücksichtigt, der zwar Mitregent aber nie alleiniger Regent gewesen ist. Von diesem Heinrich aus staufischem Hause ist in der Erinnerung wenig mehr geblieben, als sein Wappen, die drei schwarzen Löwen auf goldenem Grund, das heute vom Bundesland Baden-Württemberg als Staatswappen getragen wird. Das neue Haupt des Reichs war nach dieser hartumkämpften Wahl also abermals ein einfacher Graf, doch waren die Vorzeichen diesmal andere. Kein verprellter Rivale stand auf und stellte den frischgewählten König in Frage. Keine Opposition wählte einen Gegenkönig, es herrschte Eintracht.
Am 6. Januar 1309 erfolgte durch die Hand des Kölner Erzbischofs, Heinrich II. von Virneburg, die feierliche Krönung zu Aachen. Die Reichskleinodien befanden sich damals wahrscheinlich noch in den Händen der Habsburger, denn zur Krönung wurde eine silberne Krone verwendet, die man auch die erste Krone nannte. Die wiederholten Erfahrungen mit Thronstreitigkeiten, wodurch die Verfügbarkeit der offiziellen Reichskrone verhindert wurde, nötigte in der Vergangenheit zu diesem Behelfsmittel.
Markgraf Waldemar, der sich seit Rhense im Westen des Reichs aufhielt, und in Vertretung des Onkels an Wahl und Krönung Heinrichs VII. teilgenommen hatte, reiste fast unmittelbar danach in die Mark zurück, wo dringende Angelegenheiten seine Anwesenheit unverzichtbar machten. Bevor wir darauf eingehen, widmen wir uns noch einer Auseinandersetzung, die überall in Europa Furore machte.
Sturz der Templer und Konflikt des Deutschen Ordens
Der Karpetinger Philipp IV., der Schöne genannt, regierte seit dem 6. Januar 1286 in Frankreich. In den zurückliegenden mehr als 20 Jahren, machte er durch das Land zur Großmacht. Er befand sich in fast permanenter Geldnot. Durch Münzentwertungen kam er in Konflikt mit dem französischen Hochadel und hohen Klerus. Die zusätzliche Besteuerung Letzterer untergrub das traditionell gute Verhältnis zum Papst und führte zu einem tiefen Zerwürfnis, wie man es so hauptsächlich zwischen dem Papsttum und den römisch-deutschen Königen oder Kaisern kannte. Die ständigen Geldverlegenheiten vernalassten zu allerlei ruchlosen Handlungen, so beispielsweise zur Vertreibung der etwa 100.000 französischen Juden, deren Besitz er einziehen ließ. In seine Regierungszeit fiel die Verlegung der päpstlichen Residenz vom römischen Lateran, über Lyon, nach Avignon. Man spricht vom sogenannten babylonischen Exil der Päpste, denn sie standen seither unter dem starken Einfluss der Krone Frankreichs, wenngleich Avignon damals formell ein Teil des Heiligen Römischen Reichs war. Der Verlegung ging ein jahrelanger Streit, unter anderem über dem Kirchenzehnten und dessen Ausführung nach Rom voraus, auf dessen Höhepunkt die Bulle Unam Sanctam Papst Bonifatius VIII. stand. Der Exkommunikation entging er nur durch den Tod des Papstes, der vermutlich an den Spätfolgen einer mehrtägigen Geiselnahme (Attentat von Anagni) am 11. Oktober 1303 verstarb. Nachfolger Benedikt XI. suchte den Ausgleich mit der Krone Frankreichs, litt in Rom aber unter den Anfeindungen zweier mächtiger städtischer Adelshäuser, der Colonna und Orsini, worauf er nach Perugia flüchtete und dort schon im Juli 1304 verstarb. Nach fast einjähriger Sedisvakanz, wurde am 5. Juni 1305 vom Konklave in Perugia der Franzose Bertrand de Got, vormaliger Erzbischof von Bordeaux, als Clemens V. zum Papst gewählt. Clemens war ein Freund Philipps IV. von Frankreich, die Aussöhnung mit der römischen Kirche machte zunächst rasche Fortschritte. Jener Clemens war es dann, der sich statt in Perugia, Rom war weiterhin für den Papst wegen der erwähnten Widerstände aus den dortigen Adelskreisen schwierig, 1309 in Avignon, in der Provence niederließ. Zuvor hielt er sich in Bordeaux, Portier und Toulouse auf. Schon bald nach seiner Papstkrönung, die am 14. November auf eigenen Wunsch in Lyon stattfand, er geriet er zunehmend unter Druck seines Freundes, woran das Verhältnis schleichend zerbrach. Neben den alten Forderungen Philipps, wonach die französischen Bischöfe, die analog zu den Bischöfen im Heiligen Römischen Reich hohe Landesfürsten waren, für ihre Ländereien Steuern zu entrichten hatten, kam er mit einem neuen Coup, womit die Autorität des Papsttums weiter erschüttert wurde.
Wir erinnern uns. Seit 1118 zu Jerusalem der Templerorden gegründet wurde, unterstand dieser direkt dem Papst. Er war von allen landesherrlichen Steuern befreit, nicht den fürstlichen Gerichten unterstellt und damit innerhalb der eigenen Besitzungen praktisch autonom. Mit dem Verlust des Heiligen Lands bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, verlagerte sich der Machtschwerpunkt der Templer nach Zypern aber auch nach Frankreich, wo traditionell die meisten Mitglieder herkamen. Alle Großmeister, im Verlauf der Geschichte des Ordens waren es 23, entstammten aus französischen Adelsfamilien. In weiten Teilen Europas unterhielt der Orden ein verzweigtes Netz Balleien und Niederlassungen. Die Einkünfte des Ordens waren außerordentlich, was die Begehrlichkeiten vieler weckte, nicht nur die Philipps. Keiner wagte bislang den Orden anzugehen. dabei gab es durchaus beklagenswerte Dinge. Das dominante, mitunter despotische Verdrängunsgebahren gegen die Johanniter oder den Deutschen Orden in Outremer, im Heiligen Land, wurde im Kapitel über die Rolle der Klöster und Ordensritter thematisiert. Gegenüber Landesautoritäten und kirchlichen Würdenträgern, traten einzelene Ordensglieder nicht minder herrisch auf, was den Unmut weiter schürte und die Zahl der Gegner wachsen ließ. Noch war die Angst vor dem Papst und der militärischen Schlagkraft des Ordens groß. Es brauchte einen ausreichend ruchlosen Machtmenschen wie Philipp IV., der den offenen Konflikt wagte, mit dem Ziel der völligen Vernichtung des Ordens, zumindest in seinem Machtbereich. Die eigene Schuldenlage und die Ratschläge seiner Berater, bewog ihn zu diesem nicht ungefährlichen Schachzug. Des Königs Einfluss auf Clemens V. war so groß geworden, umgekehrt des Papstes Macht so klein, dass der Zeitpunkt günstig war. Unter allerlei Drohungen vermochte Philipp den Papst letztendlich daran zu hindern, sich schützend vor den Orden zu stellen, wie es dessen Rolle als oberster Schutzherr der Templer geboten hätte. In einer minutiös abgestimmten Großaktion wurden am 13. Oktober 1307 in ganz Frankreich die Tempelherren zeitgleich gefangen genommen, alleine in Paris über hundert. Papst Clemens V. protestierte zuerst noch im förmlicher Weise gegen die Verhaftungen und Beschlagnahmung der Ordensgüter, fügte sich dann in Verhandlungen mit Philipp IV. und leitete die Verfahren ein. Es gelang nur wenigen Tempelherren sich der Gefangennahme zu entziehen. Anklagepunkte waren unter anderem Häresie, Sodomie, das heißt die Anwendung homosexueller Handlungen, Götzendienerei. Aus internen Geheimberichten des Ordens, die dem König fatalerweise in die Hände gefallen waren, gingen Verfehlungen, unter anderem in Bezug auf Homosexualität verschiedener Ordensbrüder hervor, was man seitens der Ankläger als willkommenen Beweis ausschlachtete, tatsächlich so aber in fast jedem Kloster vorkam. Im Reich verweigerte der römisch-deutsche König Albrecht I. den Forderungen des französischen Königs nachzukommen und ließ die Templer völlig unversehrt. Päpstlicherseits erfolgten Aufrufe an die deutschen Erzbischöfe und deren Suffragane, Prozesse einzuleiten, von denen im sächsischen Raum besonders jene, letztlich erfolglosen Versuche Erzbischof Burchard III. von Magdeburg zu erwähnen währen. Die Anklagen gegen die Vertreter der regionalen Niederlassungen, deren Anführer allesamt aus namhaften Familien des ostsächsischen Raums kamen, so besonders aus in der Mark angesiedelter Adelshäuser, schürte größten Unmut in der Region, so dass man sich auf einen einen Vergleich einigte, der einem Freispruch gleichkam. Auf dem Konzil von Vienne wurde der Orden der Tempelritter mit der am 4. April 1311 verabschiedeten Bulle Vox in excelso offiziell aufgelöst. Clemens V. war von der Schuld des Ordens nicht überzeugt, dessen Ruf war jedoch in den zurückliegenden Jahren derart erschüttert und untergraben worden, das es nur noch darum gehen konnte, den Schaden zu begrenzen und das Vermögen einem anderen, der Kurie unterstellten Orden zuzuführen. In der am 2. Mai 1312 veröffentlichten Bulle Ad providam wurde der Nachlass des Ordens geregelt, der demnach größtenteils auf die Johanniter übergehen sollte. Es folgten weitere, den Templerbesitz betreffende päpstliche Bullen. Für den französischen König, der es in erster Linie auf das verschwundene Goldvermögen des Ordens abgesehen hatte, war es ein weiterer Schlag, den allerdings die französischen Kirchenfürsten und den lokalen Adel noch härter trafen, denn sie hatten sich die größten Hoffnungen auf die eingezogenen Liegenschaften gemacht. Eine Kluft zwischen dem französischen Episkopat und der Kurie entstand, die erst in den folgenden Jahren geschlossen werden konnte. Im deutschen Reichsteil wurden die Johanniter, begünstigt durch die Entscheidung Clemens V., erheblich gestärkt. Es ist wenig über das Schicksal einzelner deutscher Tempelritter bekannt, über jenen markgräflichen Spross Konrads I. den älteren Halbbruder Waldemars, Otto VI., haben wir gesprochen. Er trat zu Beginn der in Frankreich eingeleiteten Templerprozesse aus dem Orden, heiratete und starb bald darauf. Noch andere deutsche Templer werden ins weltliche Leben zurückgekehrt sein, die meisten schlossen sich wohl aber den Johannitern an, manche auch dem Deutschen Orden, der seit einigen Jahren einen ähnlich gefährlichen Konflikt austragen musste. Bevor wir darauf kommen, noch abschließend der traurige Schlussakt der Templer. Großmeister Jacques de Molay, der unter Folter zunächst die Anklagepunkte gestand und neben anderen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, widerrief am 18. März 1314 öffentlich auf dem Platz vor Notre Dame in Paris, worauf ihn der König wegen wiederholter Ketzerei noch am gleichen Abend an Ort und Stelle, zusammen mit Geoffroy de Charnay verbrennen ließ.
Der Deutsche Orden hatte bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts alle zwölf prußischen Stämme unterworfen, deren Gebiet größtenteils unter Kontrolle gebracht und mit herangeholten, überwiegend deutschen Kolonisten besiedelt, die das urwüchsige Land in den folgenden Generationen zu erschließen begannen. Der streng hierarchisch organisierte, verglichen mit den europäischen Feudalstaaten modern wirkende Ordensstaat, weckte zunehmend den Neid, zumeist seiner südlichen Nachbaren, den polnischen Piasten aus Masowien, Kujawien und Großpolen. Dass es noch zu keinen größeren Zusammenstößen kam, lag Anfangs an der recht engen Verbindung mit dem Königreich Böhmen, selbstverständlich an der nationalen Nähe zum Reich, nicht zuletzt an der Schirmherrschaft des Papstes aber auch an der vorherrschende polnischen Schwäche, wo man sich die einzelnen Linien wiederhol in inneren Streitigkeiten neutralisierten.
Nördlich des Ordensstaats lag mit dem Erzbistum Riga ein größerer Machtfaktor. Der christliche Glaube war soweit im Norden des Baltikums früher verbreitet worden, als weiter im Süden, im ostwärtigen Mündungsbereichs der Weichsel, zwischen Nogat und Memel, dem Siedlungsgebiet der heidnischen Prußen. Zunächst mit den Schwertbrüdern, einem dort ansässigen Ritterorden eng kooperierend, weiteten die Rigaer Metropoliten ihre Besitzungen südlich, östlich und nördlich aus, wovon die Schwertbrüder territorial ebenso profitierten. Ein Bündnis dieses Ordens mit dem dänischen König führte zum Konflikt mit dem Erzbistum, die Folge war die lokale Isolation des Schwertbrüderordens. Am 22. September 1236 unterlag der Orden in der Schlacht bei Schaulen, gegen die heidnischen Schemaiten, wir berichteten in Kapitel X darüber. Militärisch am Ende, schloss sich der Orden 1237 dem rasant expandierenden Deutschen Orden an. Die Gebiete der ehemaligen Schwertbrüder wurden strukturell unter der Organisation des neu gegründeten Livländischen Ordens verwaltet und waren seither Teil des Deutschordenstaats.
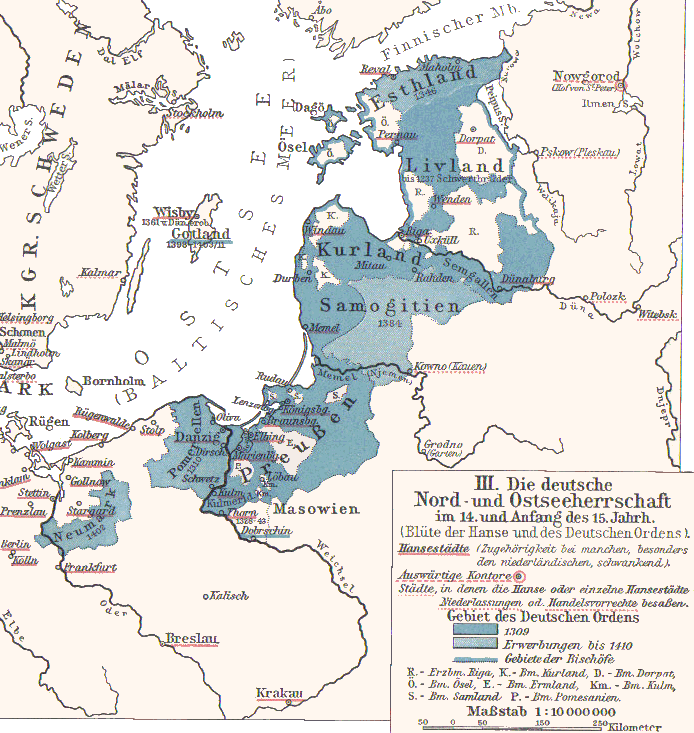 Wenn es auch daraufhin nicht zu unmittelbaren Zerwürfnissen mit dem amtierenden Erzbischof von Riga kam, musste man trotzdem damit rechnen, dass diese langfristig nicht ausblieben, denn die territorialen Besitzungen des Erzbistums lagen überall inmitten der Gebiete der verbrüderten Ordensgemeinschaften der Deutschherren und des Livländer Ordens, womit Konflikte auf Dauer unausweichlich waren. Im Jahre 1304, nach vier Jahren lähmenden Vakuums an der Spitze der Kirchenprovinz, obwohl dort nacheinander zwei Erzbischöfe approbiert wurden, übernahm der erst rund 34-Jährige Friedrich von Pernstein (tschechisch Pernštejna), ein aus Mähren stammender Minoritenbruder, das Amt des neuen Erzbischofs von Riga. Er stand in gutem Einvernehmen mit Clemens V., dem unter französischem Einfluss amtierenden Papst. Als Friedrich 1305 in seiner Kirchenprovinz anlangte und sich über die Verhältnisse in seinem Refugium ein Bild gemacht hatte, geriet er bald darauf mit dem Deutschen Orden in den erwarteten Streit. Der Orden hatte in den zurückliegenden Jahren, unter Ausnutzung fehlender oder unzureichender Machtstrukturen im Erzbistum, wiederholt Handlungen zum Nachteil der landesherrlichen Macht des Erzbischofs vorgenommen, die der neue und vitale Kirchenfürst für unrechtmäßig erklärte und auf Revision pochte. Entzündet hatte sich die Auseinandersetzung am Kauf eines Zisterzienserklosters in Dünaburg, dessen Rechtmäßigkeit vom Erzbischof bestritten wurde. Die Lage des Klosters, am strategisch wichtigen Flussübergang über die Düna, war beiden Seiten bewusst. Nach Errichtung einer Festung und Komturei, kontrollierte der Deutsche Orden die Landverbindung von und nach Osten, vornehmlich nach Nowgorod. Es entspannte sich ein jahrelangee Rechtsstreit, bei dem, trotz teilweise berechtigter Kritikpunkte am Vorgen des Ordens, gegen diesen in verächtlicher Weise eine Schmutzkampagne losgetreten wurde, die das größte Aufsehen unter den Zeitgenossen erregte und den Deutschen Orden an den Rand einer tiefen Legitimationskrise führte. Die Verfahrenheit der Situation untergrub jeden gütlichen Vergleich und der Deutsche Orden beharrte auf der Rechtmäßigkeit seiner Handlungen. Erzbischof Friedrich reiste, nachdem keine Drohung halb, persönlich zum Papst nach Avignon und zuvor nach Rom. Er kehrte mit Francesco di Moliano, einem päpstlichen Untersuchungsbeauftragten zurück. Dieser stand ganz auf der Seite des Kirchenfürsten und sprach den Bann über den Deutschen Orden aus, wie auch das Interdikt über das Gebiet des Ordensstaats. Eine ganz gefährliche Situation, zu einer Zeit, als in Frankreich der letzte Akt gegen die Templer eingeleitet wurde, an dessen Ende die Auflösung des Ordens stand. Wenn selbst der erste von allen Ritteroden, der an Popularität über allen anderen stand, von den höchsten Höhen, in die tiefsten Tiefen gestürzt werden konnte, wie mag es da dem Deutschen Orden ergehen und dessen mittlerweile gewaltigem Ordensstaat? Dass neben dem Erzbischof von Riga, allerlei sonstige Anrainermächte ein Interesse an der Zerschlagung des Ordens hatten, muss kaum erwähnt werden. Nowgorod, Dänemark, das vor einer Wiedervereinigung stehende Polen, nebst allerlei lokalen Adelsgruppen im Baltikum, spekulierten auf die Erbmasse.
Wenn es auch daraufhin nicht zu unmittelbaren Zerwürfnissen mit dem amtierenden Erzbischof von Riga kam, musste man trotzdem damit rechnen, dass diese langfristig nicht ausblieben, denn die territorialen Besitzungen des Erzbistums lagen überall inmitten der Gebiete der verbrüderten Ordensgemeinschaften der Deutschherren und des Livländer Ordens, womit Konflikte auf Dauer unausweichlich waren. Im Jahre 1304, nach vier Jahren lähmenden Vakuums an der Spitze der Kirchenprovinz, obwohl dort nacheinander zwei Erzbischöfe approbiert wurden, übernahm der erst rund 34-Jährige Friedrich von Pernstein (tschechisch Pernštejna), ein aus Mähren stammender Minoritenbruder, das Amt des neuen Erzbischofs von Riga. Er stand in gutem Einvernehmen mit Clemens V., dem unter französischem Einfluss amtierenden Papst. Als Friedrich 1305 in seiner Kirchenprovinz anlangte und sich über die Verhältnisse in seinem Refugium ein Bild gemacht hatte, geriet er bald darauf mit dem Deutschen Orden in den erwarteten Streit. Der Orden hatte in den zurückliegenden Jahren, unter Ausnutzung fehlender oder unzureichender Machtstrukturen im Erzbistum, wiederholt Handlungen zum Nachteil der landesherrlichen Macht des Erzbischofs vorgenommen, die der neue und vitale Kirchenfürst für unrechtmäßig erklärte und auf Revision pochte. Entzündet hatte sich die Auseinandersetzung am Kauf eines Zisterzienserklosters in Dünaburg, dessen Rechtmäßigkeit vom Erzbischof bestritten wurde. Die Lage des Klosters, am strategisch wichtigen Flussübergang über die Düna, war beiden Seiten bewusst. Nach Errichtung einer Festung und Komturei, kontrollierte der Deutsche Orden die Landverbindung von und nach Osten, vornehmlich nach Nowgorod. Es entspannte sich ein jahrelangee Rechtsstreit, bei dem, trotz teilweise berechtigter Kritikpunkte am Vorgen des Ordens, gegen diesen in verächtlicher Weise eine Schmutzkampagne losgetreten wurde, die das größte Aufsehen unter den Zeitgenossen erregte und den Deutschen Orden an den Rand einer tiefen Legitimationskrise führte. Die Verfahrenheit der Situation untergrub jeden gütlichen Vergleich und der Deutsche Orden beharrte auf der Rechtmäßigkeit seiner Handlungen. Erzbischof Friedrich reiste, nachdem keine Drohung halb, persönlich zum Papst nach Avignon und zuvor nach Rom. Er kehrte mit Francesco di Moliano, einem päpstlichen Untersuchungsbeauftragten zurück. Dieser stand ganz auf der Seite des Kirchenfürsten und sprach den Bann über den Deutschen Orden aus, wie auch das Interdikt über das Gebiet des Ordensstaats. Eine ganz gefährliche Situation, zu einer Zeit, als in Frankreich der letzte Akt gegen die Templer eingeleitet wurde, an dessen Ende die Auflösung des Ordens stand. Wenn selbst der erste von allen Ritteroden, der an Popularität über allen anderen stand, von den höchsten Höhen, in die tiefsten Tiefen gestürzt werden konnte, wie mag es da dem Deutschen Orden ergehen und dessen mittlerweile gewaltigem Ordensstaat? Dass neben dem Erzbischof von Riga, allerlei sonstige Anrainermächte ein Interesse an der Zerschlagung des Ordens hatten, muss kaum erwähnt werden. Nowgorod, Dänemark, das vor einer Wiedervereinigung stehende Polen, nebst allerlei lokalen Adelsgruppen im Baltikum, spekulierten auf die Erbmasse.
Überhaupt stand der Orden seit Beginn des 14. Jahrhunderts vor der Grundsatzfrage, wie die weitere Ausrichtung wäre. Lag der Schwerpunkt, selbst nach Verlust der letzten Festlandbesitzungen, im Heiligen Land, wo der Deutsche Orden gegründet wurde, oder sollte nicht der Deutschordensstaat Zentrum werden?

Es herrschten gegensätzliche Strömungen und ein Auseinanderbrechen des Ordens war nicht mehr auszuschließen. In dieser kritische Phase bewies Siegfried von Feuchtwangen, der 15. Hochmeister des Deutschen Ordens, große Umsicht und Nervenstärke. Zunächst verlegte er am 14. September 1309 den Hauptsitz des Ordens von Venedig nach Marienburg und damit direkt ins Ordensland, eine Entscheidung war getroffen. Fortan war der Ordensstaat nicht nur territorialer, sondern auch administrativer Kern des Ordens. Die Verlegung führte zu einer drastischen Verschlechterung der Beziehungen zur Kurie und letztendlich zur Exkommunikation des Hochmeisters und Bann, samt Interdiekt, wie oben beschrieben. Es stellte eine gefährliche Zäsur dar, war doch der Bestand eines christlichen Ordens wesentlich abhängig vom guten Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhl.
Der Entscheid des Hochmeisters zog einen Schlussstrich unter den allgemeinen Richtungsstreit innerhalb des Ordens, der seit dem Verlust der letzten Positionen in Palästina existierte. Zwei hauptsächliche Parteien fanden sich darin. Eine, nennen wir sie Mittelmeerpartei, die das zentrale Betätigungsfeld des Ordens weiterhin im Heiligen Land sah und eine mehr realpolitisch denkende Partei, die in dem kraftvollen Machtzuwachs im Baltikum den Kern aller weiteren Missionierungstätigkeiten erblickte.

Siegfried von Feuchtwangen gelang die Spaltung des Ordens zu verhindern und dessen Integrität zu erhalten. Nach dem Verlust Palästinas und der Unfähigkeit Papst Clemens V. einen neuen Kreuzzug zur Rückgewinnung des Heiligen Landes zu organisieren, obwohl eine Heerschar von Kreuzzugfreiwilligen führungslos bis vor seinen Palast nach Avignon zogen, war die Frage nach dem weiteren Sinn der Ritterorden grundsätzlich geworden. Der Prestigeverlust, der mit dem Verlust der Heiligen Stätten der Christenheit einher ging, traf besonders die Gemeinschaft der kämpfenden Kleriker, die Gemeinschaft der Ordensritter, gleich ob Templer, Johanniter oder Deutschordensritter. Ihr Daseinszweck bestand bislang vornehmlich im Schutz dieser sakralen Plätze gegen die Ungläubigen. Mit den Erwerbungen im Baltikum, die vom ersten preußischen Landmeister Hermann von Balk unter der obersten Leitung des Großmeisters Hermann von Salza seit den 1230’er Jahren eingeleitet wurde, bekam der Deutsche Orden neuen Zweck und Aufgabenfeld, was den Templern fehlte. Die Johanniter wären wohl in dieser kritischen Zeit in eine ähnliche oder gleiche Existenzkrise gestürzt, hätten sie nicht von der Zerschlagung der Templer hauptsächlich profitiert.
Der lange Streit des Deutschen Ordens mit Riga, wurde erst unter Papst Johannes XXII. im Jahre 1319 beigelegt. Die Deutschritter konnten die Rechtmäßigkeit ihrer Erwerbungen nachweisen, und der Papst sprach sich in ihrem Sinne des aus.
Wir kommen schon im nächsten Kapitel wieder auf den Orden zurück, der uns fortan immer wieder begegnen wird, denn die Mark und der Orden waren an vielen Stellen ganz eng miteinander verknüpft.
Der Wechsel
Als Markgraf Waldemar am 6. Januar 1309, im Anschluss an die Krönung Heinrichs VII. zurück in die Mark eilte, hatte ihn von dort vermutlich längst Nachrichte erreicht, dass der alte Markgraf Otto IV., sein Onkel, auf dem Sterbebett lag. Es ist nicht auszuschließen, dass er bereits tot war. Genaueres kann niemand sagen, denn leider ist uns nichts überliefert, woraus sich der exakte Todestag schließen ließe. Noch am 27. November 1308 nahm Waldemar in Vertretung seines Oheims an der Wahl des römisch-deutschen Königs in Frankfurt teil. Wir dürfen davon ausgehen, dass er damals noch lebte, wenn auch seit der letzten von ihm gezeichneten Urkunde, die am 30. September ausgestellt wurde, nichts mehr von ihm zu hören war. Wäre Otto IV. zwischen Heinrichs feierlicher Königswahl zu Frankfurt, und dessen Krönung zu Aachen gestorben, hätte genug Zeit bestanden Boten aus der Mark zu senden und Waldemar davon in Kenntnis zu setzen. Er wäre wohl unmittelbar nach Brandenburg abgereist, unter Zurücklassung eines Bevollmächtigten, der den weiteren Zeremonien beiwohnte. Vermutlich hätte dies auch irgendwo schriftlichen Niederschlag in den römisch-deutschen Regesten gefunden. Der Januar 1309 kann mit gewisser Wahrscheinlichkeit als Sterbemonat Ottos IV. angenommen werden.
Senior in Brandenburg war jetzt formal Markgraf Heinrich, des verstorbenen Ottos jüngster Halbbruder und letzter noch lebender Sohn des großen Markgrafen Johann I., dem Städtegründer. Statt Heinrich, der sich hauptsächlich in der Mark Landsberg aufhielt, führte tatsächlich der junge Markgraf Waldemar das eigentliche Regiment. Mit seinen geschätzten 18 Jahren, hatte er vom Vater und seinem Onkel den allergrößten Teil der Johanneische Landschaften geerbt und war als, wenn auch noch ungeliebter Vormund des unmündigen Johann, gleichzeitig Verweser der Ottonischen Ländereien. Sollte es ihm gelingen in den dortigen Gebieten die bisher verweigerte Huldigung der Stände zu erlangen, wäre die Mark, bis Johann mündig würde, ungeteilt in praktisch nur noch einer Hand. Seit dem Tod Markgraf Albrechts II., Waldemars Urgroßvater, vor fast 90 Jahren, war die Regentschaft in der Mark entweder in der Hand eines Verwesers, so unmittelbar nach Albrechts Tod, als dessen Söhne Johann I. und Otto III. noch Knaben waren, oder seit der schrittweisen Landesteilung durch die genannten Brüder, in den Jahren zwischen 1258 und 1267.

