Entscheidung in Magdeburg
Der im Sommer 1278 vorerst eingestellte Kampf zwischen der Johanneischen Linie Brandenburgs und dem Erzstift Magdeburg, war nur eine Waffenruhe auf Zeit, keine Beilegung des Krieges. Die zum blutigen Kampf eskalierte Rivalität König Ottokars II. von Böhmen und des römisch-deutschen Königs Rudolf I., sahen Magdeburg und Brandenburg paradoxerweise als gemeinsame Verbündete an der Seite Ottokars. Wie würde der ruhende Krieg nach der furchtbaren Niederlage Böhmens und seiner Verbündeten weitergehen? Der gesamte Konflikt mit Magdeburg verlief für Brandenburg und seine Alliierten bislang höchst unerfreulich. Entweder wurden herbe Niederlagen eingefahren oder man musste sich wiederholt zurückziehen. Das Erzstift vermochte mit den Geldmitteln der reichen Stadt Magdeburg, danach sah es zumindest bisher aus, Truppen ganz nach Belieben und Bedarf anwerben und war trotz aller Anstrengungen unbezwungen.
Im Dezember 1278, zu einer eher untypischen Jahreszeit, sollte der Angriff auf die Grafschaft Anhalt, und damit auf den askanischen Verwandten, der auf Magdeburgs Seite kämpfte, eine neue Runde und gleichzeitig eine veränderte Strategie einleiten. Markgraf Johann II. ergriff diesmal die Initiative und fiel in die anhaltinische Grafschaft ein. Erzbischof Günther von Magdeburg, mit ihm erneut ein großes Aufgebot magdeburgischer Bürger und Ritter, eilte dem Grafen Otto zur Hilfe und Markgraf Johann musste sich mit seinen Kräften eilig zurückziehen, dicht verfolgt vom Erzbischof. Über Quedlinburg und Halberstadt, ging die wilde Flucht und Verfolgung bis Helmstedt, wo hoher Schnee alle Bewegungen erlahmen ließ und die Magdeburger ihre Jagd einstellten, zufrieden den Gegner vertrieben und gedemütigt zu haben. Erneut endete ein brandenburgischer Vorstoss mit einer deprimierenden Schlappe. Lange durfte die Reihe der Niederlagen und Rückschläge nicht fortdauern. Der ganze Krieg hatte schon jetzt Unsummen gekostet und erreicht war überhaupt nichts.
Um die gleiche Zeit wurde mit Billigung, möglicherweise sogar auf Weisung des Erzbischofs, der brandenburgisch gesinnte Domherr Heinrich von Gronenberg durch den Stiftsministerial Reinhard von Strahal gefangen genommen. Zur Erinnerung, Heinrich von Gronenberg gehörte anlässlich der Wahl des jetzigen Bischofs zur Partei des Brandenburgers Erich und konnte der damaligen Gefangennahme, am Vorabend der Wahl, gemeinsam mit dem märkischen Kandidaten nur mit knapper Not und beherztem Sprung aus dem Fenster entkommen, um anschließend dem Papst schriftlich vom skandalösen Gewaltakt zu berichten. Die nunmehrige Entführung und Gefangennahme blieb diesmal nicht ohne Folgen und hatte größten Einfluss auf das weitere Schicksal des amtierenden, päpstlicherseits nicht anerkannten Erzbischofs. Am 4. Februar 1279 wurde Reinhard von Strahal von Papst Nikolaus exkommuniziert und der Erzbischof zur Ermittlung seiner Rolle nach Rom zitiert. Günther von Schwalenberg erkannte, dass er kaum mehr mit der Approbation rechnen durfte. Nach dem Vorfall vom Dezember 1278 umso weniger, weshalb er entmutigt im März 1279 unter einem Vorwand vom Amt zurück trat. Eine zweifelsohne überraschende Wendung des Geschicks.
Im Mai 1279 fand zu Magdeburg erneut die Wahl eines Erzbischofs statt. Nach den Kriegswirren der zurückliegenden zwei Jahre, war die Brandenburger Partei unter den Domherren, ihr Kopf war Dompropst Albrecht von Arnstein, mehr denn je in der Minderheit. Gewählt wurde demgemäß nicht der abermals angetretene Erich von Brandenburg, stattdessen Bernhard von Wölpe, Domkellermeister zu Magdeburg. Er war 1277 bereits gegen den resignierten Günther von Schwalenberg angetreten, nachdem die brandenburgischen Anhänger seinerzeit eingesperrt und zur Aufgabe ihres Kandidaten genötigt wurden.
Die Fehde ging mit neuem Erzbischof, an einem anderen Schauplatz, doch unter den gleichen Vorzeichen weiter. Der langjährige Verbündete der Johanneischen Linie, Herzog Albrecht von Braunschweig, war seit einiger Zeit Ziel eines regionalen Fürstenbündnisses, das in der sogenannten Norddeutschen Fehde gegen ihn vorging. Man muss bei dem verwendeten Begriff vorsichtig sein, er wurde im Laufe der Zeit mehrmals verwendet, bezeichnet aber durchaus unterschiedliche Auseinandersetzungen und Konfliktparteien. Albrecht führte um den Besitz einiger Dörfer im Hildesheimer Grenzgebiet Krieg gegen den eigenen Bruder, den Hildesheimer Bischof. In einem fragwürdigen Schiedsverfahren wurden diese ihm zuvor von Markgraf Otto IV. zuerkannt worden. Otto war von den Streitparteien als Schiedsrichter eingesetzt, zeigte aber nach Auffassung der benachteiligten Seite große Parteilichkeit, statt unparteiisch zu entscheiden. In die Reihe seiner Gegner reihte sich jetzt auch der neue Erzbischof von Magdeburg und was die Situation für Brandenburg heikel machte, auch Markgraf Albrecht III., aus der Vetternlinie Brandenburgs. Da Johann II., Otto IV. und Konrad I. wiederum auf Seiten Albrechts von Braunschweig standen, hierbei Markgraf Otto IV. besonders aktiv vorging, war der Zusammenprall brandenburgischer Streitkräfte in diesem Konflikt nur zu wahrscheinlich. Eine gefährliche Situation, die bestens dazu geeignet war, den politischen Zusammenhalt der in mehrere Teilgebiete zersplitterten Mark zu untergraben. Zur Gruppe der Widersacher gesellte sich unter anderem auch noch Erzbischof Giselbert von Bremen. Eine imposante Koalition sammelte sich auf der Seite des Hildesheimer Bischofs, der die Feindseligkeiten gegen den Bruder eröffnete und eine Spur der Verwüstung hinterlassend, ins Braunschweigische einfiel, dann aber von Herzog Albrecht beherzt zurückgeschlagenen und bis Hildesheim verfolgt wurde, um dass er einen Belagerungsring schloss. Zuvor hatte er am 23. Juni die Burgen Sarstedt und Gronau eingenommen, 12 Kilometer nordwestlich von Hildesheim.
Die Belagerung Hildesheims, sie fällt in die letzten Junitage, wurde derweil nicht lange aufrecht gehalten. Anhaltend starke Niederschläge zwangen den Herzog zur Aufgabe und zum Rückzug nach Braunschweig. Nur wenige Tage später, am 4. Juni 1279, starb Bischof Otto von Hildesheim überraschend im Alter von nur 32 Jahren. Ein Ereignis, dass trotz der laufenden Feindseligkeiten, den Braunschweiger Herzog nicht kalt ließ.
Mittlerweile hat sich in Magdeburg ein Heer unter der Führung des Erzbischofs gebildet. Unter dem Vorwand es ginge erneut gegen die verhassten brandenburgischen Markgrafen, mit Wolmirstedt als Ziel, rüsteten die Bürger auch dieses Mal ein starkes Truppenaufgebot aus. Zunächst führte Bernhard das magdeburgische Kontingent tatsächlich Richtung Wolmirstedt, bog dann aber ins Braunschweigische ab, wofür sich die Magdeburger, würden sie es zuvor geahnt haben, vermutlich nicht bereit gefunden hätten. Markgraf Albrecht III. von Brandenburg schloss sich diesem Heerzug an. Sie marschierten vor Helmstedt auf, das vom Schwager des Braunschweiger Herzogs, Fürst Witzlaw II. von Rügen erfolgreich verteidigt wurde. Weiter ging es nach Königslutter und Hasenwinkel. Überall wurde schlimm geplündert und verheert. Bei Abbensen, nördlich von Hannover, bezogen sie ein vorteilhaftes Lager, geschützt von zwei Flüssen, einem Sumpf und einer errichteten Wagenburg. Zwischenzeitlich hat auch Herzog Albrecht seine Verbündeten gerufen. Aus Helmstedt war Fürst Witzlaw II. herangerückt und auch Markgraf Otto IV. sandte 300 Panzerreiter, ohne sich zunächst selbst anzuschließen. Am Abend des 8. Juli vereinigt sich Herzog Albrecht mit den Truppen der Verbündeten, beschloss dann aber wegen der fortgeschrittenen Tageszeit den Angriff auf den kommenden Tag zu verschieben. In der Nacht brach im Lager des Gegners Unruhe aus. Markgraf Albrecht III. wollte ein Zusammentreffen mit den Truppen seines Vetters vermeiden und zog mitten in der Nacht ab, worauf unter den Magdeburgern das Gerücht von Verrat umherging und bald die ersten Absetzbewegungen einsetzten. Schnell wurde daraus überstürzter Rückzug, schließlich zügellose Panik. Zelte, Wagen und viel Ausrüstung zurücklassend, flohen sie Hals über Kopf in die Nacht hinein. Mancher verirrte sich in den umliegenden Wäldern und Sümpfen, darunter eine dreißigköpfige Gruppe Ritter und Knappen Markgraf Albrechts, die am Folgetag gefangen genommen wurden. Auf der Flucht wurden noch viele weitere erschlagen oder in den Wäldern und Sümpfen demoralisiert aufgegriffen. Die heillose Flucht endete erst hinter den festen Mauern Hildesheims, wo dann unter starker Einwirkung Erzbischof Bernhards am 18. Juli der Magdeburger Domdekan Siegfried von Querfurt zum neuen Bischof von Hildesheim gewählt wurde.

Herzog Albrecht kehrte mit seinen Verbündeten nach Braunschweig zurück, wo mittlerweile auch Markgraf Otto IV. mit weiteren Kräften eingetroffen war. Der Herzog konnte einen großen Sieg feiern, ohne das es überhaupt zur offenen Schlacht gekommen wär. In Braunschweig wurde mit einer ganzen Serie Feierlichkeiten der Triumph begangen. Die Euphorie des unerwarteten Erfolgs darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade bei den brandenburgischen Markgrafen aus der Johanneischen Linie der seit Jahren anhaltende Kampf finanziell tiefe Spuren hinterlassen hatte. Rechnet man die außerordentlichen Aufwände Ottos IV. im Zusammenhang mit der schweren Niederlage im vergangen Sommer an der Seite Böhmens noch hinzu, zeichnete sich ein ganz und gar bedrückendes Bild ab. Zur Deckung der Kriegskosten mussten die Städte wiederholt über sogenannte Beten den Markgrafen die benötigten finanziellen Mittel bereitstellen, doch nur unter wachsenden Vorbehalten, wie ein Dokument vom 13. Dezember zugunsten Stendals beispielhaft beweist. Beten waren Geld-, gegebenenfalls auch Sachleistungen, die außerhalb sonst üblicher, landesherrlicher Privilegien auf Bitte, das heißt Bete des Landesfürsten geleistet wurden. Die gebende Partei war dazu nicht verpflichtet, konnte gleichzeitig aber schlechterdings nicht rundweg ablehnen, da der Landesherr für gewöhnlich aus einer ernsten Notlage heraus um diese Sonderabgabe ersuchte und bei einem etwaigen Verweigerungsfall zukünftig mit Nachteilen, vielleicht sogar Repressalien gerechnet werden musste. Ohne adäquate Gegenleistung wurden derartige Sonderopfer für gewöhnlich dennoch nicht gebracht. Die Geberseite wusste normalerweise für sich Privilegien oder Vergünstigungen auszuhandeln, die der Landesfürst in seiner in solchen Fällen oft prekären Lage üblicherweise, getrieben von akuter Geldnot, notgedrungen einging, allenfalls begrenzt nachverhandelte, soweit es die Zeit erlaubte. Von gänzlicher Abgabenbefreiung in der Zukunft, bis zu Verpfändungen landesherrlicher Einnahmen, wie Zölle oder Gerichtsgebühren, war das Spektrum breit. Mit der Zeit beraubten sich die Markgrafen dadurch dauerhaft wichtiger Einnahmequellen. Es handelte sich dabei keineswegs um ein spezifisch brandenburgisches Phänomen, sondern grassierte bis hoch zum Reichsoberhaupt, weswegen viele Fürsten immer wieder in finanzieller Schieflage gerieten. Wir kommen in einem der folgenden Kapitel darauf zurück.
Das Jahr 1279 ging hinsichtlich des Kriegs mit Magdeburg ohne weitere Ereignisse zu Ende, nahm dann aber im Sommer 1280 eine entscheidende Wende. Bei Wiesenburg kam es südwestlich von Bad Belzig zur Schlacht. Es ist nicht viel über den eigentlichen Hergang überliefert, noch weniger über die Ereignisse die der Schlacht unmittelbar vorausgingen. Ein magdeburgisches Aufgebot unter der Führung Gumprechts von Alsleben und des Patriziers Burchard Lappe wurde völlig geschlagen. Neben beiden Anführern, gingen weitere 320 Ritter und Knappen in Gefangenschaft. Ein totales Fiasko. Über die Zahl der Toten ist nichts weiter bekannt. Auf der Seite Brandenburgs standen die Ritter Valke und Konrad von Redern an der Spitze und nicht wie bisher einer der Markgrafen. Die abermalige Niederlage nahm dem Magdeburger Erzbischof Bernhard jeden Willen zur Fortführung des Konflikts. Unter Vermittlung Markgraf Albrechts III., der 1280 nicht mehr gegen seine Vettern ins Feld gezogen war, wurde ein Frieden zwischen Erzbischof Bernhard von Wölpe und Markgraf Otto IV. ausgehandelt. Schließlich resignierte 1282 auch dieser Erzbischof und nach einer Sedisvakanz von etwas mehr als einem Jahr, wurde Erich von Brandenburg 1283 im dritten Anlauf endlich an die Spitze der Kirchenprovinz gewählt. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte er keinen leichten Stand, zumal nicht im Bürgertum, das den jahrelangen Konflikt mit den älteren Brüdern ihres neuen Herren, nicht ohne weiteres vergessen konnten. Als das Ergebnis der Wahl bekannt wurde, die sich die Domherren, wie man anhand der langen Sedisvakanz erkennen kann, nicht leicht machten, kam es unter der Bürgerschaft zu Tumulten und Erich musste vorerst aus der Stadt fliehen, bis Magistrat und Domherren nach langen Vermittlungen den Aufruhr beilegen konnten. Der neue Erzbischof erlangte durch zahlreiche verfassungsmäßige Maßnahmen das Vertrauen der Bürgerschaft. Eine Reihe späterer Gunstbezeugungen der Stadt beweisen nicht nur seine schließliche Akzeptanz unter den Bürgern, sie bringen sogar eine besonders hohe Wertschätzung zum Ausdruck. Einen Aufstand antibrandenburgischer Ministeriale schlug er zu Beginn seiner Administration mit der Hilfe Ottos IV. nieder. Im gleichen Jahr ging er gegen das feste Schloss Harlingsberg bei Vienenburg vor, von wo aus immer wieder magdeburgisches Gebiet überfallen und geplündert wurde, hierbei geriet er in Gefangenschaft. Die Bürgerschaft Magdeburgs kaufte ihn im Anschluss frei, ferner erwarben sie das Bjrggrafenamt Magdeburgs von den sächsischen Herzögen zurück, wie auch das Schultheißenamt aus den Händen Dietrichs von Eckersdorf. In seine Amtszeit fällt die Aufnahme der Stadt Magdeburg in den Hansebund. Erwähnenswert die zunehmende Praxis gegen Ende seiner Regentschaft, Urkunden erstmals in deutscher Sprache auszufertigen, statt wie bislang ausschließlich in Latein. Auf den 1. Januar 1292 ist die älteste dieser Urkunden datiert. Die zahlreichen Fehden die schon in der Vergangenheit die bischöflichen Finanzen schwer belastet hatten, brachten auch Erzbischof Erich bald in arge Bedrängnis. Die zahlreichen Kriegsleistungen der Stadt waren selten selbstloser Natur. Als Gegenleistungen mussten die Bischöfe auf einträgliche Regalien oder sonstige Privilegien verzichten, analog dem Prinzip der weiter oben beschriebenen brandenburgischen Beten. Um das nach Unabhängigkeit strebende Bürgertum Magdeburgs nicht noch weiter durch Zugeständnisse dem Landesherren zu entfremden und autonom zu machen, verkaufte Erich zum Erwerb dringend benötigter Geldmittel, die restlichen Anteile am Lande Lebus an seine Brüder. Ein für Brandenburg zweifelsfrei hochwillkommener Umstand. Erich regierte insgesamt zwölf Jahre das Erststift und starb am 21. Dezember 1295 in Grabow, im Jerichower Land, 30 Kilometer nordöstlich von Magdeburg, wo er in der dortigen Dorfkirche beigesetzt wurde. Der zu frühe Tod des jüngeren Bruders kam den brandenburgischen Markgrafen ungelegen. Es brachen die schon lange schwelenden Konflikte mit den Diözesen Havelberg und Brandenburg nun offen aus. Versuche das Bischofsamt durch einen brandenburgischen Askanier zu besetzen, glückte zweimal und ging durch deren vorzeitigen Tod jeweils im Folgejahr ebenso unglücklich zu Ende. Die Bistümer lagen mit ihren Gebieten komplett in der Mark. Im Gegensatz zu den sonstigen Bischöfen des Reichs, waren jene zwar formell ebenfalls Reichsfürsten, doch fast gänzlich vom guten Willen der Markgrafen abhängig, die ihrerseits stets bemüht waren das Bischofsamt entweder gleich durch einen Vertreter der eigenen Familie zu besetzen oder die Wahl sonstwie in ihrem Sinne zu beeinflussen. Beide Bistümer wurden im zehnten Jahrhundert von Kaiser Otto I. gestiftet, wodurch sich ihre Rechtsstellung und die Stellung ihrer Bischöfe als Fürsten des Reichs ursprünglich nicht von anderen Bistümern unterschied, doch gingen beide anlässlich des großen Slawenaufstands 983 territorial wieder verloren. Für über 150 Jahre fristeten die jeweils eingesetzten Bischöfe dieser Gebiete ein Schattendasein im Exil, wo sie über faktisch keine Machtmittel verfügten. Erst durch die rechtselbischen Eroberungen der Askanier im zwölften Jahrhundert, kamen sie wieder in Amt und würden. Aus dem Umstand, dass die brandenburgischen Markgrafen ohne fremde Hilfe die Gebiete aus Heidenhand gerissen haben, leiteten diese nach Recht und Sitte ihren vom Reich unbestrittenen Oberlehnsanspruch über die restituierten Bistümer ab, woraus sich jene besondere Abhängigkeitssituation ergab, die bei den betroffenen Bischöfen, je nach Kandidaten, auf sehr geteilte Begeisterung stieß. Kirchenorganisatorisch waren sie Teil der Kirchenprovinz Magdeburg, wo man für gewöhnlich das Freiheitsstreben der Subdiözesen wohlwollend unterstützte. Jetzt nach dem Tod Erichs, brachen die aufgestauten Konflikte offen aus und die johanneischen Markgrafen brachen militärisch zur Unterwerfung in die Bistümer ein, worauf die Kirchenacht über die Markgrafen, gemeint sind Otto IV. sowie Konrad, und sogar das Interdikt über ihr Land und ihre Leute ausgesprochen wurde. Otto ließ sich persönlich davon wenig beeindrucken, musste jedoch strenge Maßregeln anordnen, um die Stimmung und Unterstützung in der Bevölkerung nicht kippen zu lassen. Erfahrungsgemäß litten die Menschen schwer unter den Folgen des Interdikts, da offiziell nahezu alle Kirchenaktivitäten währenddessen verboten waren. Weder Messen, es gab wenige Ausnahmen, noch Beisetzungen, Taufen, Eheschließungen usw. waren gestattet. Markgraf Otto IV. setzte in dieser Lage die Klöster unter Druck und fand besonders unter den im Volk populären Franziskanern das geeignete Mittel, das Interdikt zu umgehen. Unter Drohungen, und niemand hatte bei ihm den geringsten Zweifel, dass er solchen auch Taten folgen lassen würde, wies er Mönche und Nonnen an, ihre Gotteshäuser dem Volk zu öffnen, Messen zu lesen und die heiligen Sakramente zu spenden. Das Interdikt verpuffte vorerst größtenteils wirkungslos. Otto IV. stand spätestens seither im Ruf ein Widersacher der Kirche zu sein, zumindest bezogen auf die Kirche als politisch-weltliche Institution. Gleichzeitig verstand er es, die Klöster als eine geeignete geistliche Instanz zu nutzen, um dem politischen Druckmittel von Exkommunikation und Interdikt zu begegnen.
Otto V., Vormund & Verweser Böhmens
Markgraf Otto V., der seit September 1278 in Böhmen gemäß dem Willen des bei Dürnkrut gefallenen Ottokar II. die Vormundschaft über Kronprinz Wenzel und die Verwaltung des Königreichs übernommen hatte, ohne die Markgrafschaft Mähren, die von König Rudolf administriert wurde, stieß noch im gleichen Jahr auf den Widerstand der Königinwitwe Kunigunde. Zunächst war sie es gewesen, die auf die beschleunigte Ankunft des Markgrafen drängte. Nachdem es, vermutlich zu ihrer eigenen Überraschung, zu einem schnellen Vergleich mit König Rudolf kam, dieser nicht wie befürchtet in Böhmen die Macht an sich riss, war der als Regent auftretende Brandenburger schnell ein lästiges Problem. Der Markgraf begann Geld aus dem Land zu ziehen. Bei dieser Gelegenheit brachte er auch die ungarischen Kleinodien an sich, die 1270 mit seiner Hilfe von Böhmen erbeutet wurden und seither in Prag lagerten. Im März 1279 bemächtigte er sich des Kronprinzen und der Königin, schaffte beide auf Burg Bösig (Bezděz) nordwestlich von Jungbunzlau und ordnete ihren weiteren Verbleib dort an. Dem überzeichneten Bericht böhmischer Chronisten nach, wurde sie und der Knabe unter beklagenswerten Bedingungen gehalten und man verweigerte ihnen die nötigsten Dinge zum Leben, womit aber doch kaum Nahrung und dergleichen gemeint sein konnte, sondern wohl eher die einem Thronfolger und einer Königin gebührenden Standards. Im April berief Otto eine große Fürstenversammlung nach Prag, auf der ihm der böhmische Adel Treue schwören sollte. Auf dringende Bitten der Versammlung versprach der Markgraf den kleinen Wenzel und seine Mutter wieder nach Prag zurückzubringen, brach dann aber sein Versprechen. Im gleichen Monat schrieb er an den römisch-deutschen König nach Wien, dass er allen Abmachungen gegenüber der Königin nachgekommen wäre, er weiter in allen offene Punkten, so diverse Burgen des Egerlands betreffend, die Entscheidung einem Schiedsgericht überlassen wolle, wozu er seinen Vertrauten, den Grafen Heinrich von Castell empfehle, gleichzeitig aber jedem, dem König gefälligeren Kandidaten akzeptieren wolle. Weiter werde er in der Sache der ungarischen Kleinodien die Entscheidung ganz dem König überlassen. Schließlich wolle er in Bezug auf den zukünftigen Witwensitz seiner Schwägerin Agnes, des Königs Tochter, die seit kurzer Zeit mit Markgraf Otto VI., seinem jüngeren Bruder verheiratet war, alle geleisteten Zusagen einhalten. Die bereitwillige Kooperation darf als geschickter Beschwichtigungsversuch gewertet werden, denn zweifelsohne sind dem König längst allerlei Beschwerden über Ottos Regime in Böhmen zu Ohren gekommen. Ob Rudolf über die würdelose Behandlung der Königin und ihres Sohnes schon in vollem Umfang Kenntnis am Wiener Hof hatte, bleibt unklar. Nachdem die Königin feststellen musste, dass Otto sie und den Prinzen gegen sein Versprechen nicht zurück nach Prag bringen ließ, flüchtete sie im Mai unter Zurücklassung der Kinder von Burg Bösig nach Troppau, dass ihr als Witwensitz zugefallen war. Wie die Ereignisse ihrer Flucht zeigen, stand sie weder unter schwerer Bewachung, noch war sie oder die Kinder in irgendeiner Weise weggesperrt. Es war ihr erlaubt für Kurzreisen die ihr als Aufenthaltsort zugewiesene Burg zu verlassen, so zum Georgsfest am 23. April 1279. Da sie stets zurückkehrte, gewann sie das Vertrauen des Burggrafen Hermann, unter dessen Obhut sie und die Kinder standen, was ihr die baldige Flucht wesentlich erleichterte.
Markgraf Otto V. verließ wenige Tage später Prag und eilte in die Mark, um dort wichtige Regierungsgeschäfte zu erledigen und um ein starkes Militäraufgebot zusammenzuziehen, das er unter der Begleitung Bischof Gebhards von Brandenburg schleunigst nach Böhmen führte. Er musste wahrscheinlich in der nicht unbegründeten Sorge leben, dass eine von der Königin initiierte Auflehnung bevorstand, die es niederzuschlagen galt. Anders wäre das mitgeführte, kostspielige brandenburgische Truppenaufgebot kaum zu erklären.
Wenn sich der Markgraf in der Folgezeit auch bemühte die Zustände in Böhmen zu ordnen, machte sich der Mangel eines legitimen Königs an der Spitze des Landes bemerkbar. Otto, der in der Vergangenheit als redlicher Fürst und enger Vertrauter Ottokars, ferner als naher Verwandter der königlichen Familie in guten Ruf stand, blieb letztendlich ein Fremder, ein deutscher Ausländer, von denen ohnehin schon genug im Land lebten. Für den Markgrafen war die Lage in Böhmen keine einfache und einige seiner Entscheidungen wie auch die Maßnahmen seiner deutschen Begleiter, trugen viel dazu bei, dass der Ruf seiner Regierung nachhaltig erschüttert wurde. Sein Regiment war von bereitwilliger Kooperation und Unterstützung des böhmischen Klerus und Hochadels abhängig, der sich, wenn auch nicht grundlegend gegnerisch, so doch oft widerstrebend, zwiespältig meist allerdings abwartend passiv verhielt. Otto V. konnte unmöglich durchgängig in Prag verweilen und keinesfalls seine ganze Zeit den Bedürfnissen Böhmens widmen, er musste sich ebenso um die Belange seines eigenen Fürstentums kümmern. Die unglücklichen Vorgänge, an denen sein Bruder Markgraf Albrecht III. anlässlich der Fehde gegen den Braunschweiger Herzog beteiligt war, erforderte schließlich Ende August die erneute und beschleunigte Abreise. Statthalter Böhmens wurde der mitgebrachte Bischof von Brandenburg, ein kriegsbewährter Mann, womit Ottos Befürchtung eines ausbrechenden Aufstands unterstrichen wurde. Wollte er nicht Gefahr laufen während seiner Abwesenheit bezüglich der Landesverwesung ins Hintertreffen zu geraten, durfte er keinesfalls sein wichtigstes Unterpfand, den Kronprinzen aus den Augen, aus dem sicheren Zugriff lassen, er musste ihn mitnehmen. Es war kein leichtes Unterfangen den kleinen Wenzel außer Landes zu schaffen, auch wenn die Vereinbarungen die der verstorbene Vater mit der Markgrafen traf, dahingehend keine Instruktionen oder Verbote vorsahen. Die Abreise muss Ende August stattgefunden haben, ein genaues Datum ist nicht belegt. Neben anderen denkbaren Gründen, spricht es dafür, dass er möglichst wenig Aufsehen in Prag erzeugen wollte und vermutlich in aller Stille aufbrach. Nachdem der kleine Wenzel unterwegs auf Burg Bösig abgeholt war, muss man wohl schon Anfang September in Brandenburg angekommen sein, wo der böhmische Thronfolger in der Residenzfestung Spandau untergebracht wurde. Der erste verbindliche Beweis von Ottos Anwesenheit in der Mark, war der 12. September. Hier stellte er einen Willebrief, analog anderer großer Reichsfürsten, zugunsten Papst Nikolaus III. aus. Dem Itinerar des päpstlichen Bevollmächtigten können wir entnehmen, dass er an diesem Tag das Schreiben bei Markgraf Otto V. abholte und schon am Folgetag im Braunschweigischen das gleiche tat, woraus man nur schließen kann, dass der Aufenthaltsort des Markgrafen am 12. September allenfalls eine Tagesreise vom Herzogtum Braunschweig entfernt lag und er mit größter Wahrscheinlichkeit gleich nach der Ablieferung seines Mündels in den äußersten Westen der Altmark weiterzog. Dass der Markgraf wie hergeleitet so weit im Westen stand, hatte mit den vorerwähnten Vorkommnissen zu tun, an denen Bruder Albrecht III. im Rahmen der Fehde gegen Herzog Albrecht von Braunschweig beteiligt war. Wir erinnern uns, an der Seite des Magdeburger Erzbischofs Bernhard von Wölpe, war dieser im Juli bei Abbensen kampflos geschlagen und nach Hildesheim getrieben worden, wo er seither, gemeinsam mit dem Kirchenmann, und den Resten seines Aufgebots festsaß. Als Haupt der Ottonischen Linie, wird Markgraf Otto V. seinen diplomatischen Beitrag geleistet haben, um einerseits den Bruder beim Rückzug nach Brandenburg zu unterstützen, Gegenfalls militärisch zu decken und andererseits den kriegserprobten Markgrafen Otto IV. von etwaigen Gewaltakten gegen den eigenen Vetter abzuhalten. Wie weiter oben gelesen, vermittelte Albrecht III. im weiteren Verlauf der brandenburgisch-magdeburgischen Fehde den endgültigen Friede. Über die zugrundeliegenden vertraglichen Inhalte ist nichts genaueres überliefert.
Am 18. August 1280 schließen die Markgrafen der Ottonischen Linie, Otto V., Albrecht III. und Otto VI. mit der Stadt Berlin feierlich ein Abkommen ab, wonach fortan auf Beten, gemeint sind erbetene Sonderabgaben, seitens der Markgrafen verzichtet wird. Das Abkommen entsprach inhaltlich zu großen Teilen jenem ihrer Vettern der Johanneischen Linie, wovon schon oben die Rede war, deren Vertrag im Dezember 1279 mit der Stadt Stendal geschlossen wurde. Die Markgrafen haben ihr Vorrecht der Bete dabei nicht bedingungsglos aufgegeben, stattdessen quasi verkauft, indem sie nun jährlich eine feste Summe erhielten. Für beide Seiten schien das Verfahren geeigneter, so dass sich die Stadt bereitwillig darauf einigte. Den Landesherren wurden langwierige Verhandlungen erspart und gleichsam eine gewisse Planungssicherheit hinsichtlich gewisser Einnahmen gegeben, beraubte sie aber der Möglichkeit schnell größere Summen zu beschaffen.
Die Lage in Böhmen hatte sich derweil dramatisch verschlechtert, die Sitten verrohten zusehends, das Land stürzte ins Chaos. Rivalisierende Adelsfamilien nutzten das vorherrschende Regierungsvakuum und trugen ihre Feindschaften in ungehemmter, weitestgehend ungeahndeter Weise aus. Handel und Gewerbe brachen in dieser bürgerkriegsähnlichen Atmosphäre ein. Adlige deutsche Abenteurer, mehr Banditen als Edelleute, mischten eifrig mit, so dass große Verzweiflung im Königreich vorherrschte. Bischof Gebhard von Brandenburg, der an Markgraf Ottos statt die Verwaltung in Böhmen verantwortete, war seinerseits nicht durchgehend im Land und selbst dann vermochte er keine Beruhigung der Situation zu bewerkstelligen. Zwischenzeitlich begann der römisch-deutsche König Rudolf I. mit Zurüstungen um in Böhmen zu intervenieren. Angestachelt durch die Berichte Königin Kunigundes, sandte der König den unermüdlichen Burggrafen Friedrich von Hohenzollern-Nürnberg umher, um die Vasallen zur Heerschau nach Mähen zu rufen. Im September schickte Rudolf an Rat und Bürger Prags ein Schreiben, worin er sie ersuchte auf den Markgrafen dahingehend einzuwirken, dass er den Thronerben wieder nach Prag führe und selbst das Land verlasse, das heißt Vormundschaft und Landesverwesung aufgebe. Prag hatte sich in der Zwischenzeit auf langwierige Kämpfe zwischen den Kontrahenten eingestellt und umfangreich mit Lebensmitteln eingedeckt.
Mitte Herbst 1280 beginnt Rudolf von Mähren aus mit dem Einmarsch nach Böhmen. In seinem Heer waren die Bischöfe Heinrich von Basel, Heinrich von Trient und Konrad von Chiemsee. Weiter Pfalzgraf Ludwig, Herzog Otto von Bayern und Herzog Albrecht von Sachsen, die Schwiegersöhne Rudolfs. Wochenlang operierte Rudolf mit überlegenen Kräften in Südböhmen, während der Markgraf, auf dessen Seite polnische, das heißt meist schlesische Aufgebote standen, einer offenen Konfrontation aus dem Weg ging. Im November vermittelte Pfalzgraf Ludwig, ein langjähriger Freund des Markgrafen, einen Frieden zwischen Rudolf I. und Otto V. der bei Licht betrachtet den Status Quo wieder herstellte.
Der Markgraf behielt seine Stellung als Regent in Böhmen bei, musste jedoch mit dem böhmischen Hochadel und Klerus in ernsthafte Verhandlungen treten und vor allem der Königin entgegenkommen. Am Weihnachtstage 1280 traf sich der Markgraf zu Prag mit den dortigen Bischof Tobias von Beneschau (tschechisch: Dobeš z Benešova), der Kopf der böhmischen Opposition gegen das Regiment Ottos V. war. Der Bischof wurde mit Zustimmung aller zur obersten Instanz hinsichtlich der Klagen gegen die bisherigen Missstände im Land bestimmt. Der Markgraf lässt verkünden, dass alle nicht ansässigen Deutschen, die nur um Beute zu machen im Land waren, binnen drei Tagen auszureisen hatten. Ferner wurden ihm 15.000 böhmische Mark in Silber zugesichert, wenn er am 1. Mai des Folgejahres den Kronprinzen wieder auf der Königsburg zu Prag abliefere, wo er fortan von vornehmen Bürgern der Stadt und brandenburgischen Vertrauensleuten des Markgrafen, nach seinen und den Bestimmungen des böhmischen Adels erzogen würde. Auch traf man eine Regelung mit Königinwitwe Kunigunde, wonach sie sich an alle Bestimmungen halten wolle, solange der Markgraf sich seinerseits an den Vertrag hielte. Markgraf Otto schrieb gleich Zu Anfang den neuen Jahres, am 6. Januar 1281 an König Rudolf, dass er wieder im besten Einvernehmen mit der Königin von Böhmen stehe, seiner Tante, wie er sich extra ausdrückte und ihr insgesamt 1.600 Mark jährliche Bezüge zugestanden wurden. Tatsächlich sehen wir Kunigunde und Otto noch im gleichen Monat gemeinsam Urkunden ausstellen. Für den Moment war der Zwist beigelegt und die Befriedung des Landes zumindest in greifbarere Nähe gerückt.
Bald nach diesen Ereignissen zog Otto V. wieder nach Brandenburg zurück, wo er mit seinem Bruder Albrecht am 20. Februar in Sandau an der Elbe zugunsten des Bennediktinerinnenklosters Arendsee urkundet. Als der Termin der Übergabe des Mündels kam, entschuldigte sich das Markgraf, dass er den Knaben nicht nach Prag bringen könne, da ihn dringende Geschäfte davon abhielten sein eigenes Fürstentum zu verlassen. Er erbat sich einen neuen Termin aus. In Böhmen waren mittlerweile die alten Rivalitäten des Landadels erneut in voller Stärke ausgebrochen, mit all den typischen Schrecken für Land und Leute. Das Jahr 1281 brachte dazu eine schlimme Missernte und ebenso das folgende Jahr, so dass sich in Böhmen eine Hungersnot ausbreitete, wie sie dort seit Menschengedenken nicht gesehen wurde. Im Frühjahr 1282 brachte der Markgraf den jungen Thronfolger nach Prag, verlangte nun aber, statt der ursprünglich vereinbarten 15.000 Mark in Silber, derer 20.000 Mark. Nach den verheerenden Zuständen in Folge der Missernte 1281, war der königstreue Adel nicht in der Lage die geforderte Summe aufzubringen, selbst die 15.000 Mark bereiteten größte Schwierigkeiten. Otto V. reiste ohne eine Einigung erzielt zu haben ab und nahm Wenzel wieder mit, den er diesmal an den Wettiner Hof nach Meißen brachte. Nach der Hungerernte 1282 war die Teuerung in Böhmen drastisch gestiegen, die geforderten 20.000 Mark Silber stellten eine große Hürde dar, stattdessen wurde dem Markgrafen diverser Pfandbesitz in Nordböhmen gegeben, worauf es zu einer Einigung kam. Am 24. Mai 1283 kam der Thronfolger wieder in Prag an, wo er mit großem Jubel empfangen wurde. Noch immer zu jung das Königreich zu regieren, übernahm der zwischenzeitlich neue Ehemann seiner Mutter, Zawisch von Falkenstein (tschechisch Záviš z Falkenštejna), das Regiment. Im Jahre 1290 ließ der mittlerweile volljährige Wenzel II. den bisherigen Verwalter, der sich während seiner Regentschaft zahlreiche Kronländereien widerrechtlich angeeignet hatte und sich beharrlich weigerte diese wieder abzutreten, wegen Hochverrat anklagen, verurteilen und hinrichten.
Die mehrjährige böhmische Episode gab einen Einblick in die Charakterwelt Ottos V., dem Haupt der Ottonischen Linie Brandenburgs. Die Art wie er das Amt des Reichsverwesers zu seinen finanziellen Gunsten ausnutzte, wenn auch nicht in skrupelloser Gier, dabei den Kronprinzen der Mutter und seiner bisherigen Umgebung entriss und den größten Teil der Zeit in der Mark unter Aufsicht behielt, deutet auf einen Machtmenschen hin, der mit einem Hang zu Skrupellosigkeit jeden Vorteil zum eigenen Zweck ausnutzte. Er scheute sich nicht das von im verwaltete Land zur Wahrung seiner Rechte in einen Krieg mit dem römisch-deutschen König zu führen. Zweimal kurz vor einem ernsthaften Zusammenprall, konnte Schlimmeres verhütet und ein gütlicher Vergleich ausgehandelt werden. Erstaunlich scheint, dass es im Anschluss nie zu irgendwelchen Verwicklungen zwischen Wenzel II. und seinem ehemaligen Vormund kam. Es darf vermutet werden, dass der junge Kronprinz in Brandenburg trotz aller Abschottung, bescheiden aber mit gebührender Achtung behandelt wurde. Da Wenzel neben seiner Muttersprache, fließend Deutsch und Latein sprach, Theologie-, Medizin- und Rechtskentnisse besaß, muss man davon auszugehen, dass er dies höchstwahrscheinlich schon in der Mark erlernte und nicht erst mit Rückkehr nach Böhmen. Wenzel II. und Otto V. blieben zeitlebens in engem und vertrautem Kontakt. Aus Wenzel sollte einer der mächtigsten Herrscher der Zeit werden. Es gelang ihm sowohl die polnische als auch die ungarische Krone an sich und sein Haus zu bringen, was ihn am Ende sohar mächtiger machte, als selbst seinen großen Vater. Charakterlich waren Vater und Sohn völlig verschieden. Ottokar, von Ehrgeiz angetrieben, auf dem Schlachtfeld zu Hause, während Sohn Wenzel stiller, tief religiös, deutlich mehr dem diplomatischen Aspekt der Politik aufgeschlossen war. Gleichwohl trachtete auch er danach, den Ruhm und Besitz seines Hauses zu mehren, aber mit einem deutlich breiteren Spektrum an Methoden. In seiner Regierungszeit wurden bei Kuttenberg erhebliche Silbervorkommen gefunden, was nach den Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs zu großem Wohlstand führte. Dank dieser Geldmittel konnte Wenzel nach den Jahren des Bürgerkriegs und der Entbehrungen, Böhmen im Inneren den Frieden bewahren. Durch vorteilhafte Heirat erweiterte er sein Herrschaftsgebiet ohne dafür zu ausschließlich militärische Mittel zu greifen. Die Chronisten wurden diesem erfolgreichen Herrscher lange nicht gerecht. Aktuellere Bewertungen seiner Regierungszeit rücken vom negativen gefärbten Bild ab und heben dessen friedvolle und erfolgreiche Herrschaft mittlerweile gebührend hervor. Wir lesen noch das eine oder andere Mal über ihn.
Unruhiger Osten und Norden
Die Auseinandersetzung mit dem Erzstift Magdeburg waren noch im Gange, der kriegerische Höhepunkt allerdings überschritten, denn beide Seiten erschöpften sich finanziell zunehmend. Gleichzeitig stand Markgraf Otto V. als Verweser Böhmens im Ringen mit dem dortigen Hochadel und dem Prager Bischof um den zumeist in Spandau gehaltenen Thronerben Wenzel. Beides hätte zur Genüge gereicht, um die ganze Aufmerksamkeit der jeweiligen Markgrafen auf diese Problemstellungen zu konzentrieren, doch zeitgleich war das allgemeine Verhältnis Brandenburgs entlang fast seiner gesamten Nordgrenze zu Pommern, zu Mecklenburg, Schwerin und dem Gebiet der Herren zu Werle, bald auch zur Stadt Lübeck und anderer Städte an der Ostsee angespannt und von ständig auflodernden Fehden erschüttert. Im Osten, in der Neumark, entlang von Warthe und Netze, kam es zeitgleich wiederholt zu Zwischenfällen an der unsteten Grenze. Militärische Auseinandersetzungen mit Herzog Bogislaw VI. von Großpolen endeten erst mit dessen Tod im Frühjahr 1279, so dass wenigstens im Osten eine unsichere, zeitweilige Ruhe eintrat. Durch die kluge Art, wie die Regierungsvorgänger die brandenburgische Gebietsaufteilung seit 1258 vorgenommen hatten, waren beide märkischen Hauptlinien von allen diesen Konflikten in nahezu ähnlicher Weise betroffen und damit mehr oder minder jeder der regierenden Markgrafen kriegerisch involviert, wenn auch die Johanneische Linie die größere Last trug. Die Zusammensetzung der zur Regentschaft gekommenen Markgrafen veränderte sich mit der Zeit zwar durch weitere mündig gewordene Brüder, Halbbrüder und Vettern, wodurch sich das eigentliche Führungsschwergewicht aber nicht wesentlich veränderte. In der Linie des 1266 verstorbenen Markgrafen Johann I., gingen Johann II., Otto IV. und Konrad I. einmütig vor. Die nachwachsenden Vertreter der jüngeren Linie aus Johanns I. zweiter Ehe blieben dabei lange im Hintergrund und auch dann war nur Heinrich ohne Land in Aktion getreten. Wenngleich Johann II. der Erstgeborene war, trat Otto IV. durch sein tatendurstiges Naturell mehr ins Bewusstsein der Zeitgenossen, ohne aber jene Dominanz an den Tag zu legen, wie es ihm bis heute in den meisten Geschichtswerken unterstellt wird. Konrad, jüngster der regierenden Markgrafen aus der älteren Johanneischen Linie, darf neben Johann II. und Otto IV. keineswegs als stiller Teilnehmer missverstanden werden, auch ihn sehen wir auf den meisten offiziellen Schriftstücken der Zeit als völlig gleichberechtigten Mitzeichner urkunden. Seine kaum wahrnehmbare Rolle in der für die Johanneischen Linie so wichtigen, über viele Jahre andauernden Magdeburger Fehde, fiel nur deswegen so gering aus, weil er zur gleichen Zeit im Neumärkischen, in dem ihm zugeteilten Erbstück, die Hauptlast der wiederholten Übergriffe Herzogs Boleslaws VI. zu tragen hatte. Ganz alleine war er dabei dennoch nicht. Unterstützung fand er vor allem in der Ottonischen Linie seiner Vettern und hier besonders durch Markgraf Albrecht III., der anlässlich der dritten und letzten brandenburgischen Teilungsphase von 1266 unter anderem Teile der Neumark erhielt, womit einmal mehr die erstaunlich vorausschauende Teilungspolitik der Väter bewiesen wurde. Markgraf Otto V., der nach dem frühen Unfalltod des älteren Bruders, zum Kopf der Ottonischen Brandenburger wurde, stritt ebenfalls mehrmals gegen den polnischen Piasten, musste dabei aber wiederholt der Übermacht weichen, doch reichte es, die Übergriffe immerhin einzudämmen. Ein größeres Treffen fand im Spätsommer 1278 statt, weswegen Otto V. mit seinen Truppen nicht rechtzeitig in Dürnkrut erschien, wodurch er und sein Kontingent der entsetzlichen Niederlage des böhmischen König Ottokars II. glücklich entging. Bislang bewies Otto V. in dem von ihm geführten Familienzweig jene hervorstechende Präsenz und Dominanz, die von der Geschichtsschreibung dem Vetter Otto IV. aus dem anderen Zweig der Familie nachgesagt wird. Im September 1281 trat diesbezüglich eine Veränderung ein. Am 10. des Monats starb Markgraf Johann II. wodurch Otto IV. nicht nur zum ältesten aller Markgrafen beider Linien aufstieg, er übernahm ganz seiner Natur folgend, innerhalb der Johanneischen Linie jetzt die führende Rolle. Bruder Konrad erscheint dennoch unverändert auf Urkunden, womit die unverbrüchliche Einmütigkeit der Brüder unterstrichen wurde, doch hebt sich Otto IV. fortan über seinen mitregierenden Bruder, wie auch über die Halbbrüder der jüngeren Linie und wie wir sehen werden, auch zunehmend über die Vettern des Ottonischen Zweigs hinaus.
In Verfolgung alter Bestrebungen einen direkten Zugang zur See zu erwerben, trat abermals Lübeck ins Blickfeld brandenburgischer Politik. Ansprüche aus väterlicher Zeit sollten in einem weiteren Anlauf geltend gemacht werden. Wir erinnern uns an die Versuche Markgraf Johanns I. und Ottos III. als Vögte von Lübeck an den reichen Einkünften der Stadt zu partizipieren, die Stadt bei passender Gelegenheit vielleicht sogar ganz unter das markgräfliche Regiment zu bringen. Gelungen ist es seinerzeit nicht. Die zum damaligen Zeitpunkt nach Köln wahrscheinlich wohlhabendste Stadt im Reich, wusste seine Freiheit zu bewahren und war hierfür sogar bereit zeitweise den Schutz Dänemarks zu suchen, mit dem man sonst in genau umgekehrter Weise im Dauerkonflikt stand. Eine Verfügung König Rudolfs brachte im August 1280 in die alten märkischen Ambitionen frische Bewegung. Damals verfügte das Reichsoberhaupt, dass nach dem Tod Herzog Albrechts von Braunschweig, der vor einem Jahr verstorben war, die Verwaltung und Wahrung der Rechte des Reichs in Sachsen und Thüringen neu geregelt werden musste. Die königliche Autorität war im norddeutschen Raum schon seit einigen Generationen daniederliegend. Das jeweilige Haupt an der Spitze des Reichs war zur Wahrung königlicher Interessen genötigt, den unliebsamen aber unumgänglichen Umweg einer Vertreterregelung zu etablieren. Standen im süd- und westdeutschen Raum eine Vielzahl von Reichsstädten oder Amtspersönlichkeiten wie die Burggrafen von Nürnberg als Bewahrer königlicher Interessen zur Seite und war dort gleichzeitig die eigene Hausmacht angesiedelt, blieb seit dem welfischen Kaiser Otto IV. Norddeutschland königsfern. Die dortigen Fürstenhäuser agierten weitestgehend autonom, steuerten der Reichspolitik wenig oder überhaupt keine Ressourcen bei und verhielten sich zuweilen offen oppositionell. Des Weiteren existierten kaum Reichsstädte als königstreues Gegengewicht zu den Territorialfürsten. Die Askanier, sowohl die sächsischen wie die brandenburgischen, spielten als Mittelinstanzen für die römisch-deutschen Könige eine wichtige Rolle, besonders seit die Erzbischöfe von Magdeburg in der Reichspolitik kaum mehr Gewicht hatten.
In der genannten königlichen Verfügung Rudolfs vom 24. August 1280 verkündet er allen Reichsgetreuen, dass er Herzog Albrecht II. (* um 1250; † 1298) von Sachsen-Wittenberg, seinem Schwiegersohn und den Markgrafen Johann II., Otto IV. und Konrad I. von Brandenburg, alle Rechte und Besitzungen des Reichs in Sachsen und Thüringen, die der verstorbene Herzog Albrecht von Braunschweig mit Herzog Albrecht II. von Sachsen in seinem Auftrag bislang in Pflege hatten, zusammen mit der Stadt Lübeck, zur Verwaltung übergeben habe, mit der besonderen Bestimmung die entfremdeten Reichsgüter zu revindizieren, und ermahnt die betreffenden Reichsangehörigen zum Gehorsam gegen diese ihre Pfleger und zur Leistung des Treueides. Der König lag zu dieser Zeit mit Markgraf Otto V., dem Reichsverweser Böhmens und Vormunds des dortigen Thronfolgers, im erneuten Konflikt, wie im vorherigen Abschnitt ausführlich berichtet. Indem der jetzt johanneische Vetternzweig vom König mit der Verwaltung der norddeutschen Reichsgüter und Interessen, besonders aber mit der Vogtei Lübeck beauftragt wurde, neutralisierte er diese auf geschickte Weise und musste nicht mehr fürchten, sie an der Seite Ottos V. intervenieren zu sehen.
Für Lübeck war dieser Schritt gleichwohl ein erschreckendes Szenario. Selbstverständlich wollte der Magistrat seine Freiheiten nicht an die Markgrafen Brandenburgs verlieren, auch nicht einmal in Teilen. Und auch der König konnte daran kein Interesse haben, doch für den Moment war Lübeck der geeignete Köder, um die Johanneische Linie aus Rudolfs Händel mit ihrem Vetter herauszuhalten. Noch im gleichen Jahr verglichen sich beide Konfliktparteien, ohne dass es zuvor zu größeren Kampfhandlungen kam, worauf es den König bald reute das lübische Kleinod in die Verwaltung der Brandenburger gegeben zu haben. Bis er seine Entscheidung offiziell widerrief, was nicht ohne triftige Gründe ging, war längst schon der Kampf der Stadt mit den Markgrafen ausgebrochen, der sich zum Konflikt entlang der ganzen deutschen Ostseeküste entwickelte. Im Grenzbereich der nordöstlichen Neumark zu Pommern, kam es zu den üblichen lokalen Verheerungen, die mit den Kriegshandlungen der Zeit wie selbstverständlich einhergingen. Die Landbevölkerung auf den Dörfern, den unbefestigten Städten, wie auch die zahlreichen Klöster, waren stets die hauptsächlich Leittragenden. Zu Schlachten, die dazu geeignet waren den Ausgang eines Krieges zu entscheiden, kam es gemessen an den ungezählten Fehden und Konflikten des Mittelalters, verhältnismäßig selten. In kleinen berittenen Trupps fielen die Kriegsparteien ins grenznahe Gebiet des Gegners ein, plünderten was zu kriegen war, brannten den Rest üblicherweise nieder und zogen mit der Beute und gegebenenfalls Geiseln heimwärts. Kam der Kontrahent mit einer eigenen Schar Kämpfer zum Schutz der Besitzungen, zog man den Rückzug fast stets dem offenen Kampf vor. Diese Art des Kriegs, wurde normalerweise vom jeweiligen Lehnsadel der verfeindeten Seiten vorgenommen. Einer kriegsentscheidenden Strategie folgte das Treiben dabei selten. Es ging um vornehmlich private Beutegier wie auch Rachedurst. Der niedere Landadel, welcher die unentgeltliche Hauptlast des Militärdienstes in Kriegszeiten erbrachte, immer dann wenn ihn sein Lehnsherr dazu aufrief, nutzte Fehden und Kriege, um seine Feldzugausgaben zu bestreiten und wenn immer möglich, daraus auch Gewinn zu erzielen. Die Landesherren ließen die eigenen Leute darin normalerweise gewähren, um die Moral und die Bereitschaft ihrer Leute zur Heerfolge nicht zu untergraben, selbst wenn es militärisch der Sache oft genug abträglich war, weil die eigenen Mannschaften mehr damit beschäftigt waren den nächsten Beutezug zu machen, als in geschlossener Formation einen kampffähigen Verband zu bilden. Dass es bei Plünderungszügen zu allen Arten von Rivalitäten und Neidereien untereinander kam, der Zusammenhalt dadurch weiter beeinträchtigt, nur noch am Rande erwähnt.
Lübeck verweigerte sich zu unterwerfen und einen märkischen Vogt zu dulden, worauf Brandenburg der Stadt in der Folgezeit die Fehde erklärte. Ein dies bestätigendes Schriftstück existiert nicht mehr, doch lassen die einsetzenden Ereignisse kaum Zweifel daran. Militärisch gegen die Stadt vorzugehen, war wie schon zu Zeiten der Väter im Grunde aussichtslos, die städtischen Mauern waren ungewöhnlich gut bewehrt. Brandenburg, gemeint ist hier natürlich die ältere Linie, nun nach dem Tod Johanns II. nur noch von den Markgrafen Otto IV. und Konrad I. vertreten, blieb noch das Mittel des Wirtschaftskriegs. Lübischen Kaufleuten, zumal wenn sie auf der Elbe von und nach Magdeburg verkehrten, wurden die Waren konfisziert, ebenso auf Oder und Havel oder dem Landweg, sofern man dort ihrer habhaft werden konnte. Die Kaufleute Lübecks hatten bald spürbare Einbußen im Binnenhandel mit Schlesien, Böhmen, Meißen, Magdeburg oder Sachsen und mussten vielerorts beträchtliche Umwege in Kauf nehmen, um nicht brandenburgischen Patrouillen in die Hände zu fallen. Im Frühjahr 1282 schickte Lübeck mit Heinrich von Iserlohn einen Gesandten nach Stendal um dort bei den Markgrafen um einen Waffenstillstand zu ersuchen. Diese gewährten am 1. Mai die erbetene Waffenruhe, welche bis zum 24. Juli, dem Fest des Heiligen Jakobus, andauern sollte. Am 15. Mai revidierte König Rudolf zu Ulm seine im August 1280 gegebene Anordnung und nahm die Übertragung Lübecks an die brandenburgischen Markgrafen zurück. Rudolf brauchte sich zum damaligen Zeitpunkt nicht über etwaige diplomatische Verwicklungen und eine zu erwartende Verschlechterung der Beziehungen zum Johanneischen Zweig zu sorgen, nachdem der Ausgleich mit Markgraf Otto V. seit Dezember 1280 auf bislang vortreffliche Weise hielt und von dessen Seite mit keiner Intervention zugunsten der Vettern zu rechnen war. Als Reichsoberhaupt war es ganz in Rudolfs Interesse, Lübeck als freie Reichsstadt zu erhalten, zumal sie eine der wenigen des im Nordens war. Sie war nicht nur wichtiges Bollwerk zu Wahrung der Grenzen gegen Dänemark, sie hatte gleichzeitig Vorbildfunktion für weitere Städte im Norden, entlang der Küste, die durch den aufblühenden Seehandel die Oberhoheit ihrer jeweiligen Landesherren abzuschütteln suchten, so die Städte Hamburg, Bremen, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, nebst anderen. Wie in einem vorhergehenden Kapitel geschrieben, war durch den mittlerweile fast gänzlich abgeschlossenen Wegfall der Reichskirche, dem König ein wichtiges Gegengewicht gegenüber den Reichsfürsten verloren gegangen. Die unter den Staufern entstehenden Reichsstädte, jede für sich eine Kleinrepublik, füllte das vorhandene Vakuum aus und wurde für den König zum Ersatzinstrument seiner Balancepolitik im Reich. Dass die Einnahmen aus den Reichssteuern der Freien Städte des Weiteren einen wichtigen Beitrag zum königlichen Haushalt leisteten, versteht sich von selbst, weswegen schon alleine deswegen alle Könige bedacht waren, dergleichen Regalien nicht ohne Not zu verpfänden oder wegen anderen Gründen aus der Hand zu geben, und falls doch geschehen, möglichst wieder rückgängig zu machen.
Mit Rudolfs Neuregelung Lübeck betreffend, war die Fehde zwischen Stadt und den brandenburgischen Markgrafen nicht ohne Weiteres beigelegt. Wenn Lübeck nun auch formal unter den Schutz des Reichs zurückgekehrt war, durfte der König nicht erwarten, dass die bisher missachteten Rechte von den Markgrafen vergessen wurden. Mitte Juli rückte das Ende des ausgehandelten Waffenstand näher und abermals machte sich Heinrich von Iserlohn im Namen Lübecks auf den Weg um dieses Mal über die Verlängerung der Waffenruhe zu verhandeln. Am 21. Juli beurkundeten Otto IV. und Bruder Konrad eine Waffenstillstandsverlängerung bis Michaelis, das heißt bis zum 29. September 1282. Die Urkunde wurde unter der Bedingung ausgestellt, dass die Stadt den Markgrafen nun endlich das gewähren, was ihnen nach der königlichen Schenkung von 1280 zustehe. Es ging um Leistungen, die Lübeck als Steuern üblicherweise an die Vögte abführten. In dem Moment wo Lübeck einmal diese Zahlungen leistete, hätten sie den Anspruch der Markgrafen als ihre Schutzherren der Stadt anerkannt, weswegen es nur ein ganz oder garnicht gab, so lange keine höhere Instanz, der König einen Vergleich erwirkte. In den ersten beiden Jahren war die Verweigerung mit gewissen Risiken verbunden, immerhin existierte jenes königliche Patent, das den Brandenburgern die Vogtei zusicherten. Lübeck konnte sich aber von Beginn an darauf verlassen, dass Rudolf, außer vielleicht Mahnschreiben, so weit im Norden zu keinerlei echten Maßnahmen greifen würde, noch könnte. Die Markgrafen mussten sich ihr Recht selbst durchsetzen und konnten hierbei auf keine Hilfe anderer hoffen, im Gegenteil, die Liste der brandenburgischen Feinde war lang genug, um seitens Lübeck von dort aktive Hilfe erwarten zu können. Jetzt wo der König seine Entscheidung zugunsten der Mark wieder zurückgezogen hatte, ging es für die Stadt nur noch darum den Konflikt auszusitzen und hierzu waren die wiederholten Waffenstillstandsgesuche der Stadt, Mittel zum Zweck. Einerseits konnten sie in den Phasen der Waffenruhe ungestört ihre ausstehenden Binnengeschäfte nach Süden fortführen, andererseits eine Allianz errichten, deren Spitze sich gegen Brandenburg richtete. So lange das königliche Dokument vom 24. August 1280 galt, konnte kaum mit Aussicht auf Erfolg über eine Allianz wider die Markgrafen gerechnet werden, immerhin war das Recht auf ihrer Seite. Jetzt stand dem ganzen nichts mehr im Wege und die Aussichten Ottos IV. und Konrads wurden zusehends schlechter. Der Waffenstillstand, der seit dem Frühherbst beendet war, führte zu erneuten Übergriffsversuchen gegen Lübecker Handelsreisende, die zwischenzeitlich natürlich längst in Gruppen und unter militärischer Deckung ihren Binnengeschäften nachgingen. Mühe und Kosten bedeutete diese Verfahren trotzdem und so kam es auf Bitten der Stadt am mit Wirkung vom 24. November zu einem dritten Waffenstillstand bis zum 2. Februar 1283. Am 7. Dezember kam es zu einer neuerlichen Wendung der Ereignisse, König Rudolf vergab die Schirmvogtei über Lübeck an die sächsischen Herzöge Johann II. und Albrecht III. ab, die aus der Lauenburger Linie Sachsen abstammten und ebenso zu askanischen Verwandtschaft Brandenburgs gehörten. Den Markgrafen waren im Grunde alle Möglichkeiten genommen, um noch zu einer günstigen Einigung mit Lübeck zu gelangen, es sei denn sie hätten einen Krieg mit den Verwandten aus Sachsen-Lauenburg in Kauf genommen. Dem König, der von Lübeck zugunsten seines Vermittlers, des Grafen Günther von Schwarzburg, einen Teil der angefallen Reichssteuer einstrich, konnte die Gefahrenlage, die sich hieraus immerhin noch ergeben konnte, alles andere als recht sein. Selbst im offen ausgetragenen Konflikt mit Savoyen, brauchte er Ruhe in norddeutschen Reichsteil, er lud daher in einem in Basel ausgefertigten Schreiben vom 11. März 1283 zu einem auf Pfingsten 1283 anberaumten Hoftag an den Niederrhein ein. Aus einem zeitgleichen Schreiben des oben erwähnten Grafen von Schwarzburg, entnehmen wir dessen Aussage gegenüber dem Magistrat und den Bürgern Lübecks, dass er die Abgesandten der Markgrafen am königlichen Hoflager angetroffen habe, diese sich beim König über die Stadt beklagten, wogegen er sich im Sinne Lübecks verwendete. Die Markgrafen pflichteten im Anschluss dem königlichen Entscheid hinsichtlich der Wegnahme der Lübecker Vogtei notgedrungen bei, und hofften auf einen günstigen Vergleich anlässlich des zu Pfingsten anberaumten Hoftags, der dann nie stattfand, da Rudolf sich zu diesem Zeitpunkt im Krieg mit Savoyen befand.
Für Otto IV. und Bruder Konrad trübte sich die Lage ein, besonders als sich am 14. Juni 1283 ein großes Landfriedensbündnis gegen Brandenburg bildete. Herzog Johann I. von Sachsen, Herzog Bogislaw IV. von Pommern, Fürst Wizlaw II. von Rügen, die Herren von Werle und Mecklenburg, die Grafen von Schwerin und Dannenberg sowie die Städte Lübeck, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Demmin und Anklam, gehen ein Schutz- und Trutzbündnis ein, wodurch Brandenburg allem ersten Anschein nach, jedweder Aktionsmöglichkeiten gegen Lübeck beraubt wurde. Die Festigkeit des Bündnis erwies sich derweil als deutlich weniger stabil, die Glieder als wesentlich weniger geeint, als es vordergründig zu erwarten gewesen wäre. Während all der Zeit, in der Brandenburg seine Rechte bezüglich Lübeck durchzusetzen suchte, loderte der Kampf mit dem Herzogtum Pommern, wo Herzog Bogislaw IV. seit 1278 die Regierung führte. Über die beiden Halbbrüder Barnim II. und Otto I., Söhne einer Cousine der Markgrafen, beide noch minderjährig, übte er damals noch die Vormundschaft aus. Es ging dabei neben allgemeinen Grenzdisputen unter den jeweiligen Lehnsleuten, vor allem um die alte Frage der Lehnshoheit Brandenburgs über Pommern. Der Konflikt verlor vordergründig seine Lübecker Komponente und wurde zu einem Streit entlang der südlichen Ostseeküste, worunter der Handel Lübecks wiederum erheblich litt, weswegen die dem König vorgebrachten Klagen der Stadt hinsichtlich allerlei brandenburgischer Gewaltakte, und umgekehrt die märkischen Gegendarstellungen, nicht abrissen. Dem König lag viel daran endlich den Norden zu befrieden. Vom 5. Juni 1284 ist uns ein Dokument erhalten, worin Rudolf eine Gesandtschaft an alle Konfliktparteien in Aussicht stellte, um den vorherrschenden Kriegszustand beizulegen. Im gleichen Zusammenhang steht ein weiteres Schreiben, das an seinen Schwiegersohn Herzog Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg gerichtet war, worin er diesen ermahnt, nicht an der Seite Brandenburgs gegen die wendischen Herren, gemeint waren damit die Fürstentümer in Mecklenburg, Werle, Pommern, Rügen sowie die schon genannten Hansestädte, zu intervenieren, und stattdessen einen Frieden zu vermitteln.
Am 13. August 1284 kam es endlich zum großen Frieden. Im märkischen Vierraden an der Welse, einem linken Nebenfluss der Oder, trafen sich die Bevollmächtigten aller Konfliktteilnehmer und handelten die für Brandenburg hinsichtlich der weiteren Sukzessionsrechte auf Pommern nicht ungünstigen Friedensbedingungen aus. Der Friede von Vierraden schloss nicht nur die bisher hauptsächlich involvierten Markgrafen Otto IV. und Konrad aus der Johanneischen Linie ein, in gleicher Weise war die Ottonische Linie um Otto V., Albrecht III. und Otto VI. einbezogen. Der jahrelange Krieg im Norden war beigelegt.
Wechsel an der Spitze des Reichs
König Rudolf I. war wie im letzten Kapitel gesehen, anlässlich seiner Wahl zum römisch-deutschen König bereits in fortgeschrittenem Alter. Gegen alle Erwartungen erwies er sich nicht nur als langlebiges, sondern auch als erfolgreiches Haupt an der Spitze des Reichs, das durch seine ausgeprägte Heiratspolitik, wie auch durch seine erfolgreiche Mehrung der habsburgischen Hausmacht, den Grundstein zum Aufstieg der Habsburger schuf. Über die Schwierigkeiten in Bezug auf die Erlangung der Kaiserkrone wurde gesprochen. Zu Beginn seiner Regentschaft, als die Gelegenheit günstig erschien, hielten ihn der Konflikt mit Ottokar II. von Böhmen davon ab das Vorhaben zügig umzusetzen. Als die böhmische Krise einen blutigen Ausgang genommen hatte, verhinderte der Tod des ihm zugeneigten Papst Gregor X. die anschließende Umsetzung und es musste mit dem Nachfolger erneut die Verhandlungen begonnen werden. In rascher Folge wurden Innozenz V., Hadrian V., Johannes XXI., Nikolaus III., Martin IV., Honorius IV. und schlussendlich Nikolaus IV. gewählt. Die meisten Päpste starben so schnell, dass seitens der königlichen Kanzlei teilweise kaum die notwendigen Kontakte eingeleitet werden konnten. Die Zeiten, in denen die deutschen Könige an der Spitze eines kriegsgewaltigen Heeres nach Rom zogen, um den Papst, war er nicht freiwillig dazu bereit die Kaiserkrönung vorzunehmen, unter Androhung oder Anwendung von Gewalt zu zwingen, ihn notwendigenfalls auszutauschen, war vorbei. Dem königlichen Romzug an der Spitze eines Heers kam nunmehr hauptsächlich ein symbolischer Charakter zu. Insgesamt bestanden in den 18 Regierungsjahren des Königs drei konkrete Termine zum Erwerb der Kaiserkrone. Zwei in den ersten Jahren seiner Regentschaft, die aber wie geschildert geprägt waren vom Gegensatz zu Ottokar II. von Böhmen und einen Termin vom 2. Februar 1287, während es Pontifikats Papst Honorius IV. Letzterer scheiterte an innenpolitischen Problemen mit den Wahlfürsten des Reichs. Rudolf gab die Idee der Kaiserkrone dennoch bis zuletzt, bis ins hohe Alter nicht auf. Zwischenzeitlich waren von seinen vier Söhnen außer der erstgeborene Albrecht, alle anderen verstorben. Karl, der jüngste von vier Söhnen 1276, nich im Jahr seiner Geburt, Hartmann, der erklärte Favorit Rudolfs, starb im Jahre 1281, mit 18 Jahren und Rudolf II. im Jahre 1290, im Alter von 20. Rudolfs lange Fixierung auf seinen gleichnamigen Sohn als Nachfolger, rächte sich nach dessen Tod bitter. Der hochbetagte König musste die Kurfürsten nun auf Albrecht einstimmen, doch lief ihm, das fühlte er, die Zeit davon. Obwohl mit allen weltlichen Kurfürstenfamilien zwischenzeitlich ein Ehebündnis bestand, so war Mathilde mit Pfalzgraf Ludwig II. verheiratet, Agnes mit Herzog Albrecht II. von Sachsen, Hedwig mit Markgraf Otto VI. von Brandenburg und Guta mit König Wenzel II. von Böhmen, erreichte Rudolf I. am 20. Mai 1291 anlässlich des Frankfurter Hoftags von den dort anwesenden Kurfürsten keine Zustimmung für seinen Sohn Albrecht. Aus Brandenburg und Böhmen war überhaupt niemand zum Hoftag erschienen. Wenzel II. erhob alte böhmische Gebietsansprüche auf Österreich, Kärnten und die Steiermark und prallte hier natürlich auf die Interessen des Hauses Habsburg. Im Südwesten, wo im Aargau die ursprünglichen Stammlande lagen, und wo Rudolf noch vor seiner Berufung zum König starke Gebietsvergrößerung im Badischen und im Elsass vornahm, nicht ohne die lokalen Mittelmächte in Sorge zu versetzen, nahm die oppositionelle Haltung zu, besonders in den Gebieten der heutigen Schweiz. Eine Verlagerung des Habsburger Machtzentrums vom Südwesten in den Südosten, zeichnete sich ab.
War Wenzel II. nach dessen Heirat mit einer Tochter Rudolfs Anfangs noch gefügig und dessen Stimme für Rudolfs gleichnamigem Sohn mit allerlei Privilegien erkauft worden, änderte sich Wenzels Haltung unmittelbar mit dem vorzeitigen Tod dieses Sohns. Der böhmische Regent war dabei nicht der einzige Wahlfürst, dessen Stimme nicht für Albrecht, des Königs ältesten Sohn, zu erlangen war. Auch der Erzbischof von Köln, Siegfried von Westerburg, hatte eigene Pläne. Theoretisch blieben noch fünf potenzielle Stimmen für Rudolfs Sohn übrig, von denen nur jene des Pfalzgrafen Ludwig von Wittelsbach als gesichert galt. Die Erzbischöfe aus Mainz und Trier wahren wankelmütig. Sachsen, eigentlich habsburgisch gesinnt, war seit dem Sinneswandels Wenzels, heftig von Böhmen umgarnt worden. Vor diesem Hintergrund erscheint es erstaunlich, dass Rudolf I. sich nicht deutlich mehr um Brandenburg bemühte. Es rächte sich jetzt in vollem Ausmaß, dass die königliche Politik, die heute diese, morgen die andere Linie des Hauses Brandenburg favorisierte, damit letztendlich beide Zweige missachtete und gegeneinander auszuspielen suchte. Gerade die ältere Johanneische Linie, die über keine verwandtschaftlichen Banden zum böhmischen Königshaus verfügte und demgemäß noch am leichtesten für Rudolf zu gewinnen gewesen wäre, wird auffallend geringschätzig behandelt, sieht man von Rudolfs politischem Winkelzug des Jahres 1280 einmal ab, als er dieser Linie das Reichsvikariat im nordsächsischen Raum zuerkannte, am Vorabend seines Feldzugs gegen den Vetter Markgraf Otto V., dem damaligem Verweser Böhmens.
Bis zu seinem Tode setzte sich Rudolf, zu spät wie sich zeigte, für den Sohn als Nachfolger ein. Die erwähnte Niederlage anlässlich des Hoftags zu Frankfurt Mai 1291, als es ihm in einer letzten Kraftanstrengung misslang Albrecht die notwendigen Stimmen unter den versammelten Fürsten zu verschaffen, kosteten den schwer an Gicht leidenden König, zwischenzeitlich 73 Jahre alt, die letzten körperlichen Reserven, er fühlte dass sein Ende bevorstand. Noch einmal alle Kraft aufwendend, reiste er über Mainz, Landau, Germersheim nach Hagenau, wo er überall noch zahlreiche Urkunden und Regentschaftstätigkeiten ausübte, bevor ein letztes Mal nach Germersheim kam und am Vortag seines Todes, dem 14. Juli 1291, den herannehmenden Tod voll fester Zuversicht spürte. Aus eigenem Entschluss reiste er von dort ins nahegelegene Speyer, wo in der Krypta des salischen Kaiserdoms die Gebeine vieler seiner Amtsvorgänger lagen und er neben dem Grab Philipps von Schwaben beigesetzt werden wollte. Am Abend des 15. Juli, bis zum Schluss im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und der Rede mächtig, starb Rudolf I. schlussendlich an Altersschwäche, nach einem langen Leben, das ihn vom kleinen Schweizer Grafen, zum König des Heiligen Römischen Reichs führte und zum Begründer der Habsburger Macht.
Der Thron des Reichs war wieder vakant und sofort bildeten sich drei Blöcke. Der erste wurde gebildet von Albrecht, des verstorbenen Königs Erstgeborener. Er hatte die Stimme seines Schwagers, des Pfalzgrafen Ludwig, dem er verschieden Burglehen dafür versprach, sowie den Erzbischof von Trier. Ein streng oppositioneller Block wurde vom Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg angeführt, der im April 1275 vom verstorbenem König mit den weltlichen Regalien eines Reichsfürsten ausgestattet wurde. Am 5. Juni 1288 war der Erzbischof und seine Verbündeten in der Schlacht bei Worringen einer Allianz um Herzog Johann I. von Brabant unterlegen und seither erodierte seine Macht, die er mit der Positionierung eines eigenen Königskandidaten zu restaurieren suchte. Graf Adolf von Nassau, einer seiner Verbündeten von 1288, war der von ihm ins Rennen geworfene Kandidat. Ein dritter Block bildete sich um König Wenzel II. von Böhmen. Hinter ihm stand nicht nur die eigene Kurstimme, auch jene aus Sachsen und Brandenburg schlossen sich seinem Urteil an, ohne eigene Kandidaten oder Ambitionen auch nur in Erwägung zu ziehen. Bevor wir noch auf den Mainzer Erzbischof zu sprechen kommen, noch einige Sätze zur brandenburgischen Stimme. Dem Brauch gemäß wäre die Kurstimme bei der Johanneischen Linie, da sie auf den erstgeborenen Markgrafen Johann I. zurückreichte, der seinem Bruder Otto III. seinerseits zwar freiwillig die uneingeschränkte Mitregentschaft einräumte, sich und seinem Zweig aber das Privileg der Königswahl vorbehielt. Jetzt, mehr als 30 Jahre nach dem Tod Johanns I. und Ottos III., machte Markgraf Otto V. das Vorrecht zur Königswahl innerhalb der brandenburgischen Zweigen, dem ältesten unter ihnen, Otto IV., seinem Vetter, zunehmend streitig. Otto V. hielt sich fast naturgemäß an sein ehemaliges Mündel, König Wenzel II. von Böhmen, zu dem, nach den Jahren des brandenburgischen Exils, gegen alle Erwartungen, weiterhin ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis bestand. Markgraf Otto IV. aus der Johanneischen Linie war bezüglich der Stimmausübung in einer Zwickmühle. Den Habsburger Albrecht lehnte er ab, die Episode um Lübeck war, obwohl Jahre zurückliegend, nicht vergessen. Das Verhältnis zu den Habsburgern blieb zu Lebzeiten Rudolfs I. unterkühlt. Otto IV. wollte sich nicht vom jüngeren Vetter in die böhmische Partei drängen lassen, sondern den eigenen Handlungsspielraum erhalten. In Ermangelung anderer Alternativen, blieb daher nur die Annäherung an den Block Erzbischof Siegfrieds von Köln.
Kommen wir noch auf den Mainzer Erzbischof Gerhard II. von Eppstein zu sprechen. Dieser war ganz antihabsburgisch, wozu wesentlich die königliche Politik in Thüringen eine Rolle spielte und mit den Mainzer Interessen in diesem Gebiet kollidierten. Erinnern wir uns, Rudolf I. vergab das Reichsvikariat für Sachsen, gemeint ist der Norddeutsche Raum, und Thüringen, womit der mitteldeutsche Raum ostwärts der Landgrafschaft Hessen zu verstehen ist, 1280 an die askanischen Fürsten in Sachsen und Brandenburg, womit der Einfluss der Mainzer Erzdiözese in Thüringen bewusst vom König ausgehebelt werden sollte. Gerhard von Eppstein unterstützte demgemäß ebenfalls den Grafen Adolf von Nassau, der dem Mainzer Kirchenfürsten nicht nur seine alten Rechte auf das Vikariat in Thüringen in Aussicht stellte, sondern auch zahlreiche thüringische Burgen. Die Angelegenheit verkomplizierte sich dadurch, dass Adolf von Nassau vom Kölner Erzbischof, dem in Reichsangelegenheiten geradezu natürlichen Rivalen des Mainzer Metropoliten, ins Spiel gebracht wurde und Erzbischof Siegfried anlässlich der anstehenden Wahl die Initiative an sich riss, womit er seinen Mainzer Amtskollegen herausforderte, der darin seit alters her das Vorrecht bei Mainz sah. Entsprechend kam es, obwohl man den gleichen Kandidaten unterstütze, zu diplomatischem Geplänkel, auf das hier nicht weiter eingegangen wird.
Das Jahr 1291 ging zu Ende, ohne dass es zur Königswahl kam. Alle Seiten brachten sich in Positur, sie fühlten vor, was sie von welchem der Kandidaten für die Zusage ihrer Kurstimme zu erwarten hatten. Adolf von Nassau wusste wie er Wenzel locken konnte und stellte den Wiedererwerb Österreichs, Kärntens und der Steiermark in Aussicht. Ernst konnte er es damit nicht meinen, doch reichte es um Böhmen zu locken und in dessen Schlepptau auch Sachsen zu gewinnen. Hinsichtlich Brandenburg konnte er zur Not, sollte Otto IV. sich sträuben, auf Otto V. zurückgreifen, der für das Wahlprivileg seine Stimme gern gegeben hätte und dies umso mehr, als er mit Wenzel ohnehin in Sachen Königswahl im Einvernehmen stand. Otto IV. blieb nur die Wahl Adolfs übrig, demgemäß galt es daraus Kapital zu schlagen. Im Todesjahr des alten Königs erwarb Otto IV. die Mark Landsberg, den nördlichen Teil davon. Es handelte sich dabei um einen Landstrich nördlich von Leipzig, zwischen Saale und Mulde, der 1261 vom damaligen Markgrafen Heinrich III. von Meißen, über den wir im Zuge des Teltow-Kriegs vor einigen Kapiteln berichtet hatten, für seinen jüngsten Sohn Dietrich eigens geschaffen wurde. Die widerrechtliche Zerstückelung eines Reichsterritoriums ohne Zustimmung des amtierenden Königs oder Kaisers, war gegen geltendes Recht, blieb aber damals ohne Folgen. 1285 starb Dietrich kinderlos auf der Rückreise vom Ordensstaat, wo er wiederholt den Deutschen Ritterorden im Kampf gegen die Prußen unterstützte. Das Gebiet fiel an den älteren Sohn Heinrichs III., an Albrecht den Entarteten. Dieser verkaufte aus Geldnot 1291 das Markgrafentum Landsberg an Brandenburg. Um den reichsrechtlich wackeligen Besitz von königlicher Seite legitimieren zu lassen, war Otto IV. bereit Adolf im Gegenzug der Anerkennung, die seine brandenburgische Kurstimme bei der Königswahl zu geben.
Die Würfel waren im Grunde gefallen, das erkannte nun auch der Mainzer Erzbischof. Sein Kölner Amtskollege hatte ihm den den Rang abgelaufen. Er musste aufpassen, dass dieser nicht auch noch den Wahltag bestimmte und ihm auch dieses wichtige Privileg abspenstig machen würde. So sputete er sich die Wahlfürsten auf den 2. Mai nach Frankfurt zur Wahl zu laden. Es musste in Jedermanns Interesse liegen, die Wahl zweier Könige zu vermeiden, denn noch hatte Pfalzgraf Ludwig seinen Habsburger Kandidaten und Schwager nicht aufgegeben, diesem am 13. April 1292 in München sogar geschworen, niemand anderem als ihn, Albrecht von Österreich die Stimme zu geben. Sollte ein kriegerischer Thronstreit verhütet werden, musste jetzt schnell gehandelt werden, bevor Albrecht, wie die Gerüchte es schon besagten, mit einem Heer Richtung Frankfurt auf dem Weg war. Schließlich kam es mit dreitägiger Verspätung am 5. Mai zum anberaumten Wahlakt. An diesem Tag erst erschienen die Bevollmächtigten des böhmischen Königs, der nach eidlicher Aussage der Gesandten unpässlich wäre und daher nicht selbst in Frankfurt erschien. Die böhmischen Abgesandten übertrugen auf Geheis Wenzels II. dessen Stimme auf Erzbischof Gerhard von Mainz. Die Mehrheitsverhältnisse war jetzt klar zugunsten des Nassauer Grafen Adolf. Pfalzgraf Ludwig sah ein, dass sein Schwager Albrecht nicht mehr durchzusetzen war und gab letztlich seine Stimme dem Grafen, ebenso der Erzbischof von Trier, so dass es zu einer einstimmigen Wahl kam.

Auf die Kür zu Frankfurt, folgte am 24. Juni 1292 die Krönung in Aachen. Die Zeremonie wurde vom Kölner Erzbischof Siegfried durchgeführt, der mit größtem Wert darauf pochte, dass der Krönungsakt über dem Wahlakt stehe, womit die Rivalität zum Mainzer Amtskollegen bezüglich des höheren Ansehens und Stands im Reich abermals deutlich zum Vorschein kam. Markgraf Otto IV. von Brandenburg war bei den Feierlichkeiten anwesend und blieb auch die folgenden Tage im Umfeld des neugekrönten Königs. Am 1. Juli sehen wir ihn unter den Zeugen, als Adolf der Reichsstadt Aachen, dem zwischenzeitlichen Brauch folgend, die Privilegien und Regalien bestätigte. Leider sind keine sonstigen Dokumente vorhanden, woraus weitere Aktivitäten oder gar Zuwendungen zugunsten des Brandenburger Fürsten ersichtlich würden. Wir können davon ausgehen, dass Otto IV. die Zeit im Kreis des Königs nutzte, um ihm zu huldigen und dafür seine Reichslehen vom König empfing. Vergleicht man die reichen Schenkungen und Zugeständnisse, wie sie die drei rheinischen Erzbischöfe erhielten oder Wenzel von Böhmen, sogar Pfalzgraf Ludwig, so erscheint es verwunderlich, dass Brandenburg, dass seine markgräflichen Regenten, scheinbar leer ausgingen. Viel Aufsehen wurde augenscheinlich nicht darum gemacht, wir lesen zumindest an keiner Stelle von irgendwelchen Verstimmungen. Man kann es als Indiz werten, dass Brandenburg eben nicht ganz leer ausging, bzw. im Hinblick auf den weiter oben erwähnten Kauf der Mark Landsberg vom König in vollem Umfang die bislang wackelige Belehnung erhielt. In Sachen Reichspolitik führten die momentan regierenden Markgrafen alle mehr oder weniger das seit Generationen unter den brandenburgischen Askaniern zurückhaltende, teilweise gänzlich ausbleibende Engagement fort, doch trat hier eine merkliche Änderung ein. Wundern kann man sich über das fehlende Engagement schon verwundert dies nicht schon. Bei der großen Zahl von Brüdern, Halbbrüdern und Vettern, wären zumindest bei einem oder zwei diesbezüglich mehr Ambitionen zu erwarten gewesen. Und gerade die latente Rivalität beider brandenburgischen Linien war vorzüglich dazu geeignet, sich zur eigenen Vorteilsgewinnung dem König anzubiedern. Unter Rudolf I. war sicherlich der langjährige Konflikt mit Markgraf Otto V. ausschlaggebender Hinderungsgrund, während die Vertreter der Johannenischen Linie, allen voran Otto IV., mit den zahlreichen Konflikten der Zeit alle Hände voll zu tun hatten. Alles in allem dürfte die Expansionspolitik im ostelbischen Raum und jenseits der Oder im Hinblick auf Brandenburgs Interessen im letzten Drittel des 13. Jahrhundert von deutlich wichtigerer und aussichtsreicherer Bedeutung gewesen sein, als die Nähe zum jeweiligen, zumeist schwachen Königshaus, das seit dem Ende der Staufer von vier, bzw. fünf verschiedenen Dynastien gestellt wurde. Mischte sich das jeweils amtierende Reichsoberhaupt, gleich wer immer es auch war, nicht weiter in die regionalen Verhältnisse im ostelbischen Raum und jenseits davon ein, war für die Markgrafen allemal mehr gewonnen, als der Reichsdienst es wohl je hätte vermocht.
Markgraf Otto IV.
Die bisherige Geschichtsschreibung erwähnt im Anschluss an die Regierungszeit der beiden großen markgräflichen Brüder Johann I. und Otto III. für gewöhnlich Otto IV. als den maßgebliche Regenten, der die Geschicke Brandenburgs bis ins 14. Jahrhundert hinein bestimmte. Ein Blick in die überlieferten Schriftstücke zwischen 1266/67 und 1300 zeichnet allerdings ein anderes Bild. Mit dem Tod Ottos III. im Jahre 1267, kam es in den von ihnen seit 1258 in drei Wellen geschaffenen Landesteilen, zu jenen beschriebenen teilselbstständigen Regierungen, wie es zuvor in groben Zügen festgelegt wurde. Dabei war nicht nur jeweils der älteste beider Hauptlinien, der Johanneischen und der Ottonischen, Regent, sondern auch innerhalb dieser Linien die sonstigen volljährigen Söhne. Den Erstgeborenen beider Zweige kam dennoch die frühe Geburt zugute, was sich bei Johann II. beispielsweise im Vorrecht zur Königswahl bemerkbar machte.
Die aufgeheizte politische Lage, die zahlreichen Konflikte mit nahezu allen Nachbarn, Böhmen bildete durch die enge Verwandtschaft zur Ottonischen Linie und Braunschweig zur Johanneischen die Ausnahme, verhinderten den Ausbruch offener Rivalitäten innerhalb des brandenburgischen Markgrafenklans. Doch Heiratsverbindungen alleine waren aber kein Garant für Frieden mit den Nachbarn, wie das Beispiel Großpolens zeigte. Wenn widerstreitende Interessen aufeinandertrafen, halfen auch Verschwägerungen nichts. Trotz der Verwicklungen nach außen, konnten auf Dauer innerhalb der brandenburgischen Askanier Zusammenstöße nicht ganz ausbleiben, nicht bei so vielen Regenten. Dass Interessenskonflikte bestanden, zeigte sich schon anlässlich der Wahl Rudolfs von Habsburg zum römischen-deutschen König. Otto V. versucht sich und den von ihm seit dem Tod des älteren Bruders geführten Zweig aus der zweiten Reihe treten zu lassen und im Bezug auf das Wahlrecht die gleichen Rechte eingeräumt zu bekommen. Zum offenen Streit oder Bruch kam es dabei nicht, die Angelegenheit wurde zwischen Johann II. einerseits und Otto V. anderseits latent ausgetragen.

Als auch im johanneischen Zweig der Erstgeborene verstarb, trat nun Otto IV. mit energischerem Auftreten für das ältere Vorrecht seines Zweigs ein. Der bislang unterdrückte Machtkampf beider Vetternlinien gewann an Schärfe. Es kam in der Folge zwischen beiden Zweigen wenigstens zweimal zu kriegerischen Auseinandersetzungen, wobei anlässlich des ersten Vorfalls noch der nachsichtigere Johann II. lebte. In beiden Fällen waren vordergründig zwar unterschiedliche Bündnisse Ursache und nicht offen ausgebrochene Konflikte untereinander, doch bleibt ein Beigeschmack zurück. Das erste Mal, weiter oben wurde davon berichtet, stand Otto IV. als Verbündeter des Herzogs Albrecht von Braunschweig bei dessen Fehde gegen den Bischof von Hildesheim, ein leiblicher Bruder des Welfen, gegen Vetter Albrecht III. von Brandenburg gegenüber. Es kam glücklicherweise nicht zum Kampf. Albrecht setzte sich am Vorabend der erwarteten Schlacht mit seinem Kontingent vom Lager des verbündeten Erzbischofs von Magdeburg ab, beides waren die Alliierte des Hildesheimer Bischofs. Er wollte einem Kampf mit dem Verwandten auszuweichen, womit er die kampflose Niederlage seiner Alliierten einleitete. Ganz offenbar hatte er wenig Zweifel dass Otto IV. es auf einen Waffengang hätte ankommen lassen. Bruder Otto V., damals seit kurzer Zeit Verweser Böhmens, eilte in die Altmark um zu vermitteln, auch er schien die Entschlossenheits des Vetters nicht zu bezweifeln. Der baldige Friedensschluss verhinderte Schlimmeres. In den frühen 1290‘er Jahren standen sich dann Otto IV. und Otto V. südwestlich von Brandenburg an der Havel, bei Ziesar gegenüber. Otto V. war als Schwiegervater des schlesischen Piasten Heinrich IV., dem Herzog von Schlesien und seit 1288 als Heinrich III. gleichzeitig Seniorherzog von Polen, an dessen Seite. Diesmal war ein Zusammentreffen nicht mehr zu vermeiden und es kam beim erwähnten Ort zur Schlacht aus der Otto IV. als Sieger hervorging. Details zum Hergang, sowie die Zahl der Truppen oder Verluste sind nicht bekannt. Vielleicht war der Unterlegene zögerlich, scheute wie schon einst der jüngere Bruder den Kampf mit dem Verwandten. Vielleicht war der Sieger entschlossener und sah überhaupt in dem Zusammentreffen die geeignete Gelegenheit seinen Führungsanspruch geltend zu machen. Wir können es letztendlich nicht beantworten, doch gewann Otto IV. zunehmend die Kontrollen hinsichtlich der brandenburgischen Politik und man konnte mittlerweile von einer Dominanz seinerseits sprechen.
Aus dem langen Konflikt mit dem Erzstift Magdeburg wissen wir noch gut, dass Otto IV. trotz wiederholter Niederlagen, trotz Gefangennahme und kostspieliger Auslösung, trotz gefährlicher Verletzung durch einen Pfeil, dessen Spitze er längere Zeit in der Stirn trug, seine Ziele mit großer Beharrlichkeit und Ausdauer verfolgte. Eine Eigenschaft, die Ausdruck besonderer Zähigkeit und eisernem Durchhaltewillen war. Doch nicht nur durch seine zahlreichen Feldzüge, in brandenburgischer Sache oder als Waffengefährte von Verbündeten, war der Markgraf im Reich bekannt. Er war daneben wegen seiner Fertigkeiten als Turnierkämpfer ebenso bewundert, wie als Minnesänger, wenn auch auch in der letztgenannten Disziplin nicht zu den Meistern der Zeit gehörte. Immerhin sieben seiner Lieder sind in Mittelhochdeutscher Sprache überliefert.
 Im Codex Manesse, dem berühmtesten erhaltenen Liederbuch des Mittelalters in deutscher Sprache, taucht Otto IV. unter den insgesamt 138 reich kolorierten Miniaturen schon früh, an prominenter sechster Stelle auf, nach Kaiser Heinrich, drei Königen und einem Herzog. Das Liederbuch, seit 1888 in der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbewahrt, wurde Anfang 1300 begonnen, also noch zu Lebzeiten des Markgrafen. Fast alle im Codex verewigten Protagonisten waren zu dieser Zeit längst verstorben. Otto IV. war im Reich augenscheinlich so etwas wie eine lebende Legende geworden. Die Pfeilverletzung am Kopf und die spektakuläre Tatsache, dass sie über einen längeren Zeitraum in der Stirn verblieb, hinderte ihn nicht daran seinen vielfältigen Geschäften nachzugehen, wozu auch die Fortführung diverser Feldzüge gehörte. Vermutlich trug speziell dieser Umstand zur Legendenbildung bei.
Im Codex Manesse, dem berühmtesten erhaltenen Liederbuch des Mittelalters in deutscher Sprache, taucht Otto IV. unter den insgesamt 138 reich kolorierten Miniaturen schon früh, an prominenter sechster Stelle auf, nach Kaiser Heinrich, drei Königen und einem Herzog. Das Liederbuch, seit 1888 in der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbewahrt, wurde Anfang 1300 begonnen, also noch zu Lebzeiten des Markgrafen. Fast alle im Codex verewigten Protagonisten waren zu dieser Zeit längst verstorben. Otto IV. war im Reich augenscheinlich so etwas wie eine lebende Legende geworden. Die Pfeilverletzung am Kopf und die spektakuläre Tatsache, dass sie über einen längeren Zeitraum in der Stirn verblieb, hinderte ihn nicht daran seinen vielfältigen Geschäften nachzugehen, wozu auch die Fortführung diverser Feldzüge gehörte. Vermutlich trug speziell dieser Umstand zur Legendenbildung bei.
Trotz aller Prominenz im Reich und der zwischenzeitlichen Akzeptanz seines Führungsanspruchs innerhalb der brandenburgischen Regenten, von denen zwar die ältesten zwei verstorben, dafür aber selbst die jüngsten herangewachsen waren, zum Teil sogar schon eine zweite Generation der Mündigkeit entgegenstrebte, warf seine eigene Kinderlosigkeit einen dunklen Schatten über ein sonst schillerndes Dasein. Die Geburt eines Nachfolgers, überhaupt die Geburt eines Kindes, war ihm nicht vergönnt. Er verbitterte daran mit zunehmendem Alter und fügte sich erst in späten Jahren dem Gedanken einen Neffen in die Regierungsgeschäfte einzuführen und an seiner Seite zu dulden, doch davon später.
Gebietserwerbungen
Eine umfassende Landnahme durch Unterwerfung heidnischer Gebiete, wie sie unter den Vorvätern seit Albrecht I. erfolgte, war in dieser Generation nicht mehr möglich. Hierzu hatten sich die Vorraussetzungen fundamental geändert. Die letzten Flecken autonomer, mit heidnischen Slawen bewohnter Landstriche östlich und besonders westlich der Oder waren verschwunden, alles war unter die Herrschaft christlicher Fürsten gelangt. Die früh christianisierten Reiche Böhmen und Polen, letzteres war zwischenzeitlich in eine Reihe teilunabhängiger Herzogtümer zersplittert, nahmen eine Sonderrolle ein. Die am Übergang vom Früh- zum Hochmittelalter von ihren Anführern betriebene Selbstchristianisierung, war dem damaligen Druck und den Verhältnissen der Zeit geschuldet. Hierdurch bewahrten sie sich und ihre Völkerschaften vor zu erwartender Fremdherrschaft. Dem Beispiel und gleichen Druck folgend, wenn auch deutlich später, sehen wir Pommern und andere slawischen Gebiete entlang der Ostseeküste, zwischen der Trave im Westen und der Weichsel im Osten vorgehen. Auch dort erkannte man die Zeichen der Zeit und beugte sich dem Unvermeidbaren. Zunächst bekannten sich die Stammesfürsten, mit ihnen der untergeordnete regionale Adel formell zum Christentum. Dass sie weiterhin ihre Bräuche in fast unveränderter, altbekannter, nun christlich adaptierter Weise betrieben, sei nur am Rande erwähnt. Sie unterschieden sich darin nicht von den Praktiken der einst christianisierten Germanen. Ein großer Teil der kirchlichen Feiertage fußt bis heute auf alten Festen und Bräuche bekehrter Heidenvölker.
Im unmittelbaren Einzugsbereich des römisch-deutschen Reichs gab es am Übergang ins Spätmittelalter keine zu bekehrenden Heiden mehr, wodurch die Unterwerfung nicht christlicher Gebiete eine Ende fand. Die brandenburgischen Markgrafen seit Albrecht I. waren in diesem Zusammenhang zweifelsfrei die großen Gewinner. Vor dem Jahr 1150 bestand der askanische Besitz bis auf wenige und bescheidene Gebiete in der rechtselbischen Zauche und um Havelberg, aus anhaltinischem Streubesitz und der Altmark links der Elbe, damals noch als die Nordmark bekannt. Diese Nordmark waren die Gebietsrelikte der von Kaiser Otto I. errichteten einstigen Grenzmark. Die Regionen rechts der Elbe gingen bekannterweise während der großen Slawenaufständen 983 verloren. Nach einem ereignisreichen Sommer 1156, wurde die Mark Brandenburg geschaffen. Sie wurde nicht in einem feierlichen Akt konstituiert und ausgerufen, zumindest belegen diese keine erhalten gebliebenen Zeugnisse, und doch kann man dieses Jahr zweifelsfrei als Geburtsjahr betrachten. Seither expandierten die brandenburgischen Markgrafen für die nächsten 100 Jahren weiträumig nach Osten, wobei nicht nur nur das eigene Herrschaftsgebiet erweitert wurde, gleichzeitig wanderten die Grenzen des römisch-deutschen Reichs, des Heiligen Römischen Reichs wie es mittlerweile hieß, bis zur Oder und darüber hinaus. Jetzt an der Schwelle der Zeitenwende ins Spätmittelalter waren bis auf einige unbesiedelte, wilde Reste im Grenzgebiet zwischen Polen, Pommern, Pommerellen und der brandenburgischen Neumark, kein nicht beanspruchtes Territorium mehr übrig und kein weiteres Wachstum mehr möglich. Eroberungen von Ländereien eines anderen christlichen Fürsten waren ungleich schwieriger, bedurften berechtigter Ansprüche und führten dabei in der Regel zu allerlei Verwicklungen. Die ohnehin existierende Rivalität untereinander wurde dadurch nur weiter geschürt und belastete das empfindliche ausschlagende Machtgleichgewicht. Wenngleich es Kriege und Fehden untereinander in ungezählter Menge gab, waren Annexionen weitaus seltener. Sofern es nicht zu einem deutlichen Sieg auf dem Schlachtfeld kam, so dass der Sieger die Bedingungen diktieren konnte, endete eine gewaltsame Auseinandersetzung entweder auf dem Status Quo, oder man verglich sich auf monetärer Ebene. Nicht selten blieben die Kriegsparteien auf ihren Ausgaben sitzen, wobei faktisch die geplünderten Bauern, Klöster und Ortschaften die eigentliche Zeche zahlten. Für Brandenburgs Markgrafen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bestand nur wenig Hoffnung dem erfolgreichen Beispiel der Väter nacheifern zu können. Aus den veränderten Rahmenbedingungen mag die beharrliche Vorgehensweise im Zusammenhang mit dem Erwerb des Erzbischofamts von Magdeburg zu erklären sein. Die Aussicht einen strategischen Kirchenposten besetzen zu können, sollte die fehlenden territorialen Expansionsmöglichkeiten kompensieren und den Einfluss Brandenburgs im sächsischen Raum weiter auszubauen. Dies war umso deutlicher von Markgraf Otto IV. in Angriff genommen worden, als die unter Otto III. eingeleiteten Kolonisationsversuche im Ordensland, südlich der Festung Königsberg, an den Machtverhältnissen im Baltikum letztendlich scheiterten. Der sich schnell konsolidierende Ordensstaat ließ keine rivalisierenden Kolonisationsambitionen in seinem Einflussgebiet zu und so behielt die am Frischen Haff gegründete Burg und Siedlung zwar den Namen Brandenburg, stand aber fortan unter der vollen und souveränen Kontrolle des Deutschen Ordens und wurde in den Ordensstaat inkorporiert.
Trotz der geschilderten, erschwerten Bedingungen, wuchs das Gebiet der Mark Brandenburg sichtlich weiter. Die Landzunahme war sogar größer als bei allen bisherigen Markgrafen und übertraf sogar die Landnahme Johanns I. und Ottos III. Die Art und Weise ist hierbei erwähnenswert. Es geschah, auf eine größere Ausnahme kommen wir noch im nächsten Unterkapitel zu sprechen, nicht durch Unterwerfung und Kolonisation von Heidenland, auch nicht durch blutige Eroberungen oder Feldzüge, an denen es gleichwohl nicht mangelte, die aber zu keinen erwähnenswerten Zuwächsen führten und die nur wieder neue Konflikte heraufbeschworen hätten, sondern durch Zukäufe, oder wie im Falle der Oberlausitz, durch Einflussnahme auf den böhmischen Thronerben Wenzel II., worüber ausführlich geschrieben wurde. In einem erwähnenswerten Fall, auf den wir wie geschrieben noch im nächsten Abschnitt zu sprechen kommen, der die nordöstlichen Teile der Neumark um Dramburg und Schievelbein betrifft, sowie Driesen und weitere Gebiete entlang der Netze, war das Schwert, war kriegerische Eroberung und nicht Kauf oder Erbe, der ausschlaggebende Expansionsfaktor.

Den 1290 vorgenommen Erwerb des nördlichen Teils der Mark Lausitz ohne das Gebiet um das südlich gelegene Leipzig, das sich erfolgreich dagegen wehrte, sowie die östlich gelegene Landschaft um Torgau an der Elbe durch Otto IV., erwähnten wir bereits im Abschnitt rund um seine Stimmabgabe für Adolf von Nassau. Im Jahr darauf erwarb er zusätzlich die nordwestlich angrenzende Pfalz Sachsen, mit Sangerhausen als Mittelpunkt. In beiden Fällen handelte es sich wie schon dargelegt, reichsrechtlich um vom vorherigen Lehnsnehmer, dem Markgrafen Heinrich III. dem Erlauchten, unberechtigt abgetrennte Landesteile, mit dem Zwecke den jüngeren Söhnen ein eigenes Erbe und Refugium zu schaffen. Mit deren vorzeitigem Tod, fielen sie an den erstgeborenen Sohn des erwähnten Heinrich, der sie dann anlässlich unvorteilhaft für ihn verlaufender Streitigkeiten, an Otto IV. von Brandenburg veräußerte.
Die Expansion der Mark verlief nun erstmals in großem Stil in südliche Richtung, und damit erstmals nicht in unerschlossenes, infrastrukturell wenig oder gar nicht ausgebautes, entsprechend unergiebiges Land, sondern in Gegenden, die schon vor Generationen den dort ursprünglich siedelnden Slawen abgetrotzt und mit deutschen Siedlern bevölkert und ausgebaut wurde. Zumindest traf dies auf die Mark Landsberg, auf die Pfalz Sachsen und das Gebiet um Torgau zu. Mit der Oberlausitz, und seit dem Erwerb 1303 mit der Niederlausitz, verhielt es sich anders. Sie waren auch damals noch stark mit durch Slawen besiedelt und nich heute hat sich dort eine entsprechende Landsmannschaft mit eigener Folklore gehalten. Das die heutigen Menschen slawischer Abstammung selbstverständlich in gleicher Weise deutsche Staatsbürger, ja Deutsche sind, muss hier natürlich nicht geschrieben werden. Dass sich in diesem Raum, besonders im Spreewald, bis heute die Sprache und auch eigenes Brauchtum gehalten hat, ist aber immerhin erwähnenswert, stellt es doch eine bemerkenswerte Ausnahme dar. Der Kauf der Niederlausitz, die von Markgraf Dietrich III., einem Sohn Albrechts des Entarteten, veräußert wurde, bildete den bisherigen Höhepunkt territorialer Erwerbungen. Hierdurch wurde die bislang isoliert gelegene Oberlausitz mit den brandenburgischen Kernlanden verbunden. Einer weiteren, fränkisch-thüringische Gebietsvergrößerung, widmen wir ein eigenes Unterkapitel, weswegen an dieser Stelle darauf nicht näher eingegangen wird.
Addiert man die Fläche der damaligen Landerweiterungen auf, wuchs die Mark um etwa die Hälfte seiner bisherigen Größe an. Es wurde an anderer Stelle erwähnt, Fläche spielte in den dünn besiedelten Landschaften im Osten des Heiligen Römischen Reichs eine untergeordnete Rolle. Es war der Besitz von Städten, oder gut erschlossenen Landschaften, der ein Gebiet für den Landesherren wertvoll machte. Sangerhausen in der Pfalz Sachsen, Landsberg in der gleichnamigen Markgrafschaft, Torgau an der Elbe, Cottbus und Spremberg in der Niederlausitz oder Bautzen und Görlitz in der Oberlausitz, waren die Kleinode dieser Erwerbungen. Auf ihren Besitz gründete sich der Zukaufswert, von dort kamen die hauptsächlichen Impulse des weiteren Landesausbaus. Es waren wohl diese territorialen Vergrößerungen, die Markgraf Otto IV. erst zum führenden Kopf und eigentlichen Hauptregenten Brandenburgs machten.
Krieg um das Erbe in Pommerellen
Wir gehen wieder ins Schlussjahrzehnt des 13. Jahrhunderts zurück. Die Mark Landsberg und die Pfalz Sachsen waren erworben, noch nicht aber die Niederlausitz. An der Ostsee, im Herzog Pommerellen, starb Weihnachten 1294 Herzog Mestwin II., über dessen wechselhaftes, zwiespältiges und treuloses Verhalten wir im letzten Kapitel berichteten. Mit ihm erloschen die Samboriden im Mannesstamm. Sofort entwickelte sich zwischen Brandenburg und Polen ein Streit um den gewaltigen Nachlass. Bald wurde noch der östlich angrenzende Deutsche Orden mit hineingezogen und auch das Herzogtum Pommern als auch Rügen waren nicht unbeteiligt. Dass es nicht bei einem Streit auf diplomatischer Ebene blieb, dürfte vor dem Hintergrund der Streitmasse auf der Hand liegen. Die Angelegenheit eskalierte erwartungsgemäß zum Erbfolgekrieg.
Bevor auf den Verlauf eingegangen wird, müssen die regionalen Machtverhältnisse erläutert werden, denn speziell Polen veränderten sie zu dieser Zeit die Verhältnisse ganz fundamental. Kurz ein Abriss der bisherigen polnischen Situation. Seit dem Jahr 1138, dem Todesjahr König Bolesław III. Schiefmund, war Polen in Einzelherzogtümer zerfallen. Bolesław hatte aus zwei Ehe insgesamt 16 Kinder. Er stand vor einem ähnlichen Dilemma, wie über hundert Jahre später die beiden brandenburgischen Brüder Johann I. und Otto III. Wie sollte er sein Königreich unter den Söhnen aufteilen und es gleichzeitig vor dem Zerfall bewahren? In seinem Testament verfügte er die Schaffung mehrerer Teilherzogtümer, deren Vorsitz ein sogenannter Seniorherzog hatte.
Es entstanden fünf mehr oder weniger autonome piastische Linien:
Kleinpolen (polnisch Małopolska): Die Residenz war Krakau, das zum Sitz des polnischen Königs wurde und auch in der Zeit, in der Polen von keinem König regiert wurde, wichtige, regelrecht sakrale Bedeutung hatte und administrativer Sitz der Seniorherzöge war. Weitere Zentren waren Lublin, Zamość und Sandomierz.
 Großpolen (polnisch Wielkopolska): Ursprung und Keimzelle des polnischen Staates, mit Gnesen und Posen als Zentren. Groß- bzw. Kleinpolen ist dabei irreführend und sagt nichts über die tatsächliche Landesgröße der Teilherzogtümer aus.
Großpolen (polnisch Wielkopolska): Ursprung und Keimzelle des polnischen Staates, mit Gnesen und Posen als Zentren. Groß- bzw. Kleinpolen ist dabei irreführend und sagt nichts über die tatsächliche Landesgröße der Teilherzogtümer aus.
 Masowien (polnisch Mazowieckie): Płock als eine der ältesten Städte Polens, war Mittelpunkt des Herzogtums. Durch weitere Teilungen gewann Warschau als regionales Zentrum an Bedeutung.
Masowien (polnisch Mazowieckie): Płock als eine der ältesten Städte Polens, war Mittelpunkt des Herzogtums. Durch weitere Teilungen gewann Warschau als regionales Zentrum an Bedeutung.
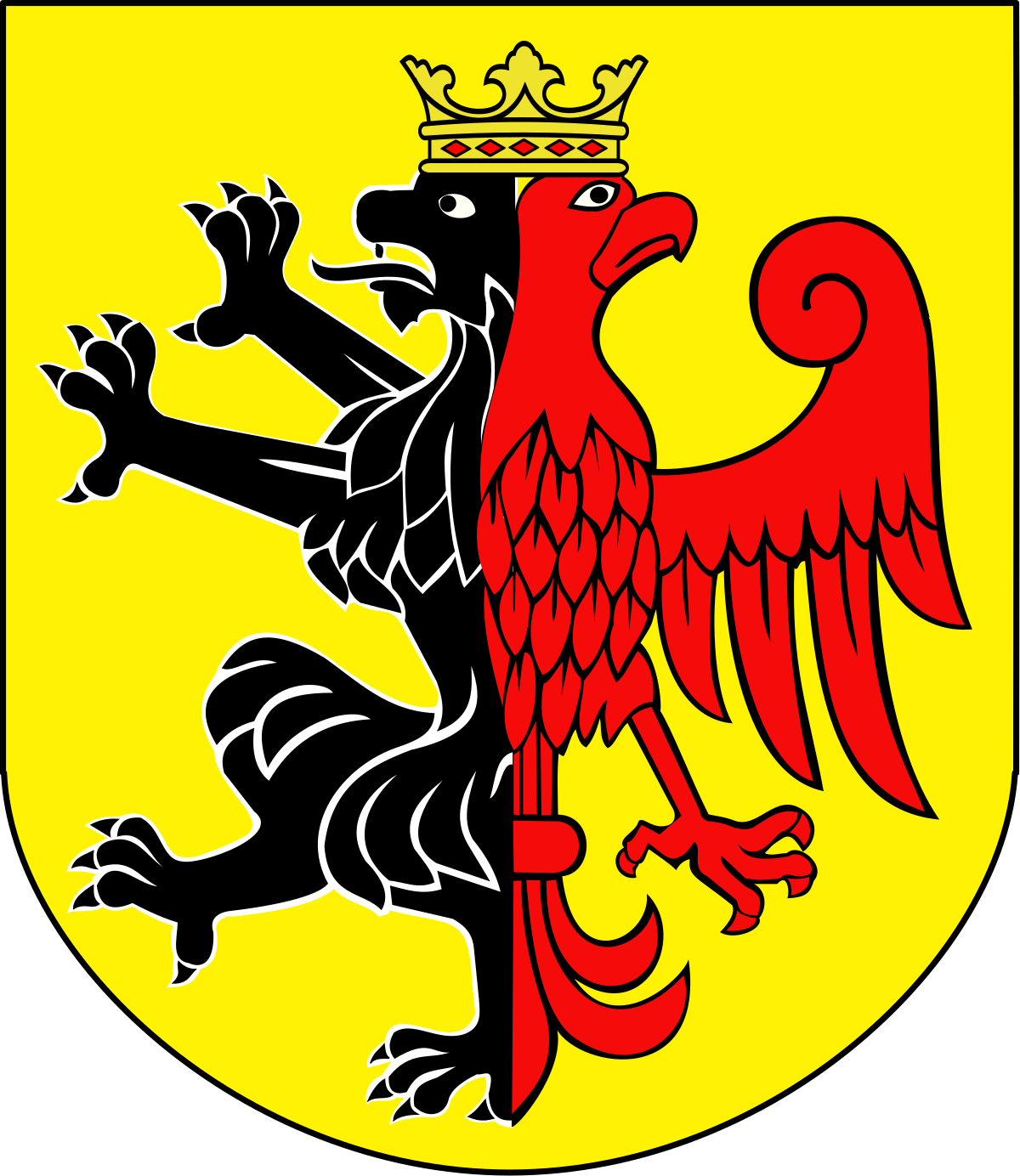 Kujawien (polnisch Kujawskie): Das kleinste der geschaffenen Herzogtümer lag zwischen Großpolen im Westen und Masowien im Osten. Das wichtigste Zentrum war Bydgoszcz (deutsch Bromberg)
Kujawien (polnisch Kujawskie): Das kleinste der geschaffenen Herzogtümer lag zwischen Großpolen im Westen und Masowien im Osten. Das wichtigste Zentrum war Bydgoszcz (deutsch Bromberg)
 Schlesien: Es grenzte in seiner gesamten Länge an das Königreich Böhmen und war von Beginn am meisten mit dem Reich verbunden. Sein erster Herzog, mit einer deutschen Fürstin verheiratet, strebte als gleichzeitiger Seniorherzog die Dominanz über die Teilherzogtümer seiner Brüder an, die sich daraufhin gegen ihn verbündeten und vertrieben. Die Söhne wuchsen an deutschen Höfen auf, kamen später in Schlesien zur Regentschaft. Schlesien spaltete sich früh in vier Herzogtümer auf und später in noch weitere. Die wichtigste Metropole war Breslau (polnisch Wrocław), heute die viertgrößte Stadt Polens.
Schlesien: Es grenzte in seiner gesamten Länge an das Königreich Böhmen und war von Beginn am meisten mit dem Reich verbunden. Sein erster Herzog, mit einer deutschen Fürstin verheiratet, strebte als gleichzeitiger Seniorherzog die Dominanz über die Teilherzogtümer seiner Brüder an, die sich daraufhin gegen ihn verbündeten und vertrieben. Die Söhne wuchsen an deutschen Höfen auf, kamen später in Schlesien zur Regentschaft. Schlesien spaltete sich früh in vier Herzogtümer auf und später in noch weitere. Die wichtigste Metropole war Breslau (polnisch Wrocław), heute die viertgrößte Stadt Polens.
Die fünf initialen Teilherzogtümer, richtigerweise muss man von piastischen Linien sprechen, unterlagen dauernden Veränderungen. Sie spalteten sich teilweise weiter auf und wuchsen wieder zusammen, in ähnlicher oder veränderter Konstellation. Die innerpolnischen Zerwürfnisse zwischen den konkurrierenden Piasten lähmte über Generationen die Staatsbildung Polens, was auf die erfolgreiche Bildung des Deutsch Ordensstaats entlang der baltischen Küste unmittelbaren Einfluss hatte.
In Großpolen, das östlich der brandenburgischen Neumark angrenzende polnische Herzogtum, regierte seit dem Jahr 1273 Herzog Przemysł II. aus der großpolnischen Linie der Piasten. Über die Mutter war er mit den schlesischen Piasten verwandt. Seine ältere Schwester Constanze war seit 1260 mit Markgraf Konrad verheiratet, dem jüngeren Bruder Ottos IV. und Mitregenten in Brandenburg, dessen persönlicher Herrschaftsbereich in der Neumark lag. Przemysł II. regierte zunächst im westlichen Teilherzogtum Großpolen-Posen und seit 1279, nach dem Tod des Onkels, ebenso über das südlich angrenzende Großpolen-Kalisch, was ihn zum Herrscher über das wiedervereinte Großpolen machte. Mit dem kinderlosen Herzog Mestwin II. bestand seit Februar 1282 eine Erbverbrüderung. Weiter existierte seit 1287 ein gegen Brandenburg gerichtetes Bündnis mit Herzog Bogislaw IV. von Pommern-Wolgast. Der treulose Mestwin II. hatte mit dem Erbbündnis ein zweites Mal den Lehnstreueeid gegenüber Brandenburg gebrochen und sich nun gänzlich Großpolen angeschlossen. Als er starb beanspruchte Przemysł II. das verwaiste Herzogtum an der Ostsee. Auch Bogislaw IV. von Pommern-Wolgast erhob Ansprüche in dem östlich an seine Ländereien angrenzenden Herzogtum. In Brandenburg waren augenblicklich alle inneren Streitigkeiten zwischen den rivalisierenden beiden Linien beiseite gelegt. Der zunehmend dominierende Otto IV. und Vetter Otto V. als die führenden Vertreter ihrer Linien, suchten aus der Erbmasse ihren Teil zu retten, wobei auf Danzig und die Burgbezirke Stolp, Rügenwalde und Schlawen das Hauptaugenmerk gelegt wurde. Brandenburg berief sich auf die Lehnseide des untreuen Vasallen einerseits, vor allem aber auf das zweifache kaiserliche Privileg der Lehnsoberhoheit bezüglich ganz Pommern, letztmals bestätigt von Kaiser Friedrich II. Dezember 1231. Am 8. Januar 1295, somit kurz nach dem Tod Mestwins II., ließen sich Otto IV. und Bruder Konrad auf dem königlichen Hoftag zu Mühlhausen in Thüringen vom amtierenden König Adolf I. die kaiserlichen Rechte auf Pommern von 1231 abermals bestätigen. Otto IV. gehörte in dieser Zeit zu den vom König geschätzten Parteigängern und wurde auf dem gleichen Hoftag bereits zum conservator pacis per terram, zum Landfriedenshüter im sächsischen Raum bestimmt. Für Großpolen und seinen Fürsten galt die kaiserliche Bulle Brandenburgs und selbstverständlich auch die gerade erfolgte Neubestätigung durch den römisch-deutschen König nicht als rechtskräftig. Przemysł II. betrachtete Pommerellen nicht als Teil des Reichs, entsprechend war für ihn weder die kaiserliche Bulle noch die königliche Bestätigung maßgeblich. Nur die Erbverbrüderung von 1282 hatte Relevanz.
Herzog Przemysł stand um diese Zeit auf dem Höhepunkt der Macht. Sein Einfluss innerhalb der polnischen Piasten war mit der Hilfe des Metropoliten von Gnesen, Erzbischof Jakub Świnka, der den bisherigen Einfluss deutscher Kleriker konsequent bekämpfte, so groß geworden, dass dieser ihn am 26. Juni 1295 in Gnesen zum König von Polen krönte. Nach über 200 Jahren hatte das Land wieder einen König, doch geeint war es nicht, dazu war die Zeit regionaler Autonomien, innerer Zerwürfnisse und anhaltender Kämpfe mit Böhmen zu lange gewesen. In Schlesien begann wenige Jahre davor der Schlussakt, welcher zur endgültigen Abnabelung von Polen und zur Hinwendung zum Heiligen Römischen Reich führte. 1289 löste sich zur Wahrung eigener Interessen das Herzogtum Cosel-Beuthe als erstes schlesisches Gebiet aus dem polnischen Lehnsverband und unterstellte sich der böhmischen Krone, wodurch es Teil des Reichs wurde. Dem Beispiel folgten in den nächsten fünf Jahrzehnten bis auf Schweidnitz, alle schlesischen Herzogtümer. Die schlesischen Piasten standen infolge generationenlanger Heiratsverbindungen mit deutschen Fürstenhäusern und durch den Zuzug deutscher Siedler, die mittlerweile den dominierenden Bevölkerungsanteil stellten, kulturell und politisch dem Reich näher, als den polnischen Wurzeln. Kleinpolen mit der Königsstadt Krakau war ebenfalls verloren gegangen. 1291 wurde das Gebiet vom böhmischen König Wenzel II. besetzt und seither gehalten.
In der Sache vereint, innerlich bis vor kurzer Zeit gespalten, standen Brandenburgs Markgrafen beider Linien jetzt zusammen und ließen sich von einem polnischen König, dessen begrenzte Möglichkeiten nur zu offensichtlich waren, hinsichtlich ihres Sukzessionsrechts in Pommerellen nicht abschrecken. Aus einer königlichen Urkunde Adolfs I., die vermutlich vom Dezember 1294 stammt, entnehmen wir, dass er den Hader beider führenden Köpfe der jeweiligen Zweige Brandenburgs geschlichtet hatte und beide Seite demgemäß ihre gegenseitigen Kriege und Auseinandersetzungen beilegten. Worum es im Einzelnen ging, schweigt sich das kurze Schreiben aus, auch ist sonst nichts mit Aussagekraft überliefert. Denkbar sind eine Reihe schwelender Probleme, die mindestens seit dem Waffengang bei Ziesar 1291 existierten. Damals war Otto V. wie schon geschildert von seinem älteren Vetter Otto IV. geschlagen worden. Zu Beginn dieses für Brandenburg so entscheidenden neuen Konflikts mit Großpolen und gegebenenfalls weiterer polnischer Teilherzogtümer wie Masowien und Kujawien, war man also leidlich ausgesöhnt. Man war bereit gemeinsam bis zum Äußersten und unter Anwendung von Waffengewalt die eigenen Rechte und Interessen durchzusetzen. Im Vorfeld schloss Otto IV. unter anderem im März 1295 ein Bündnis mit dem verwandten Herzog von Braunschweig-Lüneburg, als Rückversicherung im Westen der Mark. Mit Böhmens König Wenzel II. bestand über Ottos V. verwandtschaftliche Beziehung ohnehin das alte und gute Verhältnis, das ganz offenbar nicht unter den Jahren seiner Vormundschaft gelitten hatte. Nach den Kriegen 1270 bis 1272 und 1278/79, stand nun also die dritte kriegerische Auseinandersetzung um das Herzogtum an der Ostsee bevor. Die Markgrafen eröffneten die Feindseligkeiten, fielen mit ihren Heeren aus den damaligen Teilen der Neumark heraus in Posen und Pommerellen ein und verheerten die heimgesuchten Gebiete. Gleichzeitig unterhielt Markgraf Otto V. intensive Kontakte zu den Zaremba und Nałęcz, zwei polnischen Adelsgeschlechtern, die als führende Oppositionsgruppe gegen den neuen König agitierten. Die Erhebung des Herzogs von Großpolen zum König und die Schaffung einer zentralen Autorität, fand lange nicht überall Zuspruch im Hochadel, der seine liebgewonnenen Freiheiten gefährdet sah. Gemeinsam mit diesen vereinbarten er eine Entführung des polnischen Königs. Am frühen Morgen des 8. Februar 1296, bei völliger Dunkelheit, überfiel eine starke Gruppe das Lager des Königs, überwältigte die Wachen, wobei es zu Kampflärm kam, wodurch Przemysł und einige Getreuen erwachten und zu den Waffen griffen. Sie leisteten den Angreifern Gegenwehr, unterlagen aber der Übermacht. Schwer verwundet wurde der König auf ein Pferd gepackt um ihn auf brandenburgisches Gebiet zu verschleppen. Die Wunden waren allerdings ernst, es war fraglich ob die Geisel den Gewaltritt überleben würde. Über das Ende Przemysł II. existieren zwei unterschiedliche Versionen. Nach der in Polen polulären, wurde er getötet, nachdem wegen seines Zustands die Aussichtslosigkeit erkannt wurde und angeblich achtlos in den Schnee geworfen. Gemäß der anderen Version, fiel der stark ausgeblutete König ermattet vom Pferd und starb bald darauf an den Folgen seiner Verletzungen. Auf der Straße nach Sierniki, rund 5 km südöstlich von Rogoźno (deutsch Rogasen), ist er gestorben. Ob König Wenzel von Böhmen involviert war und falls ja, wie groß, seine Rolle war, ist auch heute noch umstritten. Seine eigenen Ambitionen bezüglich der Krone Polens lassen zumindest die berechtigte Annahme zu, dass die Tat, ja selbst der Verlauf und Tod Przemysłs seinen eigenen Plänen zuträglich war. Der verstorbene polnische Monarch hinterließ keinen Erben, wodurch die großpolnische Linie der Piasten im Mannesstamm erlosch. Polen zerfiel nach weniger als einem Jahr in Partikularismus. In Großpolen wurde mit Władysław zügig ein Vertreter der kujawischen Piasten zum neuen Herzog gewählt, doch beim Versuch gleichzeitig auch die königliche Nachfolge anzutreten, kam es zu erneuten innerpolnischen Konflikten die von den Brandenburgern und auch von Herzog Heinrich III. von Glogau, einem Vertreter des Glogauer Zweigs der schlesischen Piasten, ausgenutzt wurde. Brandenburg, das seit dem Herbst in der Offensive war, eroberte in den Wintermonaten die Gebiete Santok (deutsch Zantoch), Drezdenko (deutsch Driesen), Wałcz (deutsch Deutsch Krone), welche der Mark im Vertrag von Krzywin am 10. März 1296 zufielen.
Im nächsten Kapitel wird der weitere Verlauf und Ausgang des jahrelangen Konflikts weiter thematisiert.
Hennebergisches Erbe
Anlässlich des gescheiterten Entführungsversuchs Przemysłs, des Herogs von Großpolen und polnischen Königs, und während der um diese Zeit laufenden Eroberungen im neumärkischen Grenzgebiet, entlang von Warthe und Netze, sehen wir Markgraf Otto V. vom jüngeren Markgrafenzweig Brandenburgs das letzte Mal in der für ihn gewohnt federführenden Weise. Er war damals 50 Jahre alt. Ihm zur Seite stand seit 1290 regelmäßig Sohn Hermann. Ottos Bruder Albrecht III. hatte sich um die Mitte der 1280‘er abgesondert und führte mit seinen beiden Söhnen eine selbstständige, meist zurückgezogenere Politik, wenngleich wir auch ihn auf diversen Urkunden zeichnend wiederfinden. Anlässlich der Kämpfe mit Przemysłs, beiläufig erwähnt über seine Tochter Margarete seit 1291 ein Schwiegersohn Albrechts, trat ebenfalls in Waffen mit seinen Kontingenten auf der Seite seiner Verwandten an. Im Kampf gegen einen äußeren Feind, wenn es um die Durchsetzungen eigener Ansprüche ging, war der innere Friede und die Einheit gewährleistet.
Ottos Sohn Hermann, benannt nach dem Großvater mütterlicherseits, entstammte aus der Ehe mit mit Jutta von Henneberg. Sie war Tochter des Grafen Hermann I. von Henneberg-Coburg, einem alten thüringisch-fränkischen Adelsgeschlecht, dessen Wurzeln bis ins 11. Jahrhundert zurückzuverfolgen sind. Ihre Mutter, Margarethe von Holland, war die Schwester des verblichenen römisch-deutschen Königs Wilhelm von Holland. Vater Hermann gründete nach der Henneberger Erbteilung eine neue Herrschaft mit den regionalen Schwerpunkten im ostfränkischen Eisfeld und Coburg. Dezember 1290 starb Graf Hermann und Sohn Poppo erbte die Besitzungen. Als dieser schon 1291 ebenfalls verstarb, fiel das Gebiet, es war kein Reichslehen, sondern Allodialbesitz, an die Schwester Jutta und damit an ihren Gatten, den Markgraf Otto V. von Brandenburg. Dieser setzte in dem von allen brandenburgischen Gebieten weit entfernten Landesteil den edlen Herren Wolfgang von Barby als Landpfleger ein. Dieser war ein brandenburgischer Lehnsmann aus dem Altmärkischen und entfernt mit den Askaniern verwandt. Brandenburg, das vor weniger als 150 links der Elbe seinen Anfang nahm, dann sich entlang von Havel und Spree bis zur Oder ausbreitete, schließlich über diese hinweg die Neumark bis hart an die Küste der Ostsee vorantrieb, besaß jetzt im Schlussjahrzehnt des 13. Jahrhunderts Besitzungen, teils als Inseln, teils unmittelbar mit dem Kernland verbunden, in Polen, Thüringen, Franken, etc.
Im Windschatten Böhmens, dass durch den Schlachtentod Ottokars II. für mehr als ein Jahrzehnt aus dem Rennen geworfen wurde, gleichzeitig aber Brandenburg im Süden abschirmte, profitierend vom Partikularismus der polnischen und schlesischen Piasten und letztendlich erfolgreich beim Durchsetzen eigener Interessen im ostsächsischen Raum wie auch gegen ein norddeutsches Bündnis verschiedener Ostseestädte sowie deutscher Ostsee-Anainerstaaten, war Brandenburg die bestimmende Macht im Nordosten des Reichs geworden, nur noch gehemmt durch den Umstand einer fehlenden einheitlichen Regierung. Hinsichtlich der Regierungsdiversität bahnte sich nach Abschluss der ersten Kriegsphase im Erbfolgekrieg um den Nachlass im Herzogtum Pommerellen eine einschneidende Veränderung an. Nach dem Vertrag von Krzywin ließen die Kampfhandlungen nicht unbedingt nach, bestanden aber aus den üblichen Übergriffen die mit Plünderungen einhergingen. Brandenburg konsolidierte seine Eroberungen in der Neumark und machte in dieser Zeit dem neuen Herzog von Großpolen das Herzogtum Pommerellen nicht streitig. Dieser, sich statt sich mit den Brandenburgern um das Herzogtum zu streiten, lag jetzt mit dem böhmischen König Wenzel II., seit 1291 im Besitz von Kleinpolen, im Dauerkonflikt um die Krone Polens.
Das Verkümmern der Ottonischen Linie
1298 starb Markgraf Otto V. mit etwa 52 Jahren und wurde im Kloster Lehnin beigesetzt. Der genaue Todestag ist unbekannt. Die letzte von ihm ausgestellte Urkunde war vom 28. September 1298. Darin erteilte er Berlin, das zum ottonischen Zweig gehörte, das Stapelrecht und verkaufte der Stadt den landesherrlichen Flusszoll zu Köpenick für 220 Pfund Silberpfennige. Seit dem frühen Tod des älteren Bruders im Jahre 1268, lenkte er als Haupt der Ottonischen Linie fast 30 Jahre lang maßgeblich die Geschicke des jüngeren Familienzweigs der brandenburgischen Askanier. Durch seinen Einfluss auf den böhmischen König Wenzel II., der von 1278 bis 1283 des Markgrafen Mündel war, gelangte die Oberlausitz mit den Landschaften Bautzen und Görlitz an die Mark. Das Land war ursprünglich als Mitgift der Mutter, Prinzessin Beatrix von Böhmen, 1243 in den Pfandbesitz Brandenburgs gekommen, bevor es nach rund 40 Jahren 1283 an Brandenburg fiel.
Früh trat Otto V. gegenüber den Vettern aus dem älteren brandenburgischen Familienzweig als Rivale auf. Bereits bei der Wahl Rudolfs von Habsburg lotete er für sich und seine Linie die Möglichkeit zur Königswahl aus, musste aber hinter dem Vorrecht des älteren Vetters Johann II. zurückstecken. Während Markgraf Johann II. als Erstgeborener von Haus aus das bevorrechtigte Privileg zur Führung besaß, war es doch der nächstgeborene Bruder Otto IV., der mehr und mehr die Rechte der älteren Linie gegenüber dem rivalisierenden Vetternzweig durchzusetzen gewillt war. Konflikte, selbst bewaffnete Auseinandersetzungen, blieben nicht aus, wie wir gesehen haben. Markgraf Hermann erbte nun die Herrschaften seines verstorbenen Vaters, zu denen auch die fränkisch-thüringischen Gebiete des Coburger Landes gehörten.
Hermann übernahm nach dem dem Tod des Vaters ganz selbstverständlich die Leitung der Ottonischen Linie, was ihm der bevorrechtigte Albrecht III., sein Onkel, nicht streitig machte. Albrecht lebte schon geraume Zeit in relativer Zurückgezogenheit und verwaltete sein Refugium. Ein Jahr später traf diesen ein schwerer Schicksalsschlag, von dem er sich moralisch nicht mehr erholte. Seine beiden Söhne Otto und Johann kamen 1299 bei einem Überfall ums Leben. Zu ihrem und seinem eigenen Seelenheil machte er allerlei fromme Schenkungen von denen die Stiftung des Klosters Himmelpfort Coeli porta im Land Lychen, in der südwestlichen Uckermark den Höhepunkt bildete. Seit er sich aus der Mitregentschaft des Ottonischen Zweigs vor mehr als einem Jahrzehnt zurückzog, lag ihm die Schaffung eines eigenen Hausklosters als Grablege seiner Familie am Herzen. Als Zisterzienser-Filiation, Tochterkloster Lehnins, beabsichtigte er analog zu dem großen wirtschaftlichen Erfolg des Mutterklosters, eine Belebung jener ausgesprochen ärmlichen Region, die er für Himmelpfort vorsah. Um dem Kloster einen vorteilhaften Start zu gewährleisten, wurde es großzügig schon zu Beginn mit sechs Dörfern, zuzüglich 100 Hufen (1.700 ha) Land, zehn Mühlen mit allen Erträgen sowie einer imposanten Anzahl von mehr als dreidutzend Seen ausgestattet. Die Fertigstellung, selbst den Baubeginn des Klosters, erlebte Albrecht III. nicht mehr, er starb am 4. Dezember 1300 und wurde im Kloster Lehnin zu Grabe getragen. Erst im Jahre 1309, nachdem der Bau begonnen wurde und die ersten Mönche von Lehnin nach Himmelpfort übersiedelten, wurden seine sterblichen Überreste umgebettet.
Von den vier Söhnen des 1267 verstorbenen Ottos III., lebte jetzt nur noch der Jüngste, Markgraf Otto VI., besser gesagt der vormalige Otto VI., denn er trat 1286 dem Templerorden bei, resignierte allen Besitz und verzichtete auf Regentschaft und Erbfolge. Später trat er dem Zisterzienserorden bei und starb 1303. Von dem noch 1267 auf vier Schultern ruhenden brandenburgischen Familienzweig Ottos III., lebte nach einer Generation als letzter männlicher Nachkomme nur noch Markgraf Herrmann. Zwei seiner älteren Brüder waren noch vor dem eigenen Vater verstorben. Das gleiche Schicksal ereilte, wie wir sahen, die beiden Söhne seines Onkels Albrecht III., während Onkel Otto VI., obwohl mit einer Tochter aus Habsburger Hause verheiratet, kinderlos blieb und später wie erwähnt das Leben eines Klerikers einschlug. Johann III. der Prager, erstgeborener Sohn Ottos III., den Hermann nie kennenlernte, starb bekanntlich jung an den Folgen eines Turnierunfalls. Er war unverheiratet und demgemäß kinderlos.
Hermann war seit dem Tod Albrechts III. Universalerbe der Ottonischen Linie. Zu Otto IV. bestand zwar kein rivalisierendes Verhältnis, wie es zwischen diesem und seinem verstorbenen Vater Otto V. bestand, angespannt war es stellenweise dennoch. Aufgewachsen ist er unter anderem bei seinem Großvater in dem bereits erwähnten Coburger Land, wodurch er eine enge Verbindung mit diesen Gebieten hatte. 1302 erwarb er vom Wettiner Markgrafen Dietrich IV. auch als Diezmann bekannt, die östliche Niederlausitz. Im Jahre 1304 zusätzlich, diesmal gemeinsam mit Otto IV., den westlichen Teil. Um diese Zeit trat Brandenburg in feindschaftliche Opposition zum amtierenden König. Die Hergänge müssen erläutert werden, auch der 1298 erfolgte Wechsel an der Spitze des Reichs, wovon bislang nicht die Rede war.
Ein neuer König
Adolfs Wahl zum römisch-deutschen König im Mai 1292 erkaufte sich der Nassauer Graf durch umfangreiche Wahlversprechen gegenüber den Kurfürsten. Besonders der Kölner Erzbischof, welcher ihn als Gegenkandidat Albrechts von Habsburg, Sohn des dahingeschiedenen Königs, ins Spiel brachte und der junge König von Böhmen sahen wie die großen Profiteure aus. Brandenburg erhielt die königliche Anerkennung seiner strittigen Gebietskäufe zwischen Sangerhausen und Torgau. Für den neuen König ein willkommen günstiger Preis und für Brandenburg eine Bestätigung von großer Bedeutung und daher auch von realem Wert.
Die Geschicke Adolfs als Regent schienen eng vom Wohlwollen der rheinischen Kurfürsten abhängig zu sein, von denen ihm der Pfalzgraf bei Rhein und der Erzbischof von Trier überhaupt nur wegen ihrer unhaltbar gewordenen Lage widerwillig die Stimme gaben. An eine selbstständige Regierung konnte vor dem Hintergrund der geleisteten Zusagen nur in begrenztem Maße geglaubt werden. Es erstaunt umso mehr, dass Adolf von Nassau praktisch von Beginn an frei agierte und hinsichtlich seiner Versprechungen fast unbeeindruckt Bündnisse und Vereinbarungen einging, die hart an der Grenze zum Vertragsbruch lagen. Bezüglich Wenzel II. von Böhmen erfüllte der König überhaupt nichts von dem, was diesem wichtig war und wofür er ihm seine, wie auch die ihm vertraglich anvertraute Stimme aus Sachsen gab. Ursprünglich sollten die Herzogtümer Österreich, Steiermark, Kärnten, die Markgrafschaft Krain sowie die Windische Mark Albrecht von Habsburg entzogen und der Krone Böhmen verliehen werden, das nach dem Aussterben der Babenberger diese Gebiete annektierte, wenn auch ohne ein Recht. Adolf verglich sich stattdessen mit dem zu dieser Zeit betont zurückhaltend agierenden Albrecht und bestätigte ihm die Belehnungen. Wenzel lag in dieser Zeit mit Polen, Teilen davon, im Krieg und war für den Augenblick nicht in der Lage dem offenen Vertragsbruch des Königs zu begegnen, was ihn ohne jeden Zweifel sofort in kriegerischen Konflikt mit Albrecht von Habsburg gebracht hätte. Im Osten und im Süden wollte und konnte selbst der mächtige König von Böhmen nicht ohne Risiko zeitgleich agieren.
In Thüringen, wo der schon wiederholt erwähnte Albrecht der Entartete, Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen, mit den eigenen Söhnen im Krieg lag, engagierte sich der König und sucht aus dem Konflikt territoriale Vorteile zu ziehen um gegebenenfalls seine dürftige Hausmacht durch den Einzug der Mark Meißen zu erweiterten. Neben einer Reihe kleinerer Regionalfürsten, die ihrerseits aus dem Familienkrieg der Wettiner Kapital schlagen wollten, traf der König hier auf die Interessen von gleich vier Kurfürsten. Das Erzbistum Mainz hatte traditionell im thüringischen Raum großen Kirchenbesitz, der von den Wettinern dezimiert wurde und wo sich jetzt die Gelegenheit zur Revision der Verhältnisse ergab. König Wenzel fühlte sich nach des Königs Wortbruch hinsichtlich den Herzogtümern Österreich, Steiermark, Kärnten etc. abermals betrogen, denn Adolf hatte ihm die Mark Meißen als Kompensation für die vorgenannten Herzogtümer in Aussicht gestellt, wovon jetzt nicht mehr die Rede war. Die Vorgänge entlang der südlichen Grenzen des Herzogtums Sachsen-Wittenberg musste geradezu selbstverständlich den askanischen Herzog auf den Plan rufen, der einen eigenen Teil der Beute aus dem entstandenen Chaos ziehen wollte. Schlussendlich natürlich auch Brandenburg. Die Erwerbungen der Pfalz Sachsen, dem langgezogenen nördlichen Teil der Mark Landsberg und das Gebiet um Torgau, waren alle weder miteinander, noch mit dem brandenburgischen Kernland verbunden. Die Landschaften untereinander zusammenzuschließen und überhaupt so viel denn möglich an sich zu raffen, wenn sich nur die passende Gelegenheit dazu bot, war Gebot der Stunde.
In dieser Atmosphäre bildete sich jene Opposition der Kurfürsten, die schließlich zur Abwahl und Entmachtung des Königs führte, dem sie 1292 noch heilige Treueeide geschworen hatten. Es war ein unerhörter, bislang gänzlich unbekannter Vorgang. Das geltende, von alters her angewandte Recht sah es nicht vor, dass ein körperlich und geistig gesundes Reichsoberhaupt abgesetzt werden kann. Wohl hat der Papst mit der Absetzung Kaiser Friedrichs II. vor mehr als vier Dekaden, gewissermaßen einen Präzedenzfall geschaffen, doch fühlten sich die eidbrüchigen Kurfürsten bei ihrem Vorstoß nicht ganz wohl. Es überrascht nicht, dass die Absetzungsurkunde zahlreiche Phrasen beinhaltete, die seinerzeit in der päpstlichen Bulle wider Kaiser Friedrich II. stand. Alles in allem leiteten sie aus dem Recht zur Königswahl, das Recht zur Absetzung eines untauglichen Königs ab. Der 23. Juni 1298 war gleichzeitig Tag der Absetzung, wie auch Wahltag Albrechts von Habsburg zum neuen König. Der abgesetzte Adolf erkannte die Rechtmäßigkeit nicht an, aber darauf gehen wir im nächsten Kapitel erst näher ein.
Die Zahl der Askanier schmilzt zusammen
Die Nachwuchssituation des ottonischen Zweigs haben wir etwas weiter oben beleuchtet. 1302 lebte dort nur noch Markgraf Hermann der Lange und dessen im gleichen Jahr geborener Sohn Johann. Beim johanneischen Zweig sah es etwas besser aus, doch musste man sich auch dort sorgen, denn im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts starben auch dort die meisten Vertreter kinderlos weg. Selbst in den Reihen der nachgeborenen Generation hielt der Tod Einzug.
Schauen wir uns die Situation, bezogen auf die männlichen Nachkommen der Johanneischen Linie zum Abschluss dieses Kapitels etwas genauer an:
Der 1281 im Alter von 46 Jahren verstorbene Markgraf Johann II., erstgeborener Sohn Johanns I., hatte zwei Söhne, Konrad II. und Johann. Letzter war als Bischof von Havelberg 1292 nach nur einem Jahr verstorben, womit große Hoffnungen auf ein besseres Verhältnis mit dem Bistum zunichte gemacht wurden. Konrad II. folgte ihm 1308. Er hinterließ keine eigenen Nachkommen. Der Zweig Johanns II. erlosch.
Otto IV. mit dem Pfeil, seit dem Tod des älteren Bruders Haupt der Johanneischen Linie, sparen wir für das Ende auf.
Konrad I. war der dritte Sohn aus der ersten Ehe Johanns I. und starb 1304 mit rund 64 Jahren in gesegnetem Alter. Er hatte drei Söhne, Johann IV., der im Alter von 44 schon im Folgejahr starb. Otto VII. wurde später Tempelritter und schied aus der Erbfolge aus. Er starb 1308 starb. Schließlich Waldemar, der jüngste der drei Söhne Konrads. Er wurde zum Nachfolger und Erben Ottos IV.
Erich, nach drei Anläufen und jahrelangen Kriegen seiner Brüder, wurde er Erzbischof von Magdeburg. Schon als Kind für den geistlichen Stand vorgesehen, blieb er unverheiratet und damit kinderlos. Er war der vierte und jüngste Sohn Johanns I. und Sophia von Dänemark.
Es bleiben noch die drei Söhne aus Johanns zweiter Ehe, die er mit Jutta von Sachsen-Wittenberg führte. Fangen wir mit dem mittleren, dann dem jüngsten der drei an. Albrecht wurde 1258 geboren, dem Jahr als Johann I. und Bruder Otto III. mit der Teilung Brandenburgs begannen. Über diesen Albrecht, nicht zu verwechseln mit Albrecht III. aus dem ottonischen Zweig, ist sehr wenig bekannt, er starb schon 1290 mit wahrscheinlich 32 Jahren.
Hermann war der letzte Sohn Markgraf Johanns I. 1290 wurde er Bischof von Havelberg und starb zum Entsetzen seiner Halbbrüder schon im Jahr darauf. Johann, der zweite Sohn seines ältesten Halbbruders Johann II., wir erwähnten es, folgte ihm als Bischof im Havelberger Bistum und verstarb ebenfalls im Folgejahr. Eine Tragödie, denn man erhoffte sich durch die Besetzung des Bischofsstuhls mit einem Kandidaten aus dem eigenen Haus, die länger schon schwelenden Probleme mit dem Bistum zu beseitigen.
Kommen wir zum ältesten Sohn aus Johanns zweiter Ehe. Markgraf Heinrich, er erhielt den Beinamen ohne Land und sollte seine beiden leiblichen Brüder um fast 20 Jahre überleben. Er starb 1318. Verheiratet mit der Wittelsbacher Herzogstochter Agnes von Bayern, hatte er mit Heinrich einen gleichnamigen Sohn, sowie drei Töchter, Sophia, Judith, Margarethe. Von Sohn Heinrich werden noch von berichten.
Als 1309 Markgraf Otto IV. nach einem langen Leben, das ihn bis auf Heinrich ohne Land, jeden seiner Brüder, Halbbrüder und Vettern überleben ließ, verschied, lebten von der Johanneischen Linie nur noch erwähnter Heinrich, dessen unmündiger, und gleichnamiger Sohn, sowie Waldemar, der Sohn Markgraf Konrads I. Vom ottonischen Zweig, noch Johann V., Sohn Hermanns des Langen, Enkel Ottos V. des Langen.
Noch 1290, anlässlich eines großen Familientreffens bei Rathenow im Havelland, trafen sich 19 brandenburgische Markgrafen aus beiden askanischen Zweigen der Mark. 20 Jahre später existierten davon nur noch die vier genannten Personen, davon drei aus der nächsten Generation, von denen 1308, beim Tod Ottos IV., nur Waldemar volljährig war, sowie Heinrich ohne Land als Senior.
Wir werden im nächsten Kapitel die ereignisreichen Jahre zwischen 1298 und 1309 nochmal näher beleuchten.
