Regional- und Reichspolitik
Durch die Heiratsverbindungen Johanns I. mit Dänemark (1230/35) und Ottos III. mit Böhmen (1233/43), war Brandenburg außenpolitisch in komfortabler Lage. Es versetzte beide Regenten in die Lage, sich in einem Umfang um territoriale Expansion zu bemühen, wie es Vater Albrecht II., Onkel Otto II. und Großvater Otto I., mit Rücksicht auf die jeweils politische Lage niemals vermochte. Brandenburg hatte sich in den zurückliegenden zwei bis drei Jahrzehnten sehr vorteilhaft weiterentwickelt. Das Besiedlungswerk seit Markgraf Otto I., ließ die ältesten Teile der Kolonien ostwärts der Elbe, bis hin zur Havellinie, wachsen und gedeihen. Seit dieser Zeit blieb die Mark von Kriegen weitestgehend verschont, wodurch sich, fast untypisch für das Reich, die Landschaften und seine Bewohner in Frieden entfalten konnten. Die Menschen der Mark waren allerdings noch weit davon entfernt, so etwas wie eine eigene Selbstwahrnehmung oder gar eine märkische Identität zu entwickeln. Die Bevölkerung betrachtete sich lange noch nicht als ein zusammengehöriges Kollektiv. Die Klammer über alles bildete nur das markgräfliche Herrscherhaus, und die darunterliegende Lehnspyramide aus Adel und Prälaten. Hierin war Brandenburg jedoch keine Ausnahme. Wenn es auch Regionen im Reich gab, wo so etwas wie Landsmannschaften existierten, förderte die zunehmende Zersplitterung in oftmals unzusammenhängende Einzelterritorien, nicht die Bildung eines Zusammengehörigkeitsgefühls. Auf Brandenburg bezogen, war es ungleich schwerer. Seine Einwohner waren ein Sammelsurium von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Mundarten. Vergessen wir nicht, die Mark war ein Einwanderungsland, eine deutsche Kolonie, wenn man es so formulieren möchte. Seine Bewohner kamen aus den Küstenregionen Flanderns oder Hollands, aus Westfalen, Ostsachsen oder dem Rheinland. Hinzukamen die schon ansässigen slawischen Bewohner des Landes, die, wenn sie auch in den Vergeltungsfeldzügen des letzten Jahrhunderts stark dezimiert wurden, weit davon entfernt waren, ausgerottet zu sein, was auch nie Absicht der askanischen Ostexpansion war.

Die unter den Staufern erfolgte Verlagerung des Reichszentrums in den süddeutschen Raum, ließ den Norden des Reichs fortschreitend königsfern werden. Als unter Friedrich II. zeitweise das Zentrum sogar nach Italien verlegt wurde, beschleunigte sich der Prozess.
Die Markgrafen Johann I. und Otto III., lange staufisch gesinnt, hielten sich in Bezug auf handfeste Unterstützung des Kaiser immer zurück. Die Ferne ihres Fürstentums ermöglichte es, sich ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen, den kaiserlichen Konflikten mit Papst und Lombardenbund erfolgreich zu entziehen. Der Kaiser plagte sich in dieser Zeit nicht nur mit dem renitenten Städtebund der Lombarden, auch der Konflikt mit seinem ältesten Sohn Heinrich und nicht zuletzt mit dem ausufernden Fehdewesen im Reich selbst.
Die Mainzer Landfriedensordnung von 1235 war entsprechend das Ergebnis einer geschärften Wahrnehmung, dass diesem Fehdeunwesen zum Wohle aller Regeln und so gut es eben ging, Einhalt geboten werden musste. Die Städte profitierten am meisten von Frieden und sicheren Straßen, da Handel und Handwerk hierdurch in ungestörter Weise aufblühen konnte. Noch waren Wasserstraßen für den Fernhandel die wichtigsten und gleichzeitig sichersten Versorgungsadern, doch stärkte der wachsende Binnenhandel auch weiter abseits von See-, Fluss- und Kanalwegen, die Urbanisierung auf dem platten Land. Überhaupt waren es Städte, die sich jetzt als Motor der weiteren Landesentwicklung überall hervortaten und darin die Klöster in den erschlossenen Gebieten nach und nach ablösten. In ihnen ballte sich die Wirtschaft. Da die älteren und größeren Städte oft gleichzeitig Sitz eines Bischofs waren, bildeten sie ebenso regionale, mancherorts überregionale politisch-kulturelle Zentren. Aus einem regen Handel, der einen großen Teil seiner Waren aus dem lokalen Handwerk oder der Landwirtschaft bezog, profitierte die weite Peripherie in der Umgebung einer Stadt und von alledem, wiederum die fürstlichen Landeskassen, denen es dank erhobener Abgaben, wie Zölle, Schmiede- oder Schnitterpfennigen, klingende Münzen einbrachte. Für einen Territorialfürsten war es dabei höchst weise, die Abgabenschraube, darunter den Zoll, nicht für den kurzfristigen Gewinn zu fest anzuschrauben, um dadurch nicht Gefahr zu laufen, den ganzen Warenfluss abzuwürgen oder wenigstens empfindlich zu stören.
Vom Dezember 1236 liegen uns zwei Urkunden vor, die einen diesbezüglichen Weitblick erkennen lassen. In einer undatierten Urkunde Herzogin Mechthilds von Braunschweig-Lüneburg, der älteren Schwester unserer brandenburgischen Markgrafen, teilt sie dem Hamburger Magistrat mit, dass sie von ihren Brüdern freies Geleit für die Hamburger Händler auf den Abschnitten der märkischen Elbe erwirkt habe. Dies beinhaltete neben dem Schutz wahrscheinlich auch Zollerleichterungen. Hinsichtlich einer zeitlichen Einordnung der Urkunde, vermutete der Historiker Konstantin Höhlbaum (1849-1904), der bei seinen Forschungen wiederholt die Hanse thematisierte, einen Zusammenhang mit einer auf den Dezember 1236 datierten Urkunde des Grafen Adolf IV. von Holstein. Hierin setzt der Graf den Zoll für brandenburgische Kaufleute in Hamburg herunter und ebenso für Warenausfuhr über den Hamburger Seehafen nach Flandern. Derartige Vereinbarungen waren üblicherweise bilateral, man darf also davon ausgehen, dass auch Händler Hamburgs oder Lübecks gleichartige Vergünstigungen in der Mark Brandenburg genossen. Bei den ausgeführten brandenburgischen Waren dürfte es sich hauptsächlich um Getreide, Wolle, Fleisch, Leder und Holz. Es waren die dominierenden Erzeugnisse, die auf lange Zeit in der Mark im relativen Überfluss produziert wurden und einen bescheidenen Wohlstand schufen.
Werfen wir einen Blick auf die politischen Aktivitäten der brandenburgischen Regenten. Im vorhergehenden Kapitel erläuterten wir den Vertrag von Kremmen und dass nur Markgraf Johann die Verhandlungen führte, während Otto auf dem Weg nach Augsburg, zum kaiserlichen Hoftag war. Dieser Hoftag war gleichzeitig als Heerschau gedacht. Friedrich sammelte die Streitkräfte der Reichsfürsten um nach Italien zu ziehen und die städtischen Rebellen der Lombardei mit Waffengewalt für ihre Unbotmäßigkeit zu bestrafen. Nicht nur mit dem Lombardenbund gedachte der Kaiser abzurechnen, auch der Babenberger Herzog Friedrich II. von Österreich sollte für seine erwiesenermaßen unehrerbietige und rebellische Art zur Verantwortung gezogen werden. Über ihn wurde Ende Juni 1236 die Reichsacht verhängt. Unter den Zeugen wird Markgraf Otto von Brandenburg genannt, neben König Wenzel I. von Böhmen, seinem zukünftigen Schwiegervater, dem Wittelsbacher Herzog Otto von Bayern und den Bischöfen Ekbert von Bamberg und Rüdiger von Passau. Diese vier Fürsten waren augenscheinlich autorisiert die Reichsexekution gegen den österreichischen Herzog zu vollziehen. Dass hierzu auch der brandenburgische Markgraf Otto herangezogen wurde, erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, Brandenburg lag denkbar weit von Österreich entfernt. Die Erklärung ist wahrscheinlich in dem böhmischen Heiratsprojekt zu suchen. Otto bot sich König Wenzel I., dieser dürfte neben Herzog Otto von Bayern die führende Rolle wider Friedrich von Österreich gespielt haben, entweder freiwillig an oder wurde vom Vater seiner Verlobten dazu ermuntert.
Der König von Böhmen war schon am 30. Juni zurück in Böhmen, wo er bei Kladrau (tschechisch Kladruby) urkundet. Er erschien am 26. Juni letztmalig unter den Zeugen auf in Augsburg ausgestellten kaiserlichen Urkunden, ebenso Markgraf Otto. Ganz offensichtlich brach er noch an diesem Tag oder kurz danach auf nach Böhmen, wie anders hätte er sonst die 250 Kilometer von Augsburg bis Kladrau zurücklegen können. Eine tägliche Marschleistung von kontinuierlich 50 Kilometern und mehr, erscheint auch so schon höchst erstaunlich, weswegen er nur in kleinem Reitergefolge unterwegs gewesen sein konnte. Ob Markgraf Otto III. von Brandenburg zeitgleich die Heimreise angetreten hat oder zu einem späteren Zeitpunkt, ist ungeklärt. Er urkundet allerdings am 22. Juli neben seinem Bruder Johann zu Tangermünde an der Elbe. Das kaiserliche Heer begann seinen Marsch nach Italien zwei Tage später, am 24. Juli und nahm den üblichen Weg über Innsbruck und den Brennerpass.
Im August hatte sich das Reichsheer den Weg durch die Alpen erkämpft und war auf oberitalienischen Boden angelangt. Auf viele Hindernisse stießen die Kaiserlichen wegen der Größe der eigenen Kräfte bislang nicht. Eine offene Schlacht vermieden die lombardischen Rebellen und suchten vorläufig nur den weiteren Vormarsch an Engstellen zu stören und dem Heerzug Nadelstiche zu versetzen, vorläufig mit geringem Erfolg. Bei Isorella, nordöstlich von Cremona lagerten die kaisertreuen lombardischen Truppen aus Cremona, Parma, Reggio, Modena und anderen und zogen jetzt dem von Norden anrückenden Reichsheer zur Vereinigung entgegen, was am 14. September erfolgte. Der Kaiser meinte es dieses Mal ernst, ein reines Muskelspiel war es nicht mehr, er war gewillt die rebellischen Kommunen wenn es sein muss eine nach der anderen zu erobern und zu unterwerfen. Das erste Ziel war Mantua, gefolgt von Bergamo im Oktober. In einem mörderischen Eilmarsch ging es nach Osten wo Vicenza Anfang November fiel, Ferrara und Padua im weiteren Verlauf des November.
Am 30. November brach der Kaiser den bisher erfolgreichen Feldzug in der Lombardei überraschend ab und zog mit den deutschen Reichstruppen zurück in den deutschen Reichsteil, gegen Österreich. Es bleibt gewissermaßen ein Rätsel was die Motivation hierzu war. Statt die lombardische Revolte mit einem konzentrierten Schlag gegen Mailand und die übrigen Rebellen zu einem für das Reich anzustrebenden Abschluss zu bringen, überließ er den kaisertreuen Lombarden die weiteren Angelegenheiten und schien sich, so gewinnt man den Eindruck, hauspolitischen Erwägungen zuzuwenden. Möchte man der Äußerung des Historikers Eduard Winkelmann, ein ausgesprochener Kenner der jüngeren Staufer mit Schwerpunkt Friedrich II., wären dem Kaiser selbst bei längerem Verweilen in Oberitalien im Winter und Frühjahr keine weiteren Erfolge mehr beschieden gewesen. Für den Weg nach Österreich wählte Friedrich den gleichen Weg, den er schon 1235 nahm. Über Krain marschierte er ins Herzogtum Steiermark, dass er unterwarf und aus dem Machtblock Herzog Friedrichs von Österreich herausriss. Über Graz ging es weiter nach Wien, dem er im April weitestgehende Autonomie zugestand, ohne es jedoch aus dem Herzogtum auszuklammern und damit zur Reichsstadt zu erheben. Herzog Friedrich von Österreich stellte sich in der Zeit keinem offenen Kampf, es wäre auch ohne die geringste Chance auf Erfolg gewesen und verharrte zeitgleich in der Wiener Neustadt. Im Februar 1237 ließ der Kaiser in Wien seinen nicht demnächst neunjährigen Sohn Konrad zum römisch-deutschen König wählen. Wir erinnern uns, noch 1235 lehnten die seinerzeit in Mainz versammelten Fürsten die Wahl ab, diesmal glückte die Kür. Die Gruppe der anwesenden Fürsten war verhältnismäßig klein und durchweg staufergesinnt, was die erfolgreiche Wahl Konrads gewährleistete. Die brandenburgischen Markgrafen waren nicht anwesend, dementsprechend auch nicht am Wahlakt beteiligt, überhaupt war nicht ein einziger Fürst aus Norddeutschland zugegen. Das partikulare Vorgehen des Kaisers blieb nicht ohne Kritik und wenn sie auch still blieb, schritt die Entfremdung der norddeutschen Territorien vom Königtum in kleinen Schritten voran.
In der ersten Aprilhälfte zog der Kaiser mit seinem Heer, das er nach dem halbfertigen lombardischen Feldzug nicht aufgelöst hatte und dass ihm nun als Zwingmittel zur Durchsetzung seiner politischen Interessen im nordalpinen Reichsteil diente, weiter nach Westen. Ostern verbrachte er in Regensburg, Anfang Mai befand er sich in Ulm und zu Pfingsten weilte er in Speyer, wo er auf dem abgehaltenen Hoftag die Wahl Konrads zum römisch-deutschen König bestätigen ließ, den der Kaiser übrigens nicht zum Mitregenten machte, wie zuvor seinen erstgeborenen Sohn Heinrich. Das Treffen in Speyer ist insofern interessant, als Markgraf Johann von Brandenburg zugegen war. Er gehörte nach den Erzbischöfen von Mainz und Trier, zu den wenigen prominenten Reichsfürsten die erschienen waren und schien auch der einzige anwesende Fürst aus dem norddeutschen, sächsischen Regionen des Reichs gewesen zu sein.
Der Kaiser sammelte im August das Heer, verstärkte es mit Zuzug frischer Truppen, um erneut in die Lombardei einzurücken, wo er hoffte durch Verhandlung eine Unterwerfung zu erreichen. Hermann von Salza, der Hochmeister des Deutschen Ordens, reiste hierzu nach Italien voraus. Er leistet als wichtiger Verhandlungsführer dem Kaiser wertvolle Dienste, die dieser ihm, vielmehr dem Deutschen Orden, durch reiche Schenkungen überall im Reich kaiserlich entlohnte. Die am Heerzug beteiligten Fürsten wünschten keine Einigung auf Verhandlungsweg sondern die gewaltsame Niederwerfung. Im September vereint sich das deutsche Heer mit einem aus Tuszien und Apulien heranrückenden Heer, darunter 10.000 sizilianische Sarazenen. Am 1. Oktober erfolgt die endgültige Unterwerfung Mantuas. Nach förmlicher Unterwerfung der Bürger nahm er die Stadt wieder in seine Huld, restituierte ihre Rechte und setzte einen kaiserlichen Podesta, einen Administrator ein. Am 7. Oktober 1237 beginnt die Belagerung der starken Festung Montechiaro, nach einem Ausfall der belagerten am 11. Oktober, folgte die vollständige Einschließung am 12. Oktober und bald darauf begann die Beschießung. Am 22. übergaben die Eingeschlossenen, jeder Hoffnung beraubt, die Festung. 1.500 überlebende Kämpfer, darunter 20 Ritter wurden nach Cremona abgeführt. Es kam Anfang November zu Verhandlungen mit Mailand, dem Kopf der Rebellion. In einigen Punkten konnte man sich zunächst einigen, so die Zinsnachzahlung Mailands seit der Kaiserkrönung Friedrichs. Allerdings bestand der Kaiser zur Restaurierung des Honor Imperii auf symbolische Unterwerfung, woran die Verhandlungen letztendlich scheiterten. Friedrich bot die offene Feldschlacht an, was vom Lombardenbund abgelehnt wurde, die sich in ihre Feldverschanzungen zurückzogen. In den folgenden Tagen entließ der Kaiser die städtischen Hilfstruppen, was das gegnerische Bundesheer fehlinterpretierte und daraus den unzutreffenden Schluss zog, er würde sich in die Winterquartiere zurückziehen, worauf sie ihrerseits ihre starken Feldstellungen aufgaben. Tatsächlich überschritt das kaiserliche Heer am 23. November den Oglio. Eine vorausgeschickte Truppe ausgewählter Ritter verlegte bei Soncino dem Bundesheer den Rückmarsch nach Mailand, fesselte sie äußerst erfolgreich in schwere Kämpfe, bis das kaiserliche Hauptheer herangekommen war.
Am 27. November kam es bei Cortenuova zur entscheidenden Schlacht. Das lombardische Bundesheer wurde geschlagen und zog sich, angeschlagen aber immer noch kampfstark, in die Stadt zurück. Friedrich ließ die eigenen Truppen, nachdem sie stundenlang die Stadt vergebens berannten, auf offenem Feld in ihren Rüstungen übernachten, um am nächsten Morgen die Entscheidung zu erzwingen. Verzweifelt und mutlos setzte sich der Großteil der Belagerten in den frühen Morgenstunden panikartig ab. Viele fanden noch auf der Flucht den Tod. Die Stadt fiel praktisch kampflos in die Hände des Kaisers. Hier fanden sie den Mailänder Podesta (Administrator) Petrus Tiepolo, Sohn des Dogen von Venedig, ebenso den symbolträchtigen „Carroccio“, den mailändischen Fahnenwagen, der vom flüchtigen Bundesheer auf ihrer überstürzten Flucht zurückgelassen wurde.

Zum Zeichen des Sieges wurde der erbeutete Fahnenwagen in triumphaler Prozession durch Cremona geführt, dem Zentrum der Ghibellinen, der kaisertreuen Lombarden. Den Überlieferungen nach, soll ein Elefant den Wagen gezogen haben, was die Begeisterung der kaiserlichen Bürger Cremonas noch mehr befeuerte.
Der Wagen reiste im Anschluss vermutlich noch durch weitere reichstreue Städte Oberitaliens, bevor Friedrich ihn, dem Beispiel der antiken Cäsaren folgend, als Siegessymbol nach Rom sandte, wo er von den römischen Bürgern, die im Gegensatz zu Papst und Kirchenstaat standen, auf dem Kapitol ausgestellt wurde. Papst Gregor IX., der Hoheitsansprüche auf Rom stellte, nahm die Geste übel, sie drückte Ignoranz hinsichtlich seiner Ansprüche einerseits aus und brachte andererseits kaiserliche Ansprüche zum Ausdruck. Das erst seit wenigen Jahren gekittete Verhältnis zwischen Kaiser und Papst begann sich erneut zu trüben, doch auch zuvor gab es Anlässe zur gegenseitigen Klage. In verschiedentlich ausgetauschten Briefen bezichtigten sich Papst und Kaiser jeweils über wahrgenommene Rechts-, oder Ehrverletzungen, entweder ausgeübt von kaiserlichen Vasallen bzw. Ministerialen oder umgekehrt von päpstlichen Vertretern.
Mailand ersuchte nach der schweren Niederlage um Frieden und machte weiterreichende Angebote, die sie aber weiterhin an Bedingungen knüpften. Der Kaiser lehnte ab, er verlangte die bedingungslose Unterwerfung Mailands, wie es andere, zwischenzeitlich unterworfene Städte getan hatten, die draufhin wieder in die Gunst und Huld des Kaisers aufgenommen wurden. Das wiederum lehnte die stolze lombardische Metropole ab, worauf der Unterwerfungskrieg weiterging. Friedrich, jetzt seiner Sache sicher, erweiterte die Ziele seines Feldzug sogar und begann ebenfalls gegen Genua vorzugehen, das zwar kein offizielles Glied des Lombardenbunds war, seinerseits aber in ähnlicher Weise gegen Kaiser und Reich opponierte. Ein Feldzug in Piemont verlief im Frühjahr überaus erfolgreich, Mailand wurde zunehmend seiner Hilfsquellen und Basis beraubt und auch Genua verlor einzelne Gebiete an seiner Peripherie. Für den Sommer war der abschließende Schlag geplant, hierzu führte sein Sohn Konrad, vergessen wir nicht, weiterhin ein Knabe, im Juni ein weiteres deutsches Heer als Verstärkung heran. Es folgt eine wackelige Aussöhnung mit Genua. Am 11. Juli begann mit dem Zug gegen Breccia der Sommerfeldzug. In dieser Zeit versuchte der Kaiser den Papst dazu zu gewinnen, ihn im Kampf des Reichs gegen die lombardischen Rebellen behilflich zu sein. Im Umkehrschluss bot er ihm 1.000 Ritter auf eigene Kosten an, von ihm selbst oder seinem Sohn befehligt, die ins Heilige Land geführt werden sollen. Der Papst hatte in Wirklichkeit kein Interesse die staufische Hegemonie auf der italienischen Halbinsel auch noch zu unterstützen, erweckte jedoch pro forma den Eindruck, den Kaiser bei der Durchsetzung seiner Rechte in Oberitalien mehr als bisher beizustehen und die bisher in den Weg gelegten Behinderungen zu unterlassen. Anfang August begann die Belagerung von Breccia. Im September schien der Verteidigungswille der ausharrenden Bürger zu ermüden. Ein Teil der Verteidigungsanlagen war so schwer beschädigt, dass ein kaiserlicher Generalangriff gestartet wurde, den die Verteidiger jedoch abwehren konnten. Anfang Oktober wurde ein weiterer Angriff abgeschlagen. Im Rahmen eines mehrstündigen Ausfall bis in die Nacht hinein, richteten die Belagerten schwere Schäden im Lager und unter den Belagerungsmaschinen an, bevor sie sich wieder zurückzogen. Nach mehr als zwei Monaten wurde die Belagerung ergebnislos abgebrochen und der Kaiser entließ die nichtdeutschen Heeresteile. Auf dem Zenit begann der helle Stern Friedrichs II. zu flackern. Hinter den Kulissen arbeitete Papst Gregor IX. gegen ihn und vermittelte ein Bündnis wider den Kaiser zwischen Venedig und Genua, das am 30. November 1238 geschlossen wurde. Das Jahr ging zu Ende, ohne dass das kaiserliche Heer seine militärischen Ziele hat durchsetzen können. Das neue Jahr verhieß wenig Gutes. In Rom regte sich die Kurie und der Papst ging immer mehr auf Distanz zum Kaiser. Ende Februar machten Gerüchte um eine erneute Exkommunikation Friedrichs die Runde, der seinerseits in Briefen an die hohe Geistlichkeit auf seine Rechtgläubigkeit hinwies. Die Bemühungen blieben ohne Erfolg. Während er sich am Palmsonntag in Padua, es war der 20. März, den dort ausgetragenen Lustbarkeiten hingab, hatte der Papst ihn Rom den Kirchenbann über ihn verhängt, der vier Tage später, am Gründonnerstag wiederholt wurde. Friedrich war davon tief getroffen. In Briefen an die Fürsten, die Geistlichkeit, den Senat und die Bürger von Rom, beklagte er sich über die Willkür und den Hochmut des Papstes. Eine wahre Schlammschlacht gegenseitiger Beschuldigungen und Verleumdungen wurde losgetreten, der Kaiser als wahrer Dämon und der Antichrist stilisiert. Militärisch hatte der Bann vorläufig keine Auswirkung, noch einmal beherrschten die Kaisertreuen, die Ghibellinen, den größten Teil des oberitalienischen Raums. Den ganzen Juli schon verwüsteten die kaiserlichen Truppen, deutsche wie apulische, die Gegenden nördlich von Bologna. Um dem wankenden Lombardenbund eine Entlastung zu verschaffen, wurde am 26. Juli ein Offensivbündnis zwischen dem Kirchenstaat, Venedig, Mailand, Genua und Piacenza gegen den Kaiser geschlossen, worauf der Kaiser als Gegenreaktion das Herzogtum Spoleto und die Mark Ancona dem Kirchenstaat entzog und wieder formell dem Reich eingliederte. Den Zerstörungen der bolognesischen Gebiete folgte in gleicher Weise das der Mailänder bis dicht an die Stadt heran. Der Kaiser hoffte auf weiterhin auf eine entscheidende Feldschlacht, schätzte die diesbezügliche Bereitschaft bei den Guelfen, der antikaiserlichen Koalition aber richtigerweise gering ein, weswegen den Rebellen durch Verheerungen soviel Schaden wie möglich zugefügt werden sollte. Das Jahr 1239 verging mit weiteren Verheerungen und den erfolglosen Versuchen der kaiserlichen Truppen eine Feldschlacht zu provozieren.
Um nicht bei der Beobachtung der kaiserlichen Italienpolitik zu weit in die Zukunft voranzuschreiten, kehren wir wieder in die Mark Brandenburg zurück, wo sich in der gleichen Zeit, in den Jahren 1237 und 1238, Erwähnenswertes ereignete.
Einigung im Brandenburger Zehntstreit
Seit Jahrzehnten stritten die brandenburgischen Markgrafen mit dem Bistum Brandenburg um die Erhebung des Kirchenzehnten in jenen Gebieten, die Albrecht der Bär und seine Nachfolger aus eigener Kraft den Wenden seit 1157 entrissen, darunter auch ursprünglich sogar die spätere Dominsel selbst. Das zur damaligen Zeit praktisch nur noch dem Namen nach existierende Bistum hatte daran keinerlei Anteil gehabt, weswegen schon Markgraf Otto I., spätestens aber seine Söhne, ganz besonders Albrecht II., der Vater unserer beiden Protagonisten, die mit fortschreitendem Ausbau der Mark immer lukrativeren Einnahmen aus dem Zehnten statt der Kirche von Brandenburg, lieber den eigenen Kassen zuführte. Hierin kollidierten die markgräflichen Finanzinteressen auf Dauer mit den kirchlichen Ansprüchen. Mittels eines für den Papst vorteilhaften Angebots, versuchte Albrecht II. das ganze Gebiet östlich der Elbe, genauer gesagt alles was nicht direkt zum Bistum selbst gehörte, kirchenverwaltungsrechtlich dem Papst zu unterstellen. Und wenn auch die Pläne schlussendlich nicht weiterverfolgt wurden, die Konflikte mit Dänemark nahmen ihn zu sehr in Anspruch, behielt er trotzdem die Einnahmen aus diesen Gebieten.
Markgraf Johann I. und Markgraf Otto III. erbten den ungelösten Konflikt. In welcher Weise dieser während ihrer ersten Regentschaftsjahre wieder Aktualität bekam, lässt sich aus der geringen Ausbeute an Schriftstücken nicht ermitteln, wir wissen nur, dass es am 28. Oktober 1237 im Domspital zu Brandenburg zu einem fürstlichen Vergleich kam. Die Markgrafen erkannten mündlich und schriftlich an, dass der Kirchenzehnt in ihren Gütern dem Bistum Brandenburg gehörte. Alle ihre Nachkommen sollten dies nach Regierungsantritt binnen Jahresfrist ebenso bekunden. Im groben Überblick sah der Vergleich dergestalt aus, dass die Markgrafen den Nießbrauch des Kirchenzehnten hatten, das heißt im Klartext, sie konnten weiterhin die Einnahmen für sich verwenden, wenn sie auch kein Besitzrecht daran hatten.

Am 18. November eines jeden Jahres entrichteten sie drei Silberpfennige pro Hufe Land (17 Hektar) an den Bischof. Die Bemessungsgrundlage waren rund 25.000 Hufe erschlossenes Land in den neuen Siedlungsgebieten, womit immer noch eine stolze Summe an die Kirche abgeführt wurde. Weiter erhielt er 100 Hufe unbebautes Land. Für die beiden regierenden Brüder erwies sich der Vergleich, der abzüglich der erwähnten Abgabe das bisherige Verfahren nachträglich legalisierte, als ein hervorragender Kompromiss. Die Vereinbarung von 1237 kam nah an das damalige Angebot des Vaters heran, das dieser seinerzeit dem Papst unterbreitete. Und auch das Bistum Brandenburg stand nach dieser Vereinbarung allemal finanziell besser da. Die Einnahmen, die jetzt mit kirchlichem Segen in die markgräflichen Kassen flossen, waren wichtiger Motor einer selbstbewussten und unabhängigen Landespolitik, die gemessen am Entwicklungsgrad der Mark sehr beachtenswert war.
Am 28. Februar 1238 wurde der Vertrag zu Merseburg nochmals bestätigt, nachdem er von allen Seiten Zustimmung fand.
Krieg gegen Halberstadt & Magdeburg
Im Jahr 1238 entzündete sich im altmärkischen Grenzgebiet von Brandenburg, Halberstadt und Magdeburg ein Streit um die sogenannte Markgrafenburg in Alvensleben, heute in der Gemeinde Hohe Börde. Seit etwa 1180 besaß der Bischof von Halberstadt dort eine eigene Burganlage, die höchstwahrscheinlich deutlich älter war. Wegen der unmittelbaren Nachbarschaft beider Burgen, kam es zu wiederholten Auseinandersetzungen unter den jeweiligen Dienstmannen des Bischofs und der brandenburgischen Markgrafen. Der ausgebrochene Konflikt war Auftakt einer Serie von Kriegen die zur Bewährungsprobe für die Mark und ihre beiden Regenten wurde. Eigentlicher Auslöser war die Forderung des Halberstädter Bischofs Ludolf (†1241) an die Markgrafen, ihre Burg als bischöfliches Lehen zu nehmen, was brandenburgischerseits zurückgewiesen wurde. Es kam zur Belagerung der Markgrafenburg, wobei der Magdeburger Erzbischof Wilbrand (1180-1253) an der Seite Halberstadts mitwirkte. Die reiche linkselbische Altmark war von vielen Anrainern im Fokus. An kleinsten Landfetzen konnte sich eine Fehde entzünden. Die Markgrafen holten zum Gegenschlag aus und kamen der belagerten Burg zu Hilfe. Es ist hierbei unklar ob beide Brüder das Entsatzheer führten oder nur Otto III., welcher bei der für Brandenburg unglücklich verlaufenden Schlacht in Gefangenschaft geriet. Nach der Niederlage von 1229 an der Plane, erlebte Brandenburg neun Jahre später eine neuerliche militärische Schlappe und dieses Mal geriet sogar einer der Regenten in Gefangenschaft.
Man brachte die wertvolle Geisel nach Langenstein auf die sogenannte Altenburg südwestlich von Halberstadt, bis es zum Vergleich kam. Für die Freilassung Ottos mussten 1.600 Mark in Silber und die Abtretung der Markgrafenburg samt Land geleistet werden, das sie im Anschluss als Lehen vom Bischof nahmen. Ein herber finanzieller Schlag und schlimmer, ein schmerzlicher Prestigeverlust mit Signalwirkung gerade in Bezug auf den Wettstreit um die letzten unerschlossenen Gebiete links der Oder. Es wurde nicht bezweifelt dass Brandenburgs Markgrafen notwendigenfalls zum Schwert greifen würden, dass sie aber auch siegreich blieben, wurde mancherorts doch angezweifelt. Ernstzunehmender Gegner war Markgraf Heinrich III. von Meißen (um 1215 – 1288) aus dem Hause Wettin. Seit 1221 Markgraf von Meißen und der Niederlausitz. 1247 fielen ihm die reichen Güter in Thüringen, wie auch die Pfalzgrafschaft in Sachsen zu, was ihn aus dem Stand zum mächtigsten Fürsten im mittelostdeutschen Raum nach dem Königreich Böhmen machte. Wir kommen in Kürze auf ihn zurück.
Die Stellung Brandenburgs zum Kaiser
Wie der Schlussteil des Eingangsabschnitts erwähnte, exkommunizierte der Papst den Kaiser ein weiteres Mal im März 1238. Friedrich II. war davon tief erschüttert und beauftragte seinen minderjährigen Sohn Konrad die Haltung der deutschen Fürsten, jene die nicht mit ihm in Italien standen, zu ermitteln. Er rief zum Neujahrstag 1239 nach Eger einen Hoftag aus. Man fasste den Beschluss eine Vermittlung zwischen Papst und Kaiser zu versuchen. Zu den Anwesenden gehörten laut dem Bericht Erzdiakons Albert von Passau auch die beiden brandenburgischen Markgrafen. Auf dem Hoftag zeigte sich unter den Fürsten Entzweiungen, die kaiserliche Partei wurde angeführt von Erzbischof Siegfried III. von Mainz, Markgraf Heinrich III. von Meißen und dem Landgrafen Heinrich Raspe von Thüringen. Auf der päpstlichen Seite standen der König von Böhmen und der Herzog von Bayern. Die Haltung Brandenburgs ist unklar, die politische Bedeutung der Markgrafschaft war in der Wahrnehmung der zeitgenössischen Chronisten und Kanzleien weiterhin gering, so dass selten über eine einfache Erwähnung unter Zeugen oder Anwesenden hinaus ging, dementsprechend wurde über Johanns und Ottos Position auch kein Wort verloren. Antistaufisch waren sie grundsätzlich nicht, hierzu bestand keinerlei Anlass. Wenn sie zu dieser Zeit vielleicht dennoch zum oppositionellen Lager tendierten, lag das mehr an einer gegnerischen Haltung gegenüber dem Markgrafen Heinrich von Meißen, dessen Stellung klar staufisch war. Auch spielte das böhmische Heiratsprojekt Markgraf Ottos III. von Brandenburg eine mitentscheidende Rolle. König Wenzel I. und wie erwähnt der Wittelsbacher Herzog Otto von Bayern waren im päpstlichen Lager zu finden, was nicht an einer papstnahen Frömmigkeit lag, sondern rein partikulare, regionalpolitische Gründe hatte. Obwohl die markgräflichen Brüder nicht zu den eindeutigen Stauferanhängern zu zählen waren, aus den genannten Gründen eher im gegnerischen Lager zu finden waren, im Übrigen eine ähnliche Situation wie anlässlich des Kriegs gegen Dänemark, vor mehr als zehn Jahren, gehörten sie dennoch zu den Unterzeichnern der schriftlichen Stellungnahme an den Papst. Man könnte sie vor diesem Hintergrund als reichsgesinnt bezeichnen. Die bald ausbrechenden Kämpfe gegen eine sächsische Fürstenkoalition machte die Frage nach ihrer kaiserlichen Gesinnung ohnehin rein akademisch, sie waren vollauf damit beschäftigt die Interessen ihres eigenen Fürstentums zu verteidigen und hatten keine Möglichkeiten und Mittel in den Kampf zwischen Kaiser und Papst aktiv einzugreifen, selbst wenn sie es gewollt hätten.
Das Lebuser Land
Die Halberstädter Fehde war für Brandenburg mit einer Niederlage ausgegangen. Die Auswirkungen und Folgen blieben wegen moderater Friedensbedingungen überschaubar. Das geforderte Lösegeld für den gefangen Markgrafen Otto war schmerzlich aber ebenfalls erträglich und die verlorene Burg sowie das angrenzende Gebiet konnte als Lehen von Bischof Ludolf von Halberstadt genommen werden, womit der materielle Nutzen für Brandenburg gewahrt blieb. Auch das Verhältnis zum Magdeburger Erzstift, das an der Seite Halberstadts kämpfte, wurde nach Friedensschluss wieder auf den Stand vor der Fehde gebracht. Nach außen hatte alles den Eindruck einer einvernehmlichen Einigung, doch durfte man sich davon nicht täuschen lassen. Im gesamten ostsächsischen Raum war wie seit dem Ende der Ottonenzeit die Stimmung gespannt. Es fehlte eine dominierende Mittelmacht, die als regionaler Machtfaktor regulierend eingriff. Jeder Kleinfürst suchte seine territoriale Basis auf Kosten seiner Nachbarn zu verbessern. Ständig wechselnde Bündnisse schufen immer neue Konstellationen. Freund und Feind wurden mitunter im gleichen Jahr ausgetauscht, so wundert es nicht das Brandenburg und Magdeburg, gerade eben noch Gegner, kaum dass der Friede hergestellt war, als Verbündete gemeinsame Sache machten.
Die Havel trennte große Teile Brandenburgs, bevor die Expansion über die Oder einsetzte, längere Zeit in zwei Hälften. Sie entspringt im Gebiet der großen mecklenburgischen Seenplatte, fließt dann in allgemein südlicher Richtung. Bei Spandau mündet ihr größter Nebenfluss, die Spree ein. Hart südlich des alten Potsdam biegt sie dann erst scharf nach Westen, um bei Havelberg in die Elbe zu münden. Östlich dieser Havellinie konnten sich die Slawen noch am längsten ihre Unabhängigkeit bewahren. Ihr Gebiet war zwar längst von Polen und Deutschen aufgeteilt aber in der Realität nicht tatsächlich in Besitz genommen. Ein Teil der Landschaften war das Lebuser Land. Es erstreckte sich historisch und auch heute noch östlich und westlich der Oder. Früh meldeten die polnischen, nach Erbteilungen, dann die schlesischen Piasten Ansprüche an und auch das Reich machte auf Basis der alten Marken aus der Zeit der Ottonen Besitz auf das Land westlich der Oder geltend. West im dreizehnten Jahrhundert konnte aber an eine tatsächliche Besitzergreifung gedacht werden. Im Osten hatten sich die Polen langsam an die Oder herangearbeitet, hierzu riefen sie Siedler aus dem Reich ins Land, die ostwärts der Oder, in der späteren Neumark, erfolgreich erste Siedlerkolonien neben den slawischen Bewohnern gründeten. Die Streitigkeiten unter den piastischen Linien verhinderte eine stringentere Erschließung. Wie schon erwähnt, erhob das Reich für das Land in östlicher Richtung bis zur Oder hin, seinerseits Ansprüche. Nördlich des Lebuser Lands hatten sich schon die Brandenburger wichtige Stützpunkte an der Oder erschlossen, über die Festung bei Oderberg haben wir ja bereits gesprochen. Jetzt ging es darum auch südlich davon die letzten weißen Flecken zu schließen. Natürlich hatten die brandenburgischen Markgrafen Brüder Johann und Otto hieran das größte Interesse, doch konnte sie aufgrund eines kaiserlichen Dekrets nicht alleine vorgehen, zumal die piastischen Ansprüche zu Verwicklungen mit Schlesien führen mussten. Der Kaiser hatte Magdeburg mit dem Lebuser Bistum belehnt, und es zu dessen Kirchenprovinz zugehörig erklärt. In gleicher Weise beanspruchte auch der Metropolit des polnischen Erzbistums Gnesen jenes Bistum. Neben dem Anspruchskonflikt kirchlicherseits, kollidierten jedwede weltlich-territorialen Interessen auf die Herzog Heinrichs von Niederschlesien, einem Vertreter des weitläufigen polnischen Herrschaftsgeschlechts der Piasten. Auch der aufstrebende Wettiner Markgraf Heinrich III. von Meißen erhob Ansprüche und betrachtete das Gebiet als Teil der Niederlausitz. Überhaupt stand Brandenburg mit Meißen 1239 kurz vor einer militärischen Auseinandersetzung. Nicht wegen des Lebuser Landes sondern wegen zwei strategisch wichtig gelegenen Burgen bei Köpenick und Mittenwalde. Die näheren Umstände sind nicht bekannt aber es scheint, dass beide Burgen in der zweiten Hälfte der 1230‘er Jahre brandenburgisch waren, obwohl sie zuvor nachweislich im Besitz der wettinischen Markgrafen der Niederlausitz waren. Ein Kriegsausbruch konnte verhindert werden indem die Markgrafenbrüder Johann und Otto die Entscheidung einem Schiedsgericht überlassen wollten und beide Burgen bis dahin treuhänderisch an den Erzbischof von Magdeburg übergaben.
Zu Magdeburg hatte sich nach der Halberstädter Fehde das Verhältnis auffallend schnell gehoben, Motor waren die gemeinsamen Interessen am Lebuser Land. Im Spätsommer 1239 ziehen sie gemeinsam mit ihren Heeren gegen Lebus und belagern es. Herzog Heinrich von Niederschlesien leistet erbitterten Widerstand. Details über den Hergang der Belagerung und ob es daneben zu einer Schlacht mit dem Herzog kam, ist nicht überliefert. Wir wissen nur, dass trotz aller Anstrengungen Lebus nicht genommen werden konnte und sich beide Heere zurückzogen und der Erzbischof und die Markgrafen im Streit trennten. Was zum Streit führte ist aus den spärlichen Berichten der Zeit nicht zu entnehmen. Es ist nicht auszuschließen, dass es die brandenburgischen Truppen unter der Leitung der Markgrafen absichtlich am notwenigen Einsatz haben mangeln lassen, weswegen der Feldzug im Lebuser Land am Ende scheiterte. Denkbar wäre das sehr wohl, konnte es doch kaum im Interesse Johanns und Ottos sein, im Osten ihrer Ländereien dem einflussreichen Magdeburger Erzstift zu weiteren Ländereien zu verhelfen, die sie als Urenkel Albrechts des Bären, dem Markgrafen der Nordmark, als ihr alleiniges Einflussgebiet und Erbe betrachteten. Mag der Erzbischof als Metropolit kirchenrechtlich darüber verfügen, aber nicht auch territorial.
Der Teltow-Krieg und die Magdeburger Fehde
Das Jahr 1240 brachte Krieg für Brandenburg. Es wird der schwerste bisherige Militärkonflikt sein, worunter die Altmark über Jahre am schwersten litt. Als Teltow-Krieg fand er Einzug in die Geschichtsbücher. Tatsächlich werden es unterschiedliche Konflikte sein, die durch das teilweise gemeinschaftliche Vorgehen der brandenburgischen Gegner, unzutreffenderweise oft als eine kriegerische Auseinandersetzung behandelt werden. Wir erinnern uns an die erwähnten beiden Burgbezirke Köpenick und Mittenwalde, der Magdeburger Erzbischof Wilbrand von Käfernburg war von den Brandenburger Markgrafen als Treuhänder eingesetzt worden. Durch die missglückte Einnahme von Stadt und Bischofssitz Lebus, war der hohe Kirchenfürst weiterhin im höchsten Maße verstimmt, geradezu verbittert. Er übergab er beide Burgen in treuloser Weise, vermutlich Anfang Mai 1240 an Markgraf Heinrich III. von Meißen, der unmittelbar Garnisonen einquartierte.

Nachdem Heinrich einem am 22. Mai ausgestellten Schreiben des päpstlichen Legaten in Deutschland, Albert Beheim (1190-1260), einem fanatischen Gegner des Kaisers, erwartungsgemäß nicht Folge leistete, wonach er die Burgen an die Mark ausliefern sollte, begannen die Brandenburger eilig mit Zurüstungen. Die unerwartete Parteinahme des Papstes verdient eine Erklärung. Noch wenige Wochen zuvor verfassten Johann und Otto einen Brief an Papst Gregor IX., worin sie im Streit zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Heiligen Stuhl, den Hochmeister des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, als Vermittler empfahlen. Der Papst mag in einer Intervention zum Vorteile Brandenburgs und wider Markgraf Heinrich, ein wichtiger Parteigänger des Kaisers, einen geeigneten Hebel gesehen haben, im Reich die antistaufische Partei zu verstärken. Er erhoffte sich die brandenburgischen Regenten für die päpstliche Seite zu gewinnen.
Wie so häufig bei vergleichbaren Fehden, begann der Konflikt zunächst mit verheerenden Verwüstungen, die Markgraf Heinrich starte, indem er den Barnim bis zur Höhe Strausberg verwüstete. Beide Markgrafen traten ihm im Juni 1240 in der Gegend der Burgbezirke von Köpenick und Mittenwalde entgegen, wo es jedoch zu keiner entscheidenden Schlacht kam. Das Ziel der Brandenburger war die schnelle Rückgewinnung der Burgen. Heinrich von Meißen begegnete den Belagerungen mit Plünderungszügen auf dem Barnim, bis zur Höhe Strausberg. Es sollte aber viel schlimmer kommen, Mitte Juni ereignete sich links der Elbe eine kritische Intervention zweier alter Bekannter. Sowohl der Erzbischof von Magdeburg wie auch der Halberstädter Bischof marschierten in die Altmark ein und verheerten bis hinauf in die Gegend der Wische, der fruchtbarsten Gegend der alten Mark. Als Boten Nachrichten von den schrecklichen Verheerungen überbrachten, war den Brüdern klar, die Lage war jetzt unvermittelt höchst ernst für Brandenburg geworden, die Fehde wuchs sich zu einem handfesten Krieg an mehreren Fronten aus. Markgraf Otto III. blieb mit dem Heer auf dem Teltow stehen. Zunächst gelang es ihm Köpenick einnehmen, verlor es allerdings wieder, als er gegen die plündernden Scharen im Barnim vorging. Markgraf Johann I. eilte in der Zwischenzeit nur in kleinem Reitergefolge Tag und Nach reitend in die Altmark, wo er das Aufgebot der Landstände zusammenraffte. Am des dritten Tages, es war der 24. Juni, gelang ihm ein überraschender Angriff auf die unvorbereitet lagernden Truppen der beiden Bischöfe bei Flüsschen Biese. Die Niederlage war völlig. Bischof Ludolf von Halberstadt gerät zusammen mit mehr als 60 Rittern verwundet in Gefangenschaft. Auch der Magdeburger Erzbischof Wilbrand wird verwundet, konnte aber fliehen und setzte sich mit den Überresten seines Heeres auf in die Burg Kalbe an der Milde, im heutigen Landkreis Salzwedel, ab. Johann beginnt sofort mit der Belagerung und nimmt die Burg nach kurzer Zeit ein, die dabei völlig zerstört wurde. Dem Erzbischof schien abermals die Flucht gelungen zu sein. Das weitere Jahr sah keine größeren Kampfhandlungen mehr. Auf dem Teltow konnten sich die Brüder gegen Meißen behaupten und in der Altmark den Bischöfen im Frühsommer eine verheerenden Niederlage beibringen. Dennoch gab es wenig Anlass zur Erleichterung. Die Feindseligkeiten waren durch die großen Erfolge der Sommermonate bisher zwar erfolgreich für Brandenburg verlaufen, die schweren in der Altmark angerichteten Schäden lasteten dennoch schwer. Während der Magdeburger Erzbischof zweimal flüchten und am Ende glücklich in sein Erzstift retten konnte, geriet Bischof Rudolf wie erwähnt in Gefangenschaft. Ende des Jahres 1240 wurde er gemeinsam mit den sonstigen inhaftierten Rittern gegen die Zahlung eines Lösegelds auf freien Fuß gesetzt. Bei der Summe einigten sich beide Seite auf den gleichen Betrag den Markgraf Otto vor nicht ganz zwei Jahren an den Halberstädter Bischof zu seiner eigenen Freilassung leisten musste, 1.600 Mark Silber, sowie die Rückgabe der Burg Alvensleben an Brandenburg.
Was wird das Jahr 1241 bringen? Es war nur zu wahrscheinlich, dass Magdeburg, Halberstadt und Meißen ihr Vorgehen aufeinander abstimmen würden. Sollte es wieder ein Kampf an zwei entgegengesetzten Fronten sein oder legten es die Gegner auf eine Schlacht an, bei der sie alle ihre Kräfte konzentrierten? Überraschend blieb das ganz Jahr 1241 ruhig, keine der Seiten machte einen Vorstoß in die Landschaften des Gegners. Mit einem abgesprochenen Waffenstillstand, gar mit einem Friedensschluss hatte das nichts zu tun. In Wirklichkeit schaute alles schaudernd Richtung obere Oder in Schlesien. Der ganze Osten Europas war in Bewegung geraten, aus den weiten asiatischen Steppen hatten sich die Mongolen auf den Weg nach Westen gemacht. Sowohl der Orient wie auch die Länder ostwärts Polens wurden überrannt. Nach entsetzlichen Zerstörungen von Sandomir und Krakau, rafften die Polen unter Herzog Heinrich II. alle verblieben Truppen, sowie die schlesischen Landstände zusammen. Auch Böhmen schickte ein Heer und ebenso kam Unterstützung von den Ordensrittern der Templer, Johanniter und vom Deutschen Orden. Schliesslich einzelne, kleine Adelskintingente aus dem deutschen Reichsteil und ein größerer Trupp aus Österreich. Alles in allem deutlich unter 10.000 Mann, gegenüber einer vielfachen Übermacht. Am 9. April 1241 kam es bei Liegnitz in Schlesien zur Schlacht, bei der das polnische Koalitionsheer vernichtend geschlagen wurde, wobei besonders die Polen abermals schwere Verluste erlitten und ihr Seniorherzog Heinrich von Schlesien fiel. Voll bangen wurde der Einfall ins Reich erwartet. Kaiser Friedrich II. stand unverändert in Italien im Kampf gegen dem Papst und die lombardischen Rebellen und konnte nicht helfen. Überraschend wanden sich die siegreichen Mongolen nach Süden, fielen in Mähren ein, dass sie größtenteils verwüsteten, bevor es weiter nach Ungarn ging. Die Gefahr schien im Augenblick vorbei, doch blieb es im Krieg Brandenburgs mit seinen Konfliktgegnern weiterhin ruhig. Keine der Seiten traute der Lage und alle fürchteten die baldige Rückkehr der asiatischen Horden.
Am 9. August 1241, nur etwas mehr als ein halbes Jahr nach seiner Freilassung, war in Halberstadt Bischof Ludolf I. von Schladen gestorben. Zum Nachfolger wählten die Domherren Propst Meinhard von Kranichfeld (1200-1253). Das Jahr verging ohne nennenswerte Kampfhandlungen und ohne eine Entscheidung, doch was würde das neue Jahr bringen? Die alles bedrohende Gefahr des Vorjahres rückte im Augenblick in buchstäblich weite Ferne. Die Mongolen waren mit der Nachfolgefrage des erkrankten und schließlich im Dezember 1241 verstorbenen Großkhans beschäftigt und aus Europa größtenteils abgezogen. Die Tataren, wie man sie auch nannte, hatten sich in kürzester Zeit zu einer weit schlimmeren Gefahr entwickelt als es 300 Jahre zuvor die Einfälle der Magyaren gewesen waren. Vergleichbar nur noch mit dem Hunnensturm der Spätantike. 1242 wirkte die Furcht vor der Bedrohung vorerst noch nach, zu einer Schlacht kam es nicht, wohl aber zu verschiedenen Plünderungen, worunter niemand mehr zu leiden hatte als die Landbevölkerung und gerade auch Klöster, die als reiche Ziele stets beliebte Opfer waren. Ein solcher, besonders zerstörerischer Überfall, fand im Sommer 1242 gegen Stadt und Kloster Nienburg statt. Die Brandenburger, Markgraf Otto III. an der Spitze, fielen damit dem eigenen Verwandten, Graf Heinrich I. von Anhalt, ins Gebiet. Heinrich I., wir sprachen schon gelegentlich von ihm, war neben seinem jüngeren Bruder, Herzog Albrecht I. von Sachsen-Wittenberg, der letzte noch lebende Enkel Albrechts des Bären. Dass sich sogar so nah verwandte Familienzweige immer wieder in lokalen Fehden in gegnerischen Lagern wiederfanden, ist einmal mehr Indiz der allgemein beklagenswerten Zustände im Reich. Die Anordnungen des Mainzer Landfriedens wirkten sich hauptsächlich nur auf die Kleinkriege des einfachen Adels aus, die reichsunmittelbaren Fürsten fanden ihrerseits weiterhin genügend Gründe ihre Konflikte wenn nötig auszutragen, mit allen Folgen für die Bevölkerung. Die ständige Abwesenheit des Kaisers, der im Kampf um die Herrschaft in Italien gebunden war, vernachlässigte dadurch schon zwangsläufig die Bedürfnisse des nördlichen Reichsteils. Die Einsetzung seines unmündigen Sohnes Konrad, dem er dabei keine Regentschaftsvollmacht einräumte, sorgte für keinen Ersatz. Die Fürsten, besonders in Norddeutschland, lebten ohne jede Rücksicht auf den Reichsfrieden, ihre partikularen Interessen aus.
Auch das Jahr 1242 ging im ostsächsischen Raum, abgesehen vom brandenburgischen Zug nach Anhalt, ohne große Kämpfe vorüber. Sowohl der Gebietsstreit um den Teltow mit dem Markgrafen Heinrich von Meißen, wie die Fehde mit Magdeburg, schwelte unentschieden weiter. Die Haltung des 1241 neugewählten Bischofs von Halberstadt war mittlerweile offen feindlich geworden, hierin setzte er die Politik seines Vorgängers konsequent fort. Streitpunkt blieb die Burg Alvensleben, die schon Zankapfel anlässlich der Halberstädter Fehde 1238 war. Damals mussten die Markgrafen, nachdem Otto III. in Gefangenschaft geraten war, die Burg als Lehen vom Halberstädter Bischof nehmen. Das Blatt wendete sich schon zwei Jahre später, im Sommer 1240, als Markgraf Johann I. an der Biese das Heer Magdeburgs und Halberstadt schlug und Bischof Ludolf von Schladen verletzt in die Hände Brandenburgs fiel. Zusammen mit einem Lösegeld, musste auch die sogenannte Markgrafenburg Alvensleben an die Mark zurückerstattet werden, nicht als Lehen, sondern als Besitz.
Juni 1243 wurde Erzbischof Wilbrand, durch Truppen des Markgrafen Heinrich von Meißen unterstützt, erstmals wieder militärisch aktiv. Er hatte sich von der Niederlage des Jahres 1240 erholt und drang nun mit 2.000 Rittern erneut in die Altmark ein, wo Wolmirstedt erst geplündert, dann niedergebrannt wurde. Beim weiteren Zug nach Norden, stießen sie auf Markgraf Johann, der durch ein Heer Herzog Ottos von Braunschweig-Lüneburg, seinem Schwager, unterstützt wurde. Der Herzog revanchierte sich für die brandenburgische Hilfe von 1227, die in dieser kritischen Situation ganz zur rechten Zeit kam. Erzbischof Wilbrand und Markgraf Heinrich von Meißen vermieden eine Schlacht, offenbar waren die Kräfteverhältnisse für sie nicht günstig und zogen sich zurück. Bei Rogätz, noch auf märkischem Gebiet, es war ein wichtiger Elbübergang wo bis heute Fährbetrieb stattfindet, errichteten sie im Juli ein starkes Befestigungswerk, um das Vordringen brandenburgisch-braunschweigischer Truppen auf magdeburgisches Gebiet zu blockieren.
Im Mai 1244 fingen die Kämpfe um Burg Alvensleben ein drittes Mal an. Bischof Meinhard belagerte die Festungsanlage und eröffnete damit eine Serie schwerer Kampfhandlungen in verschiedenen Landesteilen, ganz nach dem Stil des Jahres 1240. Die Garnison in der Burg konnte sich wie es schien, denn es sind keine Berichte bekannt, dass sie erneut in die Hand Halberstadts gefallen wäre, jedoch wissen wir aus späteren Urkunden, dass die Verteidigungswerke bei der Belagerung schwer gelitten hatten. Im gleichen Monat beginnen auch auf dem Teltow die Kämpfe neu aufzuflammen. Markgraf Johann I. führt hier ein brandenburgisches Heer gegen den Gegner aus Meißen, zu einer Schlacht kam es dort jedoch abermals nicht. Als Dritter im Bunde ging jetzt Erzbischof Wilbrand vor. Erneut von Truppen aus Meißen unterstützt, brach er dieses Mal nicht wie bislang in der Altmark ein, sondern ins Havelland. Bei Plaue überschritten sie die Havel und marschieren auf Brandenburg zu. Markgraf Otto III. wirft sich ihnen mit einem Aufgebot märkischer Ritter entgegen und erringt einen glänzenden Sieg. Zahlreiche Gefangene können gemacht werden. Auf der Flucht ertrinken viele der Gegner Brandenburgs, als die Havelbrücke bei Plaue unter der Last der Flüchtenden zusammenbricht. Der Zug ins havelländische Herz war ein Fiasko für den Erzbischof, er erholte sich nicht mehr von der Niederlage und schied bald als Kriegsgegner aus. Leider liegen weder in den brandenburgischen Regesten seiner Markgrafen noch in den Magdeburger Chroniken etwas über einen Friedensschluss und etwaige Friedensbedingungen vor, wir wissen nur, dass es seit der Niederlage zwischen Plaue und Brandenburg zu keinen weiteren Kampfhandlungen mit Magdeburg kam, gleichwohl eine Versöhnung mit dem Erzbischof unmöglich schien, wodurch die Fehde formell fortgeführt wurde.
Bischof Meinhard von Halberstadt schien sich damals aus dem Konflikt gezogen zu haben. Aus dem Folgejahr, dem 22. Mai 1245, ist uns eine Urkunde erhalten, in der die Bedingungen niedergeschrieben wurden, unter welchen die brandenburgischen Markgrafen zu gemeinsamer Hand die umkämpfte Markgrafenburg Alvensleben als Halberstädter Lehen erhielten, ebenso ihre Nachfahren. Offenbar waren Johann und Otto zur Beilegung des jahrelangen Streits bereit, die Festung gemäß den alten Bedingungen wieder als Lehen zu nehmen, statt sie als Kriegsbeute zu annektieren, was höchstwahrscheinlich nur den Unwillen weiterer sächsischer Fürsten und möglicherweise sogar der römischen Kirche heraufbeschworen hätte. So waren am Ende des jahrelangen Kampfes mit Halberstadt die Verhältnisse in unveränderter Weise wiederhergestellt. Für Brandenburg ein Erfolg, denn als Lehnsnehmer hatten sie das uneingeschränkte Nießrecht, was ihnen der Halberstädter Bischof abspenstig zu machen suchte, um die damit verbundenen Pfründe selbst zu nutzen.
Auch im Kampf um den Teltow zeichnete sich ein Ende ab. König Wenzel I. von Böhmen, wir erinnern uns, seine älteste Tochter Beatrix war mit Otto III. von Brandenburg verheiratet, trat als Vermittler in dem Konflikt auf. Er bot sich dafür geradezu als Idealperson an, denn seine zweiter Tochter Agnes, war mit Heinrich III. von Meißen verheiratet. Die Bemühungen des gemeinsamen Schwiegervaters zeigten Erfolg. 1245 wurde der Konflikt beigelegt. Brandenburg behielt die umstrittenen Burgbezirke und den Teltow. Die Mark setzte sich damit im mehrjährigen Krieg als Sieger durch und riegelte Meißen, vielmehr die Niederlausitz von einem möglichen Landzugang zur Oder ab. Für Brandenburg war der Sieg der Garant für die bald einsetzenden alleinige Inbesitznahme der Gebiete östlich der Havel bis zur Oder, wozu neben dem mehrfach erwähnten Teltow, auch bald das Land Lebus gehörte.
Absetzung des Kaisers & Wahl eines Gegenkönigs
Während für Brandenburg der jahrelange Konflikt am Ende erfolgreich und wegweisend ausging, erreichte der Streit des Kaisers einen ganz neuen Höhepunkt. 1243 wurde nach einer neunzehnmonatigen Sedisvakanz, in der der Heilige Stuhl unbesetzt blieb, Innozenz IV. zum neuen Oberhaupt der Römischen Kirche gewählt. Der Kaiser versuchte mit dem neuen Papst in persönliche Verhandlungen zu treten, dieser wich einem Treffen jedoch mehrmals aus, bis er schließlich aus Rom, wo ihn die Bürgerschaft unter Druck setzte, nach Genua und von dort weiter nach Lyon flüchtete. Dorthin berief er für den 24. Juni 1245 ein allgemeines, letztlich schlecht besuchtes Konzil, des wichtigstes, man möchte fast sagen einziges Thema die vom Papst längst beschlossene Absetzung des Kaisers war. Das Konzil war mehr oder weniger eine Farce, denn die versammelten Teilnehmer hatten bei diesem Thema überhaupt kein Mitspracherecht. Sie dienten nur als Kulisse für die päpstliche Inszenierung. Nach einem förmlichen hin und her, zwischen dem Papst, der gleichzeitig Ankläger und Richter war und dem kaiserlichen Vertreter, wurde am 17. Juli die Absetzung Friedrichs II. verkündet und die zweit Exkommunikation von 1239 bestätigt. Sicherlich lieferte der an Hedonismus grenzende Lebenswandel des Kaisers, seine zahlreichen Frauengeschichten, sein Verkehr mit Ungläubigen etc., ausreichend berechtigte Gründe nach damaligem, wohl auch heutigem Kirchenrecht, einen Ausschluss aus der Gemeinschaft der Christenheit auszusprechen, doch die politische Absetzung war etwas ganz anderes und offenbarte das tatsächliche Motiv hinter all den päpstlichen Aktivitäten, aktuell wie in der Vergangenheit gegen den Kaiser, im Grunde gegen das römisch-deutsche Kaisertum in Gänze. Ein nachweislicher Sünder nach christlichen Wertevorstellungen, traf hier auf einen Heuchler der Kirchenrecht anwandte um Politik zu machen.
Zunächst änderte sich überhaupt nichts. Isoliert in seinem selbstgewählten Lyoner Exil, war der Handlungsspielraum des Papstes verschwindend gering. Innozenz schickte in einem auf den 21. April 1246 datierten Schreiben, an ausgewählte Fürsten und Prälaten des Reich die Aufforderung einen neuen König zu wählen, denn mit der Absetzung des Kaisers, lehnte er im gleichen Atemzug das Recht auf die Krone, seines 1237 gewählten Sohnes Konrad ab. Der Papst wollte keinen Staufer, gleich wer es auch immer sei, womit abermals das rein politische Motiv seiner Handlungen, wie das vieler seiner Amtsvorgänger, zweifelsfrei zum Ausdruck kam. Es ging um die Macht in Italien und es ging um die Frage wer über wem steht, der Papsttum über dem Kaisertum oder das Kaisertum über dem Papsttum.
Zu den Empfängern eines solchen Schreibens gehörten auch die Markgrafen von Brandenburg. Offenbar glaubte Innozenz IV., wie vor ihm schon Gregor IX., in den märkischen Regenten vielversprechende Kandidaten für die antistaufische Partei zu finden. Die antikaiserliche Opposition im Reich wurde angeführt von den Erzbischöfen aus Mainz und Köln, in ihrem Fahrwasser einige weitere Fürsten zumeist aus dem geistlichen Stand.
Am 22. Mai 1246 wählte eine kleine Gruppe anwesender Bischöfe, sowei zwei weltliche Fürsten in Veitshöchheim, nordwestlich von Würzburg, Heinrich Raspe IV., den Landgrafen von Thüringen, zum Gegenkönig. Die brandenburgischen Markgrafen sind der Aufforderung des Papstes nicht gefolgt. Sie aber deswegen als bekennende Anhänger zur Stauferpartei zu zählen, geht wahrscheinlich zu weit. Sie hielten sich schlicht und ergreifend aus den Verwicklungen heraus, so gut es denn ging. Es war nur sehr bald mit einem ausbrechenden Krieg um den Thron im Reich zu rechnen, und sich hier nicht hineinziehen zu lassen, war die erklärte Absicht Johanns und Ottos, besonders nach den langen Jahren des Kriegs mit Meißen, Magdeburg, Halberstadt und Anhalt. Und wirklich, keine drei Monate nach der Wahl, standen sich Anfang August 1246, nordwestlich von Frankfurt, an der Nidda, die gegnerischen Heere gegenüber. Konrad IV., der mittlerweile achtzehnjährige Sohn des Kaisers, führte die staufertreuen Truppen an, Landgraf Heinrich Raspe von Thüringen die oppositionellen Truppen. Dass der Gegenkönig so schnell ein großes Heer mobilisieren konnte, war mit dem Geld des Papstes möglich und Geld sowie Aussicht auf staufisches Gebiet in Schwaben war es auch, dass dem Verrat Tür und Tor öffnete. Nachdem die Streitkräfte beider Seiten, diesseits und jenseits der Nidda einander mehrere Tage beschatteten, eröffnete der junge König Konrad die Kampfhandlungen, indem er die Schlacht erzwang. In diesem Moment liefen zwei schwäbische Fürsten, die Grafen Ulrich von Württemberg und Hartmann von Grüningen aus seinem Heer mit rund 2.000 Kämpfern zu Heinrich Raspe über. Der Verrat der Treulosen war abgesprochen. Päpstliches Geld und die Zusage auf staufisches Gebiet in Schwaben, waren Antriebsfeder des Seitenwechsels. Die Schlacht ging für Konrad verloren, er konnte nach Frankfurt fliehen, das wie die meisten bedeutenden Städte kaisertreu blieb.
Heinrich Raspe, man sollte es noch erwähnen, war zuvor ein treuer Parteigänger des Kaisers und gemeinsam mit dem König von Böhmen seit 1242 eingesetzter Reichsgubernator, nachdem zuvor überraschend der Mainzer Erzbischof und bisherige Reichsvikar ins antistaufische Lager überwechselte. Von der päpstlichen Diplomatie verführt, wandte er sich von den Staufern ab und ließ sich zum Gegenkönig wählen. Die fast nur von Prälaten vollzogene Wahl und die finanziellem Zuwendungen seitens der Kirche, brachten ihm den Beinamen Pfaffenkönig ein.
Nach seinem Erfolg bei Frankfurt, hielt er zwei schlecht besuchte Hoftage ab, bevor er zur Durchsetzung seiner Königsherrschaft begann staufertreue Städte in Schwaben zu belagern, wie Ulm und Reutlingen. Vor letzter Stadt wurde er im Winter 1246 anlässlich eines kleineren Gefechts verwundet, worauf er die Belagerung abbrach und sich nach Thüringen, auf die Wartburg zurückzog. Hier starb er schon am 16. Februar 1247 im Alter von wahrscheinlich 42 Jahren.
Da er keinen männlichen Nachkommen hinterließ, hatte sein Tod erhebliche Auswirkungen auf das Machtgefüge im ostsächsisch-thüringischen Raum. An Markgraf Heinrich III. von Meißen, dem jahrelangen Kriegsgegner Brandenburgs, ging nach langem Erbfolgekrieg die Landgrafschaft Thüringen, für die er schon seit 1242 die Eventualbelehnung seitens Kaisers hatte. Der hessische Teil des großen territorialen Erbes ging letztendlich an Heinrich aus dem Hause Brabant, der als Heinrich I. Gründer des Hauses Hessen war. Aber zurück zu Markgraf Heinrich III. von Meißen. Im Besitz der Markgrafschaften Meißen und Niederlausitz sowie der Landgrafschaft Thüringen, schwang er sich zu einer bedeutenden Mittelmacht auf und legte den Grundstein für den späteren Aufstieg der Wettiner zu einer der großen Dynastien im Reich.
Der Tod Heinrich Raspes stellte die Gegner des Kaisers im Reich und natürlich auch Papst Innozenz IV., den Drahtzieher hinter allem, vor die Frage wie es nun weitergehen sollte. Im Reich fand sich niemand unter den einflussreichen Familien, die einen neuen Gegenkandidaten stellen wollte. Die Stauferpartei war durch den raschen Tod des Gegenkönigs gestärkt worden. Nicht wenige glaubten sogar an ein Gottesurteil. Besonders den allermeisten weltlichen Reichsfürsten war die Einmischung des Papstes in die Angelegenheiten des Reichs, besonders in die Thronfrage mehr als nur ein Dorn im Auge. Der am Niederrhein herrschende, mächtige Kölner Erzbischof Konrad I. von Hochstaden, hielt in den nordwestlichen Reichsteilen Ausschau nach einem für seine eigenen Belange passenden Kandidaten, den er in dem Grafen Wilhelm II. von Holland fand. Des Kaisers Sohn Konrad IV. war in etwa so alt, in den frühen 20’er Jahren, wie der holländische Gegenkönig in spe.
Am 3. Oktober 1247 wurde Wilhelm in Worringen, ein heutiger Stadtteil von Köln, damals noch außerhalb der Stadtmauern Köln, die staufisch gesinnt blieb und seine Tore verschlossen hielt, zum Gegenkönig gewählt.
Die Erzbischöfe von Köln, Mainz, Trier, Bremen sowie wie ihre Suffraganbischöfe, des Weiteren die Bischöfe von Münster, Speyer, Straßburg und Würzburg waren anwesend, ebenso der Herzog von Brabant und der Graf von Geldern. Die Krönung erfolgte erst mehr als ein Jahr später, am 1. November 1248 an symbolträchtigem Ort in Aachen. Der Zugang zur kaiserlich, zur staufisch gesinnten Stadt, konnte erst nach langer Belagerung erzwungen werden.
Im Reich begannen sich Auflösungserscheinungen hinsichtlich der Königtums bemerkbar zu machen. Weder Konrad IV., am wenigsten sein in Italien weilender Vater, Kaiser Friedrich II. aber auch der Gegenkönig konnten ihre Position ausbauen. Keine Seite fand ausreichend aktiv mitwirkende Anhänger um sich militärisch durchzusetzen, womit alles in der Schwebe blieb. Konrad unternahm bis 1250 zwei Vorstöße ins Gebiet des Niederrheins, zog sich aber stets wieder in seine gesicherten Gebiete im Südwesten zurück.
Währenddessen nahmen die sonstigen Dinge ihren Lauf. Die großen Städte begannen sich als lokale Machtzentren von den sie umgebenden Regionalfürsten zu emanzipieren. Zum Schutz ihres Handels und zur Durchsetzung ihre Unabhängigkeitsbestrebungen, formten sich erste größere Städtebünde. Und auch die Reichsfürsten machten Politik ohne Repressalien des Reichsoberhaupts fürchten zu müssen.
Die Jahre 1245 – 1249 in Brandenburg
Brandenburg, das sich Mitte 1245 im Teltow-Krieg wie auch in der Magdeburger Fehde gegen alle seine Gegner durchsetzen konnte, profitierte von den verworrenen Zuständen an der Spitze des Reiches. Der alte Rivale aus Meißen war in einen langen Erbfolgestreit um den thüringisch-hessischen Nachlass des verstorbenen Markgrafen und Gegenkönig Heinrich IV. Raspe verwickelt und hierdurch an einem neuerlichen Kampf um den Teltow für die nächsten gehindert. Wahrscheinlich war es der befürchtete Thronkampf zwischen Konrad IV. und Heinrich Raspe, der den Krieg mit Meißen zu einem für Brandenburg guten Ende bracht. Nach dem vorzeitigen Tod des Gegenkönigs und dem Ringen um dessen Erbe, verlagerten sich die Interessen des Markgrafen Heinrichs III. von Meißen für einige Zeit in Richtung des mitteldeutschen Raums. Den brandenburgischen Brüdern gab es die Gelegenheit ihre Stellung zwischen Elbe, Havel und Oder auszubauen und gleichzeitig die erheblichen Kriegsschäden im Land, wovon die Altmark am meisten betroffen war, sukzessive zu beheben. Neben zahlreichen beurkundeten Schenkungen an Kirchen und Klöster zum eigenen wie auch zum Seelenheil verstorbener Angehöriger, hierin unterschieden sie sich nicht von ihren Vorfahren oder vergleichbaren Fürsten der Epoche, lesen wir vermehrt von Maßnahmen worin die Bewohner der im Krieg stark in Mitleidenschaft gezogenen Städte beim Wiederaufbau unterstützt wurden. So sind das freie Schlagen von Bauholz oder die zeitlich beschränkte Befreiung von Abgaben nur einige Beiträge zur Förderung der Aufbautätigkeiten in den heimgesuchten Städten und Gegenden.
In der Zeit unmittelbar nach der vom Papst ausgesprochenen, in der Realität aber wenig durchgreifenden Absetzung des Kaisers, bemühte sich Innozenz III. wiederholt die brandenburgischen Regenten für die antistaufische Partei zu gewinnen. Johann und Otto hatten in der Angelegenheit keine verbindliche Position, so lange die Umstände es nicht erforderten. In dieser Angelegenheit teilten sie die Gesellschaft viele norddeutscher Fürsten. Als Heinrich Raspe verstarb, brach die Partei des Papstes im mitteldeutschen Raum ebenso zusammen wie in Schwaben, konnte sich aber entlang des Niederrheins halten. In Brabant und Holland und besonders bei einer Reihe von Bischöfen, hielt sich eine starke antikaiserliche Opposition, was zur erwähnten Wahl und Krönung des jungen Grafen Heinrich von Holland führte. Da die brandenburgischen Markgrafen im Augenblick von keiner Seite einen Vorteil zu erwarten hatten, blieben sie neutral und suchten weder einen Konflikt mit den Staufern, noch mit der Kirche heraufzubeschwören. Eine bewusste Position gegen den Kaiser und seinen Sohn Konrad einzunehmen hätte mit großer Wahrscheinlichkeit dem vor nicht langer Zeit erst beigelegten Gegensatz zu Magdeburg und Meißen, beides enge Anhänger der Staufer, wieder frische Nahrung gegeben und aufleben lassen. Zur Konsolidierung des Teltow und mehr noch zur Ausweitung bis zur Order auf ganzer Breite und nicht nur östlich der Uckermark, war der Erhalt des Friedens mit den unmittelbaren Nachbarn wichtig. Mit der Hebung des Landes gingen in diesen Jahren einige bedeutende Städtegründungen einher, denen wir aber an späterer Stelle wollen einen eigenen Abschnitt widmen werden. In dem Zusammenhang werden ebenso noch zwei wichtige Klostergründungen erwähnt.
Werfen wir einen Blick auf Böhmen, das vor einer Generation unter Ottokar I. Přemysl (1155-1230) durch den römisch-deutschen König Philipp von Schwaben, seinem Schwiegervater, zum Königreich erhoben wurde und im Reich dahingehend seither eine Sonderstellung genoss. Zwischenzeitlich war Wenzel I. auf dem Thron nachgefolgt. Ein begabter Monarch, der aber den Freuden des Lebens, hier besonders der Jagd und prunkvollen Hofhaltung zeitweise vielleicht etwas zu viel zugetan war. Er leitete die starke Zuwanderung deutscher Siedler ein, die dadurch viel handwerkliches Wissen ins Land brachten. Böhmen, reich an wertvollen Erze, erlebte in der Folgezeit eine erste wirtschaftliche Blüte. Die Politik Wenzels blieb im großen Streit zwischen dem heiligen Stuhl und dem Kaiser wechselhaft, mal mit den Staufern, mal mit den Anhängern des Papstes liebäugelnd, suchte er den größtmöglichen Nutzen für seine eigene Herrschaft zu sichern, ohne tatsächlich für die eine oder andere Seite wirklich tätig zu werden. Mit Brandenburg verband ihn die schon erwähnte Ehe seiner ältesten Tochter Beatrix, die seit 1243 mit Markgraf Otto III. vermählt war. Wenzel unterhielt überhaupt mit den Fürsten der sächsischen Nachbarschaft enge Verbindung, so war auch seine zweite Tochter Agnes mit einem sächsischen Fürsten verheiratet, mit dem schon vielfach erwähnten Markgrafen Heinrich III. von Meißen. Des Königs Sohn Ottokar, der spätere Ottokar II., seit März 1247 Markgraf von Mähren, nachdem sein älterer Bruder Vladislav im Januar gestorben war, begann in seinem neuen Refugium sofort eine rege Tätigkeit. Noch im Laufe des Jahres kam er erstmals in Konflikt mit dem Vater und zwar im Zusammenhang mit der vom König initiierten Resignation des Olmützer Bischofs Konrad von Friedberg. 1249 intensivierten sich die Gegensätze zwischen Vater und Sohn und es kam zu Aufständen und mehren militärischen Auseinandersetzungen. Für einige Zeit sah es danach aus, als ob der alte König unterliegen könnte. Die aufständige Opposition wählte Ottokar am 31. Juli 1248 in Prag zum König. Nicht zum Gegenkönig, eher zum regierenden Juniorkönig. In dieser kritischen Lage, rief Wenzel I. nach Hilfe aus dem deutschen Umland. So zogen aus den sächsischen Regionen Herzog Otto von Braunschweig-Lüneburg, Herzog Albrecht von Sachsen-Wittenberg und die Markgraf Otto von Brandenburg mit großem Heer am 11. November 1248 zu seiner Unterstützung nach Böhmen. Bei Brüx, an der nordböhmischen Grenze zu Meißen, kam es zur Schlacht in der die aufständige Opposition um Ottokar geschlagen wurde. Im Frühjahr 1249 kam es zum Vergleich und der Bestätigung Ottokars als Miregent, doch änderte sich die Situation rasch, als der Papst den jungen Mitkönig exkommunizierte, wegen angeblicher Nähe zu den Staufern. Der Kirchenbann kostet Ottokar viele Anhänger in Böhmen und Mähren, was seine Position als gleichberechtigter König neben den Vater untergrub. Dieser nutzte die Situation aus um den Sohn für einige Zeit zu internieren. Da sich Wenzel in den letzten Jahren seines Lebens immer weniger der aktiven Politik widmete, konnte der Sohn nach seiner Freilassung wieder an Einfluss hinzugewinnen, bevor 1253 die Nachfolge des Vaters auf dem Thron Böhmens antrat.
Lebuser Land im zweiten Anlauf
Nach dem Ausflug ins verschwägerte Böhmen, ist ein Blick nach Schlesien und Polen überfällig. Das regierende Geschlecht der Piasten war seit Generationen in verschiedene, sich teils bekriegende Herzogtümer zersplittert. Wir berichteten über den verheerenden Einfall der Mongolen und der Niederlage anlässlich der Schlacht bei Liegnitz April 1241, bei dem Herzog Heinrich II. von Schlesien, der gleichzeitige Seniorherzog von Polen, ums Leben kam. Schlesien zerfiel daraufhin unter vier seiner Söhne in weitere Teilherzogtümer. Als bereits 1242 Mieszko von Lebus, der zweitälteste der Erben starb, entstanden erste Streitigkeiten unter den überlebenden Brüdern Boleslaw II. und Heinrich III., die im Frühjahr 1249 zur Schließung von Schutzbündnissen führte. Was jetzt geschah, ist eine erstaunliche Episode. Wir erinnern uns noch, 1239 versuchte der Magdeburger Erzbischof das Land Lebus in Gemeinschaft mit Brandenburg zu erobern und dem Vater der jetzt zerstrittenen Erben, dadurch das Land zu entreißen. Nach dem erfolglosem Versuch, kam es zum Bruch zwischen Magdeburg und Brandenburg sowie einem bald danach ausbrechenden, mehrjährigen Krieg beider Fürstentümer. Am 20. April 1249 schloss Boleslaw II., ältester Sohn des 1241 gefallenen Herzog Heinrichs II., jener Heinrich der Lebus 1239 erfolgreich verteidigte, zu Liegnitz einen Vertrag mit Erzbischof Wilbrand von Magdeburg, wonach dieser ihm das Land Lebus beiderseits der Oder verkaufte und danach die Hälfte des Gebiets von Magdeburg als Lehen zurücknahm. Die Motivation dahinter war getrieben vom alleinigen Machtanspruch Boleslaws, der Schlesien komplett regieren wollte, hier aber mit den Erbansprüchen der jüngeren Brüder kollidierte. Herzog Heinrich III.l sein nächstjüngerer Bruder, war vor zwei Jahren volljährig geworden und forderte seinen Erbanteil ein. Zunächst unwillig, musste sich Herzog Boleslaw dem Drängen des schlesischen Adels beugen. Es kam zur Teilung Schlesiens, der weitere folgten. Um seinen Machtanspruch nicht völlig zu verlieren, kam es zum oben erwähnten Vertrag und Lehnsverhältnis mit Magdeburg. Heinrich III., dem Niederschlesien zugefallen war, suchte sich seinerseits Unterstützung bei Markgraf Heinrich III. von Meißen, dem alten brandenburgischen Widersacher. Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Abkommens zwar noch mitten im Erbfolgekrieg rund um den Nachlass Landgraf Heinrich Raspes, doch machte ihn das nicht zu einem weniger gefährlichen Konkurrenten für den hohen Kirchenfürsten, der nun seinerseits nach Bündnispartner suchte. Für Brandenburg war die ganze Entwicklung höchst unangenehm. Weder den Magdeburger Erzbischof und noch viel weniger den Meißner Markgrafen wollte man im Osten seines Gebiets sehen. Es kam zu einer neuerlichen Annäherung zu Magdeburg. Welche Seite den Anfang machte, ist nicht unbedingt ersichtlich, es könnte Brandenburg gewesen sein, wie auch immer, es wurde eine neuerliche Kooperation vereinbart und Erzbischof war bereit mit Brandenburg das Gebiet zu teilen. Eine ungemein interessante und unerwartete Entwicklung. Waren Magdeburg und Meißen während der Jahre des Teltow-Kriegs noch gemeinsam auf einer Seite die Kriegsgegner Brandenburgs, standen sie nun, keine fünf Jahre später, in gegnerischen Lagern und Brandenburg an der Seite Magdeburgs. Vor zehn Jahren versuchte diese Konstellation schon einmal das Lebuser Land zu erobern und jetzt bekamen sie, zunächst nur der Erzbischof, das weiträumige Gebiet links und rechts der Oder, getrieben von den Umständen, freiwillig übergeben. Herzog Boleslaw musste sich ganz offenbar in einer finanziellen Zwangssituation befunden haben. Ob und wenn ja, welche Rolle des Herzogs Gemahlin Hedwig von Anhalt spielte, die Tochter des askanischen Grafen Heinrich von Anhalt, wissen wir nicht. Es ist allerdings zu vermuten, dass über sie Kontakte zu den benachbarten sächsischen Fürstenhäusern bestand. Überhaupt wurden noch unter Boleslaws Vater Herzog Heinrich II., wir haben es noch nicht erwähnt, er trug den Beinamen der Fromme, viele deutsche Siedler und auch Rittergeschlechter ins Land geholt. Das ganze 13. Jahrhundert war geprägt von einem umfassenden deutschen Besiedlungswerk außerhalb der Grenzen des damaligen Reichs. Nicht nur in Böhmen, das natürlich zum Reich gehörte, sondern auch in Schlesien, in Nordmasowien, dann bald entlang der baltischen Küste, worüber wir gesondert im nächsten Kapitel schreiben werden, und seit längerem in Ungarn, entstanden über die Zeit abertausende deutscher Siedlungen. Ganze Landstriche mit florierenden Städten wuchsen in den nächsten zwei Jahrhunderten aus dem Boden. Vor diesem Hintergrund mag die hohe deutsche Affinität unter den schlesischen Piasten zu erklären sein, die sich bald von ihren polnischen Verwandten zu lösen begangen.
Die Darstellung der Besitz- und Lehnsverhältnisse im Zusammenhang mit dem Land Lebus sind für die kommenden Jahre 1249 – 1252 verwaschen. Es existieren erzählende Chroniken aber keine verbindlichen, urkundlichen Belege. Wir können daher nicht mit Sicherheit den Übergang des Landes von Magdeburger Besitz, zu brandenburgischem Teil- dann Alleinbesitz nachzeichnen. Es erscheint so, dass 1250 der Landesteil links der Order mit der Stadt Lebus käuflich an die Brandenburger Brüder ging, während der Teil rechts des Stroms, das sogenannte spätere Land Sternberg, benannt nach dem Magdeburger Erzbischof Konrad II. von Sternberg, beim Erzstift verblieb.
Die Mark Brandenburg hatte sich mit dem Erwerb dieses Gebiets auf seiner ganzen Breite von der linskselbischen Altmark über die bald sogenannte Mittelmark, bis an die Oder ausgebreitet. Damit war weitestgehend die Fläche der ehemaligen Nordmark wie zu Zeiten Kaiser Otto I. des Großen erreicht. Ein wesentlicher Unterschied zur Ottonischen Zeit, damals war die Mark ein reines Tributland, nur formell unter der Herrschaft eines Markgrafen. Mittlerweile, durch die generationenlange Kolonisierung und Christianisierung, hatten die deutschen Siedler längst die Überhand gewonnen und die Slawen, Heveler, Sprewanen, Ukranen etc. wurden als Volk und Kultur fast ganz verdrängt und gingen bis auf Reste in der neuentstehenden märkischen Mischbevölkerung auf.
Ob es mit dem Markgrafen Heinrich III. von Meißen in der Rolle des Verbündeten, namensgleichen Herzogs Heinrich III. von Niederschlesien kam, lässt sich nicht beweisen. Es erscheint wahrscheinlich, dass sich der Markgraf von Meißen im Land Lebus zunächst festsetzte und mit den vereinten Kräften des Erzbischofs und der markgräflichen Brüder vertrieben wurde.
Tod Kaiser Friedrichs II.
Am 13. Dezember 1250 starb Kaiser Friedrich II. in Italien. Seine Vision eines universellen Kaisertums scheiterte an den nahezu ununterbrochenen Konflikten mit den oberitalienischen Kommunen und dem unüberbrückbaren Gegensatz zum Papstum. Zu den großen Rückschlägen seiner Amtszeit gehörte auch die Auseinandersetzung mit seinem erstgeborenen Sohn aus erster Ehe, Heinrich VII., den er als Regent im nördlichen Reichsteil einsetzte und der nach mehrjährigen Auseinandersetzungen 1235 auf dem Wormser Hoftag abgesetzt und anschließend auf verschiedenen unteritalienischen Burgen inhaftiert wurde, wo er starb. Zuletzt noch genannt die zunehmende Unabhängigkeit der Reichsfürsten, die sich 1220 und 1231/32 ihre Privilegien verbriefen ließen, was dann im Mainzer Landfriede von 1235 in gewissem Maße wieder im Sinne einer kaiserlichen Zentralautorität relativiert wurden. Die Territorialisierung des Reichs nahm unter Friedrichs Regentschaft erheblich an Fahrt auf. Seine dauernden und jahrelangen Abwesenheiten vom deutschen Reichsteil, förderten die Autonomisierung der Reichsfürsten.
In seiner Zeit erreichte das Schrifttum eine Wiedergeburt. Althergebrachte Gesetzesbräuche wurden kodifiziert, beginnend mit dem Sachsenspiegel, der als Kristallisationspunkt für viele gleichartige, regionale Gesetzbücher diente. Sie bildeten den Grundstock einer ersten niedergeschriebenen Rechtsauffassung. Auf reichspolitischer Ebene entstanden wichtige Vertragswerke, die den Anfang einer Reichsverfassung darstellten, wenn es auch bis zum Ende des Reichs nie zu einem umfassenden Verfassungswerk kam. Die Einrichtung eines ständigen Hofgerichts war eines der Ergebnisse des Mainzer Landfriedens von 1235. Über weitere Eckpunkte seiner Regierungszeit haben wir berichtet.
Friedrich II. war ein Monarch von ungewöhnlichem Facettenreichtum. Vier Kronen vereinte er auf sich, die des Heiligen Römischen Reichs, ein Begriff der wenige Jahre nach seinem Tod 1254 erstmals verwendet wurde und alsbald zum offiziellen Eigennamen wurde, die Eiserne Krone der Langobarden, die Krone Siziliens und die Krone des Königs von Jerusalem. Bis heute wird unter den Fachleuten der Mensch und Charakter des italienischsten aller Staufer diskutiert. Vom modernen Monarchen über gescheiterten Despoten, reicht die Bandbreite vom Mittelalter bis in die heutige Zeit nach. Wir wollen uns kein eigenes Bild erlauben, da Friedrich II. nicht Gegenstand unserer Arbeit ist. Er war einer der römisch-deutschen Herrscher während der Expansionsphase Brandenburgs nach Osten, hatte aber außer dem feierlichen Belehnungsakt in Ravenna Dezember 1231, anlässlich dieser er ebenfalls die Lehnshoheit Brandenburgs über Pommern bestätigte, wenig Verbindungen mit den askanischen Brüdern, die sich ihrerseits größtenteils der Reichspolitik zugunsten eigener Hauspolitik fernhielten.
Auch wenn man allgemein nicht wirklich einen harten Schnitt beim Übergang von einer zur nächsten Epoche vornehmen kann, so ist es keinesfalls verkehrt wenn man sagt, dass mit dem Tod des Kaisers für das Reich die Zeit des Hochmittelalters zu Ende ging und ein neuer Zeitabschnitt begann.
Konrad IV., ältester lebender Sohn Friedrichs aus der Ehe mit Isabella von Brien (1212–1228), die mit erst 16 Jahren noch im Kindbett verstarb, trat die schwere Nachfolge an. Er war schon seit 1237 gewählter Mitkönig ohne jedoch Regentschaftsautorität zu Lebzeiten des Vaters besessen zu haben. Reichsgubernatoren wie zunächst der Erzbischof von Mainz, nach dessen Übertritt zur antistaufischen Opposition, der König von Böhmen und der Landgraf von Thüringen, waren die eigentlichen Reichsverweser. Die Erfahrungen Friedrichs II. mit Sohn Heinrich VII. ließen ihn in dieser Hinsicht vorsichtig werden und so war erst mit dem Tod des Kaisers, der tatsächliche Übergang der Macht möglich. Der Kaiser wurde 1245 von Papst Innozenz IV. abgesetzt, nachdem seine Amtsvorgänger ihn davor zweimal mit dem Kirchenbann belegten. Es wurden in rascher Folge zwei Gegenkönig gewählt, der erste, der ehemalige Vertraute des Kaisers und eingesetzte Gubernator, Heinrich Raspe, starb schon bald, während Wilhelm von Holland zu Lebzeiten des Kaisers und Konrads IV. keine Akzente setzen konnte. Die Zurückhaltung des Gegenkönigs verhütete nach dem Tod Friedrichs einen blutigen Thronstreit und so trat Konrad das Erbe des Vaters im nördlichen Reichsteil zunächst unbehelligt an, gestützt auf eine starke Stauferpartei. Die Antistauferkoallition im Nordwesten entlang des Niederrheins, blieb stark, sie war hauptsächlich getragen vom Kölner Erzbischof und dem Herzog von Brabant. Konrad musste trotz dieser Ausgangslage auf seine Anhängerschaft im nordalpinen Raum vertrauen und sich um die fernen Besitzungen in Ober- und Unteritalien, samt Sizilien kümmern. Tatsächlich konnte er in Süditalien und Sizilien die Situation nach anfänglichen Schwierigkeiten stabilisieren und seine königliche Autorität festigen. Zu einer Rückkehr in den deutschen Reichsteil kam es nicht mehr, er starb schon am 21. Mai 1254 im Heerlager bei Lavello, vermutlich an den Folgen von Malaria. Er hinterließ ein unmündigen Sohn namens Konradin, den er selbst nie zu Gesicht bekam und der nie echte Königsgewalt ausüben konnte. Er wird als letzter legitimer Staufer 14 Jahre später noch als Jüngling Opfer des ruchlosen Karl von Anjou, der ihn gemeinsam mit einigen seiner engsten Vertrauten auf der Piazza del Mercato in Neapel öffentlich köpfen ließt. Ein ungeheuerliches Verbrechen, ein Bruch allen gültigen Völkerrechts und Verstoß gegen allen Sitten und Gepflogenheiten im Umgang mit herrschaftlichen Gefangen. Die meisten Zeitzeugen zeigten sich geschockt und selbst im Lager der antistaufischen Guelfen ging ein Raunen durch die Reihen.
Mit dem Ende der Staufer brach die alte Welt in Teilen zusammen, für das Reich begann die Zeit des sogenannten Interregnums, die Zeit zwischen den Königen. Formell sollten zwar mit Wilhelm von Holland, Richard von Cornwall sowie dessen Gegenkönig Alfons von Kastilien, drei Könige gewählt werden, keiner konnte jedoch im Reich ausreichend königliche Autorität entwickeln oder nachhaltige Spuren hinterlassen.
Vertrag von Landin
Kehren wir chronologisch noch einmal in das Todesjahr Kaiser Friedrichs II. zurück, ins Jahr 1250. Die Erwerbungen des Landes Lebus waren in vollem Gange, der Ausgang längst nicht sichergestellt. Zeitgleich mit der Expansionsabsicht Brandenburgs in Richtung mittlere Oder, kam es mit Herzog Barnim I. von Pommern zum Vertrag von Landin. Wir erinnern uns an das Oberlehnsrecht Brandenburgs über Pommern, das Kaiser Friedrich II. anlässlich des Hoftags zu Ravenna 1231 bestätigt hatte. Fünf Jahre später kam es zum Vertrag von Kremmen, es wurde im vorhergehenden Kapitel darüber berichtet. Pommern war, nachdem es die dänische Lehnshoheit abgeschüttelt hatte, unter den Vettern Wartislaw III. und Barnim I. aus dem Greifenhause geteilt. Die Ausgangslage für beide war schwierig, von allen Seiten wurde nach den Ländereien des zweigeteilten Herzogtums gegriffen, das noch stark slawisch, wenn auch längst christianisiert war. Wartislaw machte den Anfang und unterwarf sich Brandenburg. Er trat die Landschaften von Stargard, Beseritz und Wustrow an die Mark ab, erteilte den brandenburgischen Markgrafen das Sukzessionsrecht für den Fall dass er ohne männlichen Erbe stürbe und nahm den Rest seiner Gebiete als brandenburgisches Lehen. Sein Vetter Barnim I. machte zunächst keine Anstalten seine Ländereien als Lehen von den brandenburgischen Markgrafen zu nehmen. Die Unterwerfung musste später noch erfolgt sein, denn er war wiederholt in der Umgebung der Markgrafen zu sehen, was nicht denkbar gewesen wäre, hätte er sich dauerhaft widerspenstig erwiesen.
Es scheint dass Herzog Barnim I. irgendwann in der zweiten Hälfte der 1240’er Jahre das Land Wolgast an sich brachte. Wolgast gelangte seinerzeit als Mitgift der dänischen Prinzessin Sophia, Gemahlin Markgraf Johanns I., an die Mark. Die näheren Umstände der Inbesitznahme Wolgast durch Herzog Barnim sind ungeklärt, die Urkundenlage gibt hierzu keine Hinweise. Man hätte aufgrund der brandenburgischen Untätigkeit eine wie auch immer geartete Übereinkunft annehmen können, läge nicht die Urkunde von Landin aus dem Jahre 1250 vor. Der Herzog bekennt darin Burg und Land Wolgast unrechtmäßig erlangt zu haben. Er trat von sich aus auf die Markgrafen zu, um die Angelegenheit zu regeln und bot im Tausch gegen Wolgast die restliche Uckermark an. Wolgast nahm er als brandenburgisches Lehen entgegen. Erwähnenswert ist der Sachverhalt, dass die Belehnung zu gemeinsamer Hand mit seinem Vetter Wartislaw III. erfolgte. Auch, und das war später ganz wesentlich, ging das jeweilige Sukzessionsrecht von den brandenburgischen Markgrafen, auf die beiden Herzöge von Pommern über. Die diesbezüglichen Vereinbarungen aus dem Vertrag von Kremmen wurden hierdurch revidiert. Als im Mai 1264 Herzog Wartislaw kinderlos starb, fielen seine Ländereien damit nicht wie ursprünglich 1236 in Kremmen vereinbart an Brandenburg, sondern stattdessen an Herzog Barnim I., der dadurch Pommern wieder unter einer Regentschaft vereinte.
Für die Mark war der Tausch des küstennahen Land Wolgast mit dem Binnengebiet der Uckermark für den Augenblick ein Zugewinn, lag die Uckermark doch direkt nördlich der märkischen Kerngebiete und brachte mit Prenzlau den Markgrafen eine ansehnliche, aus drei Teilen bestehende städtische Perle ein, die Herzog Barnim zuvor mit großem Augenmerk gefördert hatte.
Johann und Otto, die Städtegründer
Die umfangreiche Ausweitung des brandenburgische Territorium während des Regiments der Markgrafenbrüder gäbe schon Anlass genug, ihnen unter den bisherigen askanische Herrschern der Mark einen vornehmen Platz in der Geschichte einzuräumen. Doch traten sie als Begründer von zahlreichen Stadtsiedlungen in ihrer Zeit ganz besonders hervor, was ihnen den Beinamen die Städtegründer verschaffte. Ein Ehrentitel der zeitgleich übrigens auch dür Herzog Barnim I. von Pommern verwendet wurde, über den wir gerade erst im vorherigen Absatz sprachen. Sie errichteten ebenso ein Netz von Burgen über das Land. Beispielhaft erwähnt Spandau, Prenzlau, Oderberg, Burg Stargard, Mittenwalde, Burg Alvensleben oder Landsberg. An vielen dieser genannten Stellen standen bereits Wehranlagen, oft sogar noch aus slawischer Zeit. Diese wurde gezielt baulich erweitert und erheblich verstärkt. Da viele Städte, gerade die noch jungen, nicht nur in der Mark, auch sonst im Reich, nicht über starke und wehrhafte Mauern verfügten, waren noch die nahegelegenen Burgen Zufluchtsort und Ort des lokalen Widerstands gegen einen Angreifer. Wir erinnern uns in dieser Hinsicht an die Burgenverordnung aus der Zeit Heinrichs I. als Verteidigungsmittel gegen die Überfälle der Ungarn. Mit der Zeit, wenn sie nicht sowieso schon inmitten der Siedlung existierten, wuchsen viele Städte regelrecht an und um die Festungsanlage herum, so dass Burgen ebenso Teil des Stadtbilds wurden wie die unvermeidlichen Kirchenbauten an prominenter Stelle. Bei einer einzigen Anlage blieb es derweil in den meisten großen Städten nicht aber das ist nicht Gegenstand der jetzigen Betrachtung.
Über die Bedeutung der Städte als wichtiger Wirtschaftsfaktor wurde bereits gesprochen. In der Zeit der Staufer entstanden im Reich überall neue Städte. Gezielte Neuanlagen waren kaum mehr der Fall, stattdessen erhielten vorhandene, florierende Siedlungen das Stadtrecht. In den alten Reichsteilen, wo besonders entlang des Rheins noch aus der römischen Antike Städte mit schon tausendjähriger Geschichte existierten aber auch andernorts, so in Franken, Schwaben, Bayern, war die Siedlungsdichte beginnend der fränkischen Landnahme mittlerweile so hoch, dass geplante Stadtgründungen allenfalls in Form einer Neustadtgründung als eigener Stadtteil vollzogen wurde. Für gewöhnlich wuchsen diese Stadtteile dann über die Zeit zusammen und bildeten eine größere, einflussreichere Kommune. Und genau solche großen, wirtschaftlich und kulturell hervorstechenden Stadtkommunen waren es, die nach mehr Unabhängigkeit zu strebten. Die Situation in Oberitalien ist hierbei ein besonders extremes Beispiel. Fast schon als ein Naturgesetz war das Streben großer Städte sich dem Zugriff der Landesherren auf die eigene, städtische Politik zu entziehen. Das aufstrebende Stadtbürgertum und der daraus heranwachsende Stadtadel, strebte nach größerer Unabhängigkeit, wenn möglich nach völliger Autonomie von den umgebenden Territorialfürsten. Diese Entwicklungen kannte man im ostsächsischen Raum noch nicht oder nur sehr vereinzelt. Die Orte in den Siedlungsräumen rechts der Elbe waren noch jung, ihre Entwicklung und ihr Wachstum nicht weit fortgeschritten, die Bindung an die Landesfürsten noch gesund und eng.
Die Städte der Altmark klammern wir bei der weiteren Betrachtung aus. Von einzelnen wie Stendal, Tangermünde, Werben, Salzwedel oder Wolmirstedt haben wir bereits gelesen, sie hatten die notwendige Zeit zum Wachstum und zur Reife. Konzentrieren wir uns stattdessen die Orte rechts der Elbe, dort existierte zu Beginn der Regierungszeit Johanns I. und Ottos III. nur Brandenburg an der Havel als einzige märkische Stadt. Ab den späten 30‘er Jahren des 13. Jahrhunderts entstanden dort eine ganze Reihe weiterer Städte. In den meisten Fällen wurden hierzu größere Ortschaften, jene die das Markt- und Niederschlagsrecht besaßen, wir erklären noch worum es sich dabei handelte, mit dem Stadtrecht versehen.
Dauerhaft wichtigste Stadtgründung war die Doppelstadt Berlin und Cölln. Es gab an diesem Platz zwischen Spree, Havel und Dahme schon lange eine slawische Ansiedlung, aus der wegen der äußerst günstigen Lage durch den Zuzug von deutschen Fernhändler Anfang des 13. Jahrhunderts ein Marktflecken wurde. Jedoch erst unter den Markgrafen Johann und Otto wurde der Ausbau zur Stadtgemeinde aus strategischen Gründen gezielt vorangetrieben.
Das auf einer Spreeinsel gelegene Cölln wurde erstmals 1237 urkundlich erwähnt, Berlin 1244. Berlin-Cölln erhielt weitreichende Privilegien für den Handel, darunter das Zoll- und Stapelrecht. Es war die Absicht der Markgrafen das südlich davon liegende Handelszentrum in Köpenick an Bedeutung zu verdrängen. Köpenick und die Gebiete des sogenannten Teltow gehörten zu diesem Zeitpunkt noch dem Markgrafen Heinrich III. von Meißen. Dass Köpenick nach dem gewonnenen Teltow-Krieg um 1245 endgültig an Brandenburg fallen würde, war sicher nicht abzusehen und selbst danach war die Lage der nördlich gelegenen Zwillingsstadt so günstig und vorteilhaft, dass die Entwicklung von Berlin-Cölln als bestimmendes Handelszentrum der Mittelmark und darüber hinaus, fortan nicht mehr aufzuhalten war.
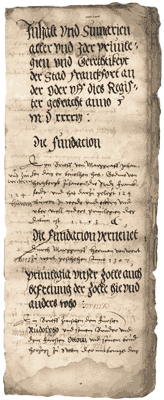
Frankfurt an der Oder war eine der weiteren prominenten Städtegründungen der beiden Brüder. Sie verdient es etwas näher und beispielhaft hervorgehoben zu werden. Gleich vorweg, es war keine Stadtgründung wie es die Bezeichnung vermuten lässt.
Am 12. Juli 1253 beauftragte Markgraf Johann I. einen gewissen Godinus von Hereyberg, er wird fortan als markgräflicher Schultheiß fungieren, die gutgelegene Kaufmannssiedlung an der Oder zur Stadt nach deutschem Gepräge auszubauen. Das in der Urkunde verwendete construentam darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass am Ort der vermeintlichen Stadtgründung längst eine große Siedlung existierte. Es kann nur als Auftrag zur planmäßigen Erweiterung und Pflege der vorhanden Strukturen verstanden werden. Der diesseits des Stroms gelegenen Stadt wurden 124 Hufe Land, rund 2.100 Hektar, links der Oder vom Markgrafen angewiesen. 104 Hufe waren für Ackerbau vorgesehen, wovon die Stadt für jede landwirtschaftlich bebaute Hufe 1/4 Mark Silber jährliche Abgabe zu leisten hatte. Die restlichen 20 Hufe konnte die Stadt zur freien Verfügung nutzen. Weitere 60 Hufe Land wurden rechts der Oder für den Ackerbau zugewiesen, mit den gleichen Steuervorgaben. Die Urkunde erwähnt weiter einen Werder und eine Wiese welche ebenso zugeteilt wurden. Das Gebiet stand der Stadt höchstwahrscheinlich schon lange zuvor zur Verfügung. Mit dem Übergang des Landes Lebus an Das Haus Brandenburg, ging aller Landbesitz an die Markgrafen über und sie verpachteten mehr oder minder den Städten Ländereien die sie anteilig oder komplett seit Zeiten nutzten. Der Stiftungsbrief vom Juli 1253 ist weit davon entfernt Ausgang einer städtischen Neuanlage zu sein, er verlieh der aufstrebenden Ortschaft deutsches Stadtrecht.
Gemäß der üblichen Vorgehensweise wurde eine siebenjährige Abgabenfreiheit gewährt, beginnend ab dem 11. November 1253, um das Wachstum der Stadt zu fördern. Nach Ablauf der Zeit erhielt Frankfurt, Vrankenforde damals genannt, das Stadtrecht Berlins, welches wesentlich dem Stadtrecht Brandenburgs an der Havel entsprach. Keine Abgaben wurden für Handelsgeschäfte, sowohl der Käufer als Verkäufer erhoben, wenn sie unterhalb zwei Schillingen leichter oder einem Schilling schwerer Pfennige blieben. Es entsprach 24 Silberpfennigen mit niedrigem Silbergehalt (ca. 0,95 g) oder zwölf Pfennigen mit hohen Silbergehalt (ca. 1,90 g). Weiter war der Handel mit Gemüse, Eiern, Käse, Butter, Fischen die in kleinen Mengen verkauft wurden, abgabebefreit. Kaufmannswaren wurden ab der oben genannte Höhe verzollt. Es war den Bewohnern erlaubt ein Kaufhaus, ein sogenanntes theatrum zu errichten, das dem üblichen Brauch der Zeit, im Rathaus am Marktplatz eingerichtet wurde. Von den zu entrichtenden Abgaben für die Marktstände und das Kaufhaus, erhielt der Schultheiß ein Drittel, der Rest ging an die markgräfliche Kasse. Weiter wurden Bestimmungen zum Bau einer Oderbrücke, den Brückenzoll, den Bau von Mühlen, das Fischerei- und Jagdrecht erlassen. Die erwähnte Oderbrücke scheint ein wichtiges Anliegen der Stadt gewesen zu sein und wahrscheinlich gab es zum Zeitpunkt der Stadterhebung nach deutschem Recht noch keine Brücke an dieser Stelle. Bislang wurde die dortige Furt durch den Fluss verwendet, wie seit jeher.
Die besondere Stellung der Stadt in späteren Zeiten, zeigte sich dadurch, dass im Jahre 1506 dort die erste brandenburgische Universität gegründet wurde. In Frankfurt an der Oder und nicht in der Residenz Berlin oder den alten Residenzen Spandau, Stendal oder Brandenburg an der Havel, ein Umstand der immerhin beachtenswert ist, und den Einfluss und die hervorragende Lage der wohlhabenden Hansestadt widerspiegelte.
Städte, wir erwähnten es andernorts, waren in den ersterschlossenen Gebieten die urbane nächste Stufe des Landesausbaus. Wo in den slawischen Kolonialgebieten zu Anfang Kirchen und Klöster die religiös-kulturelle, wie auch infrastrukturelle Aufbauarbeit leisteten, die bäuerlichen Siedler dabei die Korsettstange bildeten, übernahmen die Städte die weiterführende Rolle, indem sie in einem Landstrich ein wirtschaftliches Zentrum für Handel und Handwerk darstellten. Die Landesherren stifteten den Städten angrenzendes Land, wofür diese im Umkehrschluss, nach einigen Jahren der Steuerfreiheit, einen festgelegten jährlichen Zins von der Stadt als Abgabe forderten. Städte waren der wirtschaftliche Hauptmotor einer Region und ergiebige Geldquelle der Landesfürsten, die dafür den Städten besondere Privilegien für Handel und Handwerk einräumten und für die Sicherheit der Handelsrouten innerhalb ihres Territoriums sorgten, es zumindest versuchten.
Ehepartner und Nachkommen
Es wird Zeit über die Nachkommenschaft der beiden Brüder zu sprechen. Dass beide Markgrafen königliche Töchter ehelichten, ist mehrfach erwähnt worden. In beiden Fällen brachte es der Mark reichen Landbesitz als Mitgift ein. Johanns Braut Prinzessin Sopia von Dänemark, mit der er sich 1230 verlobte und die er wahrscheinlich 1235 als Ehefrau heimführte, brachte das Land Wolgast ein, das 1250 mit Herzog Boleslaw II. von Pommern im Vertrag von Landin gegen die Uckermark eingetauscht wurde. Die Ehefrau Ottos III., Prinzessin Beatrix von Böhmen erhielt von ihrem Vater als Mitgift die Oberlausitz mit den Städten Bautzen und Görlitz. Das Gebiet war vom sonstigen brandenburgischen Kernland getrennt und wegen der über Jahre andauernden kriegerischen Konflikte mit Meißen politisch autonomer als die sonstigen märkischen Provinzen, was auch an den besonderen Besitzverhältnissen lag. Die Oberlausitz war rechtlich zunächst nur Pfandbesitz, tatsächlich ging das Land erst in der kommenden Generation voll an die Mark über.
Schauen wir uns als erstes die Nachkommenschaft Markgraf Johanns I. an. Ab 1237 schenkte ihm seine Gattin Sophia fast jedes Jahr ein Kind. So kam 1237 mit Johann ein erster Sohn und Erbe zur Welt, gefolgt von Otto im Jahre 1238, Konrad 1240, Helene 1241, die einzige Tochter aus dieser Verbindung und Erich 1242. Sein Name war die eingedeutschte Namensreminiszenz des großen dänischen Vorfahren der Mutter, Erik I. Ejegod. Insgesamt vier Söhne und eine Tochter erreichten damit das Erwachsenenalter. Auf dem Höhepunkt des Teltow-Kriegs scheint das markgräfliche Paar keine weiteren Nachkommen gezeugt zu haben, es sind zumindest keine Hinweise belegt. Im Jahre 1247 ist eine weitere Schwangerschaft der Markgräfin erwähnt, doch weder das Kind, noch die Mutter sollten überleben. Sophia starb am 2. November 1247 im Wochenbett. Sie befand sich 1247 trotz ihrer Schwangerschaft auf einer politischen Mission in ihrer Heimat Dänemark. Dort versuchte sie ihre Brüder, König Erik von Dänemark und Herzog Abel von Schleswig zu versöhnen, was nur kurze Zeit gelang, denn schon bald nach ihrem Tod brachen die Auseinandersetzungen schlimmer denn je aus und endeten erst mit der angewiesenen Ermordung des Königs durch den eigenen Bruder, der dann seinerseits 1250 den dänischen Thron bestieg.
Markgraf Johann blieb im Anschluss fast acht Jahre Witwer. Eine zügige Neuverheiratung war nicht notwendig, die vier bislang gesund heranwachsenden Söhne sicherten die Nachfolge ausreichend. Um die Erziehung der zahlreichen Enkel, auch Otto steuerte ab 1244 fast jährlich weitere Enkel bei, kümmerte sich immer wieder die Großmutter Markgräfin Mechthild, die Witwe Albrechts II. von Brandenburg. Sie scheint eine außergewöhnlich Persönlichkeit gewesen zu sein und als Patriarchin im Schatten ihrer regierenden Söhne weiterhin großen Einfluss ausgeübt zu haben. So darf man annehmen, dass sie wesentlich die Klammer zwischen den Brüdern Johann und Otto in Brandenburg und deren älterer Schwester am welfischen Hof in Braunschweig-Lüneburg bildete. Über ihren beherzten Schritt im Jahre 1221 die Lehnsvormundschaft vom Magdeburger Erzbischof abzukaufen und im Sinne ihrer unmündigen Söhne die Regentschaft in der Mark zu übernehmen, wurde zu Anfang des letzten Kapitels gesprochen. Wir wissen auch dass sie weiterhin ein eigenes Siegel besaß, dass gelegentlich von Johann und Otto sogar noch lange nach ihrem Regierungsantritt benutzt wurde. Besonders der mutterlosen Kinder des Markgraf Johanns wird sie sich in Salzwedel, ihrer altmärkischen Residenz angenommen haben. Darüber hinaus wissen wir, dass ihre Tochter, die erwähnte Herzogin von Braunschweig-Lüneburg ihre Söhne ebenfalls einige Zeit in Salzwedel erziehen ließ, wir berichteten darüber im letzten Kapitel. Markgräfinwitwe Mechthild starb im Jahre 1255, der Ort ist nicht belegt, es dürfte aber mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Residenzstadt Salzwedel gewesen sein. Sie wurde im Kloster Lehnin neben ihrem Mann Albrecht II. zur letzten Ruhe gebettet.
Markgraf Johann I., sein erstgeborener und gleichnamiger Sohn wurde im gleichen Jahr 18, der nächstgeborene Sohn Otto 17, erwog nun doch eine erneute Heirat. Noch im Todesjahr der Mutter heiratete Johann mit Jutta von Sachsen, die Tochter des askanischen Herzogs Albrecht von Sachsen-Wittenberg. Der genaue Tag ist unbekannt, es muss irgendwann nach dem 7. Mai 1255 gewesen sein, denn von diesem Datum existiert ein Dispensschreiben Papst Alexander IV., ausgestellt in Neapel, worin dieser dem zukünftigen Ehepaar die Erlaubnis zur Hochzeit erteilt, obwohl sie im dritten Grade miteinander verwandt waren. Auch Johanns zweite Frau schenkte ihm mindestens fünf Kinder, es waren dies Agnes wahrscheinlich Anfang 1256, Heinrich Ende 1256, Mechthild um 1257, Albrecht um 1258 und schließlich Hermann, nach 1258. Markgraf Johann I. hatte damit nicht weniger als sieben Söhne und drei Töchter die das Erwachsenenalter erreichten. Ein Segen und Fluch zugleich. Bevor darauf näher eingehen, schauen wir uns die Nachkommenschaft Markgraf Ottos III. an, seines jüngeren Bruders. Wie wir schon lasen, war Otto mit der böhmischen Prinzessin Beatrix, Tochter König Wenzels I. von Böhmen verheiratet. Mit ihr hatte Otto sechs Kinder, vier Söhne und zwei Töchter. 1244 kam mit Johann der erste Sohn Ottos zur Welt, ihm folgte rund zwei Jahre später, um 1246 ein zweiter Sohn der den Namen Otto erhielt. Interessant, dass beide regierenden Markgrafen ihren ersten beiden Söhne die gleichen Namen gaben. Wir werden an all den Ottos, Johanns und Albrechts noch viel Freude haben. Mit Albrecht ist das Stichwort gefallen, 1250 kam mit Albrecht ein dritter Sohn Ottos zur Welt, dem um 1255 ein weiterer Otto folgte. Zu erwähnen sind noch zwei Töchter namens Kunigunde und Mathilde (Mechthild), deren Geburtsjahr unbekannt ist. Das Haus Brandenburg hatte unter Johann I. und Otto III. elf Söhne und fünf Töchter hervorgebracht. Ein schwere Hypothek hinsichtlich des weiteren Fortbestands Brandenburgs als ungeteiltes Fürstentum.
Wechsel ins Lager der antistaufischen Opposition
Mit dem Tod des Kaisers, trat sein bereits 1237 zum Mitkönig gewählter Sohn Konrad, jetzt offiziell Konrad IV., als eingesetzter Universalerbe die Nachfolge an. Doch weder im Reich, noch in Sizilien, dass der Vater Jahrzehnte dem römisch-deutschen Reich angliedern wollten, noch Jerusalem waren er unangefochten. Statt deutschen Reichsteil zunächst zu sichern und den Gegenkönig Wilhelm von Holland zum Verzicht auf den Thron zu zwingen, begab er sich auf einen frühzeitigen Italienzug. Erstes Ziel war die Unterwerfung Siziliens, wo sein Halbruder Manfred, ein unehelicher Sohn des verstorbenen Kaisers die Regentschaft führte. Von dieser Basis aus sollte Reichsitalien, wo die staufische Partei, die Ghibellinen die Oberhand hatten, unterworfen werden, einem Ziel dem der Vater immerhin mehrmals nah war. Auf solcher Basis sollten dann im deutschen Reichsteil, so die Vorstellung, die Verhältnisse bereinigt werden, vielleicht, wegen der erhofften Erfolge in Italien, dann ohne Kampfhandlungen. Im Herbst 1251 begann sein Zug über die Alpen, wir gehen hier nicht näher auf den Verlauf des italienischen Feldzugs ein und bleiben im Reichsteil nördlich der Alpen.
Mit dem Abmarsch des staufischen Heers in die südlichen Gefilde, begann Wilhelm von Holland als Gegenkönig augenblicklich einen regen diplomatischen Austausch mit den sächsischen Fürsten und dem König von Böhmen, welche bislang halb neutral, halb staufisch gesinnt waren. Wesentlich führte ein Heiratsprojekt mit dem welfischen Hause zum Parteiwechsel einiger einflussreicher sächsischer Fürsten. Am 25. Januar heiratete Wilhelm in Braunschweig mit Elisabeth die dritte Tochter Herzog Ottos I. von Braunschweig-Lüneburg, dem Schwager und engsten Verbündeten der brandenburgischen Markgrafen. Die familiäre Verbindung ließ sowohl Herzog Otto I. wie Johann I. und Otto III. ins Lager Wilhelms überwechseln. Es schlossen sich in rascher Folge weitere Fürsten aus dem nordostdeutschen Raum an, prominentester darunter Wenzel I., der König von Böhmen. Das bisherige Übergewicht der Staufer im Reich ging verloren.
Niemand tat den Schritt aus schierer Sympathie zum Gegenkönig, auch war die Verschwägerung nicht der ausschlaggebende Faktor, vielmehr die Hochzeit nur Besiegelung der zuvor ausgehandelten Bedingungen welche die Welfen und Askanier zur Parteinahme bewogen. Und natürlich ging auch der přemyslidische König Wenzel I. von Böhmen nicht leer aus, wie auch sonst niemand der zur Partei Wilhelms hinzutrat. Die Zeit in der die Krone des Reichs an den ging, der die meisten Zuwendungen versprach, sei es in klingender Münze, in territorialen Zuwendungen oder der Verleihung königlicher Rechte, war angebrochen. Hatten schon in der Vergangenheit Reichsoberhäupter zur Erreichung ihrer Ziele auf königliche Rechte verzichtet, so nahm es jetzt erste Formen an, die bald auszuufern begannen und einem Geschacher gleichkamen.

Am 25. März 1252 hielt Wilhelm von Holland in Braunschweig Hoftag ab. An diesem Tag versammelten sich zahlreiche sächsische Fürsten, darunter der Welfenherzog Otto I., die brandenburgischen Markgrafen und Herzog Albert I. von Sachsen sowie König Wenzel I. von Böhmen und gaben nachträglich ihre Stimme zur Wahl Wilhelms ab. Addiert man die Stimmen der drei rheinischen Erzbischöfe hinzu, die Wilhelm schon vor Jahren in Worringen bei Köln ihre Stimme gaben, zieht gleichzeitig die Stimme des Welfen ab und berücksichtigt dass der Wittelsbacher Herzog Otto von Bayern, gleichzeitige Pfalzgraf bei Rhein, als staufischer Anhänger zum einen unter dem Kirchenbann stand und deswegen nicht berechtigt zur Wahl war, zum anderen ohnehin nicht dem Gegenkönig seine Stimme verliehen hätte, so erhielt erstmals ein römisch-deutscher König die Stimmen von Fürsten ganz spezifischer Reichsterritorien, die dereinst das privilegierte Kollegium der wahlberechtigten Kurfürsten stellen werden, nämlich Mainz, Köln, Trier, Böhmen, die Rheinpfalz, Sachsen und Brandenburg.
Am gleichen Tag verfasste Wilhelm von Holland an die Bürger der erblühten, bald den Handel in der Ostsee dominierenden Handelsstadt Lübeck einen Brief, worin er sie aufforderte, sich den brandenburgischen Markgrafen zu unterwerfen, da er mit Zustimmung der Reichsfürsten diesen die Stadt als Reichslehen verliehen habe. Brandenburg sollte die königlichen Stadt, der Begriff Reichsstadt war noch nicht verbreitet, zum Dank für die erwiesene Treue und Unterstützung erhalten, kurz als Lohn für den Parteiwechsel der Markgrafen. Eine weitere Zuwendung wurde den Händlern Brandenburgs zuteil. Ihnen wurde in allen Städten Hollands Zollerleichterung gewährt.
Lübeck, das seine Unabhängigkeit, die es von den Holsteiner Grafen vor noch nicht allzu langer Zeit erst erlangte, nicht wieder verlieren wollte, um einem noch wesentlich mächtigeren Fürstentum sich zu unterwerfen, hing weiterhin, wie die meisten königlichen Städte im deutschen Reichsteil, dem staufischen Lager um Konrad IV. an und widersetzte sich der Anweisung Wilhelms von Holland.
Um sein Recht durchzusetzen, griff Brandenburg nicht zu den Waffen, es setzte auf Diplomatie und erhielt hierin Unterstützung vom Papst. Es mag erstaunen dass die Kurie sich für die weit entfernten brandenburgischen Interessen einsetzte, es war ein vielsagendes Indiz des steilen Aufstiegs der Markgrafen in die Riege der wichtigsten Reichsfürsten der Zeit. Der päpstliche Legat im Heiligen Römischen Reich, Kardinalpriester Hugo von Saint–Cher, ein Vertrauter Innozenz IV., ergriff die Initiative. Er wies die Bischöfe Rudolf von Schwerin und Heinrich von Havelberg an, die Stadt mit dem Interdikt zu belegen, sollte sie sich nicht bis zum 19. Mai, dem Pfingstsonntag, den Markgrafen unterwerfen und den gewählten König anerkennen. Hugo von Saint-Cher wäre schon härter gegen die widerspenstige Stadt vorgegangen, hätten sich die Markgrafen nicht begütigend für die Stadt eingesetzt. Die Androhung des Banns blieb nicht ohne Wirkung. Im April 1252 bekundet Johann I. zu Wolmirstedt dass es unter Vermittlung seiner Getreuen und Vasallen zu einem gütlichen Vertrag zwischen ihm und den Bürgern der Stadt gekommen ist, wobei aller Hader und Zwist beigelegt wäre. Aus dem weiteren Verlauf muss man schließen, dass seitens der Stadt jener Vertrage entweder eine Finte darstellte oder, und das scheint wahrscheinlicher, dass unterschiedliche Parteiungen innerhalb der Stadt miteinander rangen und sich die Anhänger einer unabhängigen, reichsunmittelbaren Kommune durchsetzten, kurz die Stadt unterwarf sich nicht. Am 30. Mai, somit nach Ablauf des vom päpstlichen Legaten gestellten Ultimatums, schrieben die beauftragten Bischöfe von Havelberg und Schwerin dem Dekan und Kapitel von Lübeck sowie den dortigen Pfarrern, dass sie gemäß den ihnen auferlegten Auftrag den Kirchenbann über die Stadt verkünden werden, wenn diese nicht vor Sonntag dem 16. Juni sich unterwarfen, womit nochmal ein letztes, rund zweiwöchiges Ultimatum gestellt wurde. Auch diese Frist versteich, worauf der Bann über die Stadt ausgesprochen wurde, demzufolge alle kirchlichen Aktivitäten einzustellen waren, ferner jedem Christ untersagt war Handel oder Beziehung mit der Stadt zu unterhalten, was selbstverständlich einer Handelsstadt wie Lübeck schweren Abbruch tat. Weiterhin vermieden es die Markgrafen mit Waffengewalt, was ihr gutes Recht gewesen wäre, vorzugehen. Die momentane politische Situation im sächsischen und norddeutschen Raum, hätte eine militärische Intervention zu einem noch unwägbaren Risiken gemacht. In diesem Jahr erst entschied sich das Besitzverhältnis im Lebuser Land zum Vorteil Brandenburgs. Die seit Jahren verfeindeten Meißner unter Markgraf Heinrich III. wurden mit Hilfe des Magdeburger Erzbischofs aus dem Gebiet vertrieben und erst im Folgejahr konnten durch eine Heiratsverbindung beide Häuser engültig mit einander versöhnt werden. Wissend um diese Lage Brandenburgs, konnte Lübeck es im Moment auf eine Zuspitzung der Situation ankommen lassen, stand doch nicht weniger als die eigene Reichsunmittelbarkeit auf dem Spiel.
Es schwiegen weitherhin die blanken, die realen Waffen, dafür wurde auf dem sinnbildlichen Schlachtfeld der Diplomatie desto eifriger gefochten. Die Lübecker gingen in die Offnesive und schrieben direkt an den Reichslegaten Hugo und baten diesen um Vermittlung beim König. Die Bürger, angeführt von Rat und Vogt, argumentierten mit geschickter Raffinesse und bestritten die Rechtmäßigkeit des gegen sie verhängten Kirchenbanns aufgrund von Verfahrensfehlern. So legten sie dar, dass das von ihm, dem päpstlichen Legaten im Reich, an die Bischöfe von Havelberg und Schwerin vergebene Mandat bis zum 19. Mai 1252 gültig war. Die Bischöfe diese Frist verstreichen ließen, ihrerseits eine nochmalige Frist setzten und erst dann den Bann aussprachen, der demgemäß nicht durch päpstliche Legitimation autorisiert gewesen wäre. Das frühere Recht des Stärkeren wurde sukzessive abgelöst von jursitischen Haarspaltereien und Winkelzügen, das mit Gerechtigkeit so wenig zu tun hatte, wie das erwähnte Faustrecht davor. Es war nur die Fortführung von Interessenkämpfen mit anderen Mitteln. Einen weiteren Punkt ihrer Gegenklage kann man wohl nicht rundweg bemängeln, wenn sie von Befangenheit der beiden Bischöfe sprachen. In Bezug auf Bischof Heinrich von Havelberg kann das selbst bei größter Sympathie für die brandenburgischen Markgrafen nicht bestritten werden. Der Vorwurf war im vorliegenden Fall höchstwahrscheinlich zutreffend, der Bischof konnte kaum oder gar nicht frei handeln–. Bischof Heinrich I. entstammte dem altmärkischen Lehnsadel der Kerkows, deren Stammsitz bei Salzwedel war. Vater und Brüder standen in engstem Verhältnis zu den Markgrafen, waren Dienstmannen und mit brandenburgischen Lehen versehen, so auch Heinrich selbst, vor Antritt seines Bischofsamts, dass er auf Betreiben der Markgrafen erhielt. Und auch der Schweriner Bischof, wenngleich nicht in Abhängigkeit zu Brandenburg stehend, schien seine Handlung von Rücksicht und wohl auch aus Furcht vor den Markgrafenbrüdern bestimmen. Dies bekundete er dem Bremer Erzbischof, seinem Metropoliten, indem er anmerkte, er habe keinesfalls wegen der Markgrafen anders handeln können, gleich ob es richtig oder falsch war. Nun muss man trotz des berechtigten Verdachts der Befangenheit immerhin berücksichtigen, dass die Weisung des päpstlichen Legaten eindeutig war und hierin den genannten Bischöfen überhaupt kein Spielraum gegeben war.
Die Dinge um Lübeck nahmen dann einen völlig veränderten Lauf. Dänemark, wo in rascher Folge innerhalb von drei Jahren, drei Könige, alles Brüder, den Thron bestiegen und nun Christoph I. regierte, garantierte der Stadt am 31. Juli 1252 in seine Souveränität, eine Kriegserklärung, die Brandenburgs bisherige Politik des Gewaltverzichts augenblicklich zum Einsturz brachte.
Feldzug gegen Dänemark
Anfang 1253 beteiligen sich beide Markgrafen an einem Feldzug gegen Dänemark. Die Vorgeschichte dazu in aller Kürze: Wie schon erwähnt wurde König Erik IV. 1250 ermordet, worauf der für den Mord verantwortliche Bruder Abel den Thron bestieg. Der Brudermord ging nicht ohne Komplikationen am neuen König vorbei, zweimal zwölf dänische Ritter mussten als Leumundszeugen auf dem Thing seine Unschuld beschwören und dennoch blieb die Sache an ihm haften. Abels ältester aber noch jugendlicher Sohn befand sich bei Thronbesteigung des Vaters in Paris, wo er an der dort entstehenden Universität eine Ausbildung genoss. König Abel ließ ihn von dort abberufen, um ihn, ganz der dänischen Tradition, zum Mitkönig, wenn auch nicht Mitregenten, wählen zu lassen. Auf der Rückreise wurde der Kronprinz, Waldemar sein Name, vom Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden gefangen genommen und eingekerkert. Es gab hierzu keinerlei rechtfertigende Veranlassung. Das Erzbistum stand in keinem feindseligen Verhältnis zu Dänemark, weder zum bisherigen König Erik IV. noch zum Brudermörder und Nachfolger Abel. Die Tat kann daher nur als eine der vielen selbstsüchtigen Maßnahmen gewertet werden, die mit dem Zerfall der königlichen Autorität im Reich einherging. Gegenkönig Wilhelm von Holland stand noch ganz unter dem Einfluss des mächtigen Kölner Kirchenfürsten und war, selbst wenn er es denn wollte, nicht in der Lage Recht und Ordnung durchzusetzen. Der Staufer Konrad IV., machtloser Mitkönig an der Seite des kirchengebannten Vaters hatte von diesem kaum Rechtsgewalt im deutschen Reichsteil erhalten und führte ein Schattendasein, geduldig auf den Tag harrend, der ihn einst zum Nachfolger seines Vaters im Reich machen würde. Jener Vater und Kaiser Friedrich II., der in Italien seit Jahren politischen gelähmt, die Zustände nicht mehr zu wenden vermochte, obwohl er mehrmals kurz davor stand. Der Tod des Kaisers am Ende dieses ereignisreichen Jahres 1250, stürzte das Reich in ein chaotisches Machtvakuum. Ein Reich in dem der eine König ungeübt in der Machtausübung war und vom Vater zu Lebzeiten diesbezüglich auch keine Autorisierung hatte und ein Gegenkönig auf der anderen Seite, dem zur Machtentfaltung die finanziellen Mittel fehlten. Auf dieser Ausgangslage war dem Treiben auf allen Ebenen Tür und Tor geöffnet.
So kam es denn auch, dass argloser Königssohn auf der Durchreise in die Hände eines übermäßig selbstherrlichen agierenden Kirchenfürsten fiel, der zur Freilassung eine stolze Lösegeldsumme von 6.000 Mark Silber forderte, die König Abel von Dänemark in dieser Höhe nicht entrichten konnte.
Schon zwei Jahre später, im Sommer 1252 fiel König Abel im Kampf gegen die Ostfriesen in der Schlacht von Oldenswort an der Eider. Als Nachfolger folgte der jüngste Bruder, Christoph I. dritter und letzte Sohn König Waldemars II. von Dänemark. Er ließ am Weihnachtstag des Jahres 1252 im Dom zu Lund
Eine Nachfolge des noch immer vom Kölner Erzbischof gefangen gehaltenen Waldemar war in weite Ferne gerückt, doch regte sich eine Opposition gegen König Christoph. Es waren zum einen die Parteigänger des verstorbenen Königs Abel, welche einen seiner Söhne auf den Thron heben wollten, zum anderen und etas später, dann aber in unversöhnlicher Weise, der neue Erzbischof von Lund, Jakob Erlandsen. Er erwies sich fortan als der kompromissloseste Gegner des Königs. Die erste Gruppe kam aus dem Familienkreis der Königinwitwe Mechthild von Holstein. Ihre Brüder Graf Johann I. von Holstein-Kiel und Graf Gerhard I. von Holstein-Itzehoe, versuchten den Anspruch ihrer Neffen auf die dänische Krone durchzusetzen, mindestens aber auf das Herzogtum Schleswig zu verteidigen.
Dieser Oppositionsgruppe schloss sich Brandenburg mit ganz eigenen Interessen an. König Christoph I., wir hatten am Ende des letzten Ansatzes darüber berichtet, hat sich den Streit der Stadt Lübeck mit den brandenburgischen Markgrafen zu Eigen gemacht und der Stadt die Unabhängigkeit garantiert, mit dem langfristigen Ziel sich die wichtige Handelsstadt selbst wirtschaftlich nutzbar, vielleicht sogar zu unterwerfen. Des dänischen Königs Schritt, provozierte die bewaffnete Intervention Brandenburgs geradezu heraus.
Der Feldzug schaffte es Waldemar, den befreiten Sohn des vormaligen Königs Abel, sein Schleswiger Erbe zu sichern und weiter den dänischen König Christoph zu zwingen, seine Lübecker Ambitionen aufzugeben, zumindest dem Anschein nach.
Gegen die Stadt selbst zogen die Markgrafen weiterhin nicht zu Felde. Sie wollten eine friedliche Lösung erzielen un die Stadt nicht durch einen Militärschlag niederwerfen und beschädigen. Reine Menschenfreundlichkeit war es nicht, die sie daran hinderte. Die reiche Stadt verfügte bereits über eine starke Ringmauer und war keinesfalls leicht zu nehmen. Aushungern war fast zwecklos, Lübeck beherrschte das Meer und konnte über den Seeweg jederzeit Nahrungsmittel und auch Söldner in die Stadt bringen. Ein Eroberung war mit den damaligen Mitteln der Mark nicht denkbar.
Erreicht hatte Brandenburg somit nichts. Immerhin leisteten die Grafen von Holstein finanzielle Kompensation für den von Markgraf Otto III. errechneten Unkosten von rund 6.000 Mark Silber. Zur Begleichung wurde dem Markgrafen die holsteinische Stadt Rendsburg als Pfand verliehen, die bis ins Jahr 1264 unter brandenburgischer Pfandherrschaft blieb.
Lübeck vermochte nach Wegfall der dänischen Schutzmacht Papst Innozenz IV. für seine Sache zu gewinnen. Am 15. und ein weiteres Mal am 20. Januar 1254 urkundet der Papst vom Lateran aus zum Vorteil der Stadt. Er bestätigt die unantastbare Reichsunmittelbarkeit Lübecks und widerspricht hierin den zwei Jahre zuvor verkündeten Bestimmugen König Wilhelms von Holland. Er überstimmt damit auch die nweisungen seines eigenen Reichslegaten Hugo von Saint-Cher. Der Papst nahm damit, wie auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten, ganz aktiv Einfluss auf die Reichspolitik, was ihn viele Sympathien bei der antistaufischen Koalition kostete und der Entfremdung vom Papstum im deutschen Reichsteils neue Nahrung lieferte.

